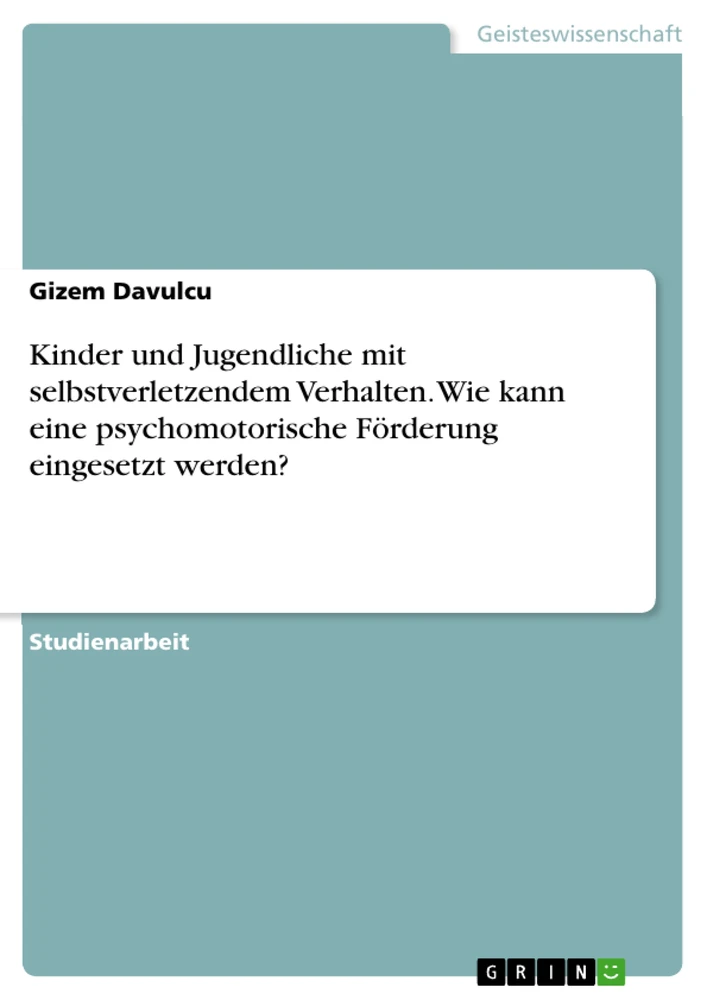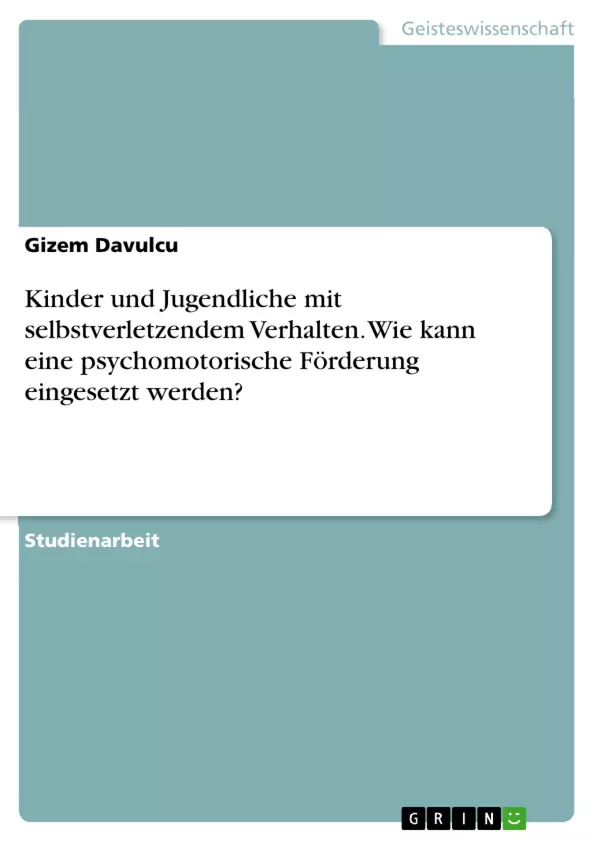In der Hausarbeit soll im ersten Abschnitt auf die Schlüsselbegriffe eingegangen werden, um Klarheit zu schaffen und um die Begriffe voneinander abtrennen zu können. Auch die Selbstverletzung, beziehungsweise das selbstverletzende Verhalten wird klar definiert. Im nächsten Abschnitt wird auf wichtige Erfahrungs- und Kompetenzfelder in Bezug auf Selbstverletzung eingegangen. Erläutert werden hier die Punkte der Körper- Material- und Sozialerfahrungen.
Darauf folgen die Perspektiven beziehungsweise die Sichtweiten in der Psychomotorik, ebenfalls in Bezug auf Selbstverletzung. Diese sind die kompetenztheoretische, erkenntnisstrukturierende, selbstkonzeptorientierte Perspektive und die Sinnesverstehende Perspektive. Nach der Definition dieser beiden Sichtweiten, nehme ich eigene Stellung zu den Perspektiven und verknüpfe sie miteinander. Im nächsten Punkt folgt die methodisch didaktische Überlegung einer psychomotorischen Förderung bei Selbstverletzung. Im letzten Abschnitt wird auf eine Fördereinheit eingegangen, wie solch eine Förderung ausschauen könnte.
Das Konzept der Psychomotorik zählt mittlerweile zu den bedeutendsten pädagogischen und therapeutischen Angeboten in vielen Bereichen. In dieser Hausarbeit soll erläutert werden, wie eine psychomotorische Fördereinheit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ausschaut. Wie eine psychomotorische Fördereinheit beispielsweise eingesetzt werden kann. Hierbei soll speziell auf die Selbstverletzung eingegangen werden. In den letzten drei Jahren meines Bachelorstudiengangs wurde das Thema der Selbstverletzung nicht oft thematisiert. Aufgrund dessen interessiert mich dieser Bereich umso mehr. Schon vor meinem Studium war mir bekannt, dass die Psyche und die Bewegungen eng miteinander verknüpft sind.
Alles was wir tun muss einen Grund haben. Im Sportverein beispielsweise wollte ich damals immer den ersten Platz belegen und warum? Weil meine Innenwelt einen Erfolg sehen wollte. Das heißt meine Innenwelt, meine Gefühle und Emotionen regten mich dazu an, an einem Wettkampf teilzunehmen und die Außenwelt, also meine Bewegungen, die Motorik tat alles dafür, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Um das Beispiel auf die Hausarbeit übertragen zu können, ist damit gemeint, das auch hinter jeder Selbstverletzung (Bewegung) eine Emotion, ein Gefühl steht (Psyche).
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. GRUNDBEGRIFFE DER MOTORIK
- 2.1. SENSOMOTORIK
- 2.2. PSYCHOMOTORIK
- 2.3. MOTOPÄDAGOGIK
- 3. KRANKHEITSBILD DES SELBSTVERLETZENDEN VERHALTENS
- 4. WICHTIGE ERFAHRUNGS- UND KOMPETENZFELDER DER PSYCHOMOTORIK IN BEZUG AUF SELBSTVERLETZENDEM VERHALTEN
- 4.1. KÖRPERERFAHRUNG ICH-KOMPETENZ
- 4.2. MATERIALERFAHRUNG -SACHKOMPETENZ
- 4.3. SOZIALERFAHRUNG -SOZIALKOMPETENZ
- 5. PERSPEKTIVEN
- 5.1. KOMPETENZTHEORETISCHE, ERKENNTNISSTRUKTURIERENDE, SELBSTKONZEPTORIENTIERTE PERSPEKTIVE
- 5.2. SINNVERSTEHENDEN PERSPEKTIVE
- 5.3. VERKNÜPFUNG
- 6. METHODISCH DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN EINER PSYCHOMOTORISCHEN FÖRDERUNG BEI SELBSTVERLETZENDEM VERHALTEN
- 7. FÖRDEREINHEIT
- 7.1. KONZEPT
- 7.2. MENSCHENBILD
- 7.3. KLIENTEL
- 7.4. INHALTE UND ZIELE
- 7.5. DIE FACHKRAFT
- 7.6. SETTING
- 8. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einsatz psychomotorischer Förderung bei Kindern und Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie eine psychomotorische Fördereinheit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gestaltet werden kann und welche positiven Effekte sie im Umgang mit Selbstverletzung haben kann.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Motorik, Sensomotorik und Psychomotorik
- Das Krankheitsbild des selbstverletzenden Verhaltens und seine Ursachen
- Wichtige Erfahrungs- und Kompetenzfelder der Psychomotorik im Kontext von Selbstverletzung (Körper-, Material- und Sozialerfahrung)
- Verschiedene Perspektiven in der Psychomotorik bezüglich Selbstverletzung
- Methodisch-didaktische Überlegungen zur Gestaltung einer psychomotorischen Fördereinheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Motivation der Autorin, sich mit dem Einsatz psychomotorischer Förderung bei selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen. Es wird die enge Verknüpfung von Psyche und Motorik hervorgehoben und der Aufbau der Arbeit skizziert. Die Autorin betont die Relevanz des Themas aufgrund der bisherigen Unterrepräsentation im Studium und ihrer persönlichen Erfahrungen.
2. GRUNDBEGRIFFE DER MOTORIK: Dieses Kapitel definiert die grundlegenden Begriffe Motorik, Sensomotorik und Psychomotorik. Es wird zwischen physischer und emotionaler Bewegung unterschieden und die Interaktion von Wahrnehmung und Bewegung im Kontext der Sensomotorik detailliert beschrieben. Der Begriff der Psychomotorik wird als Wechselwirkung zwischen Psyche (Wahrnehmung, Emotion, Kognition) und Motorik (Bewegung, Koordination, Gleichgewicht) erklärt. Der Abschnitt über Motopädagogik verbindet psychologische, pädagogische und medizinische Ansätze mit dem Fokus auf Bewegung als zentralen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung.
3. KRANKHEITSBILD DES SELBSTVERLETZENDEN VERHALTENS: Dieses Kapitel beschreibt das Krankheitsbild des selbstverletzenden Verhaltens. Es wird betont, dass es sich nicht um eine eigenständige Diagnose handelt, sondern meist mit komplexeren Störungsbildern wie Autismus, Persönlichkeitsstörungen oder Störungen des Sozialverhaltens einhergeht. Verschiedene Formen der Selbstverletzung werden genannt, und das ausgeprägte Selbstwertdefizit und instabile Selbstbild der Betroffenen hervorgehoben.
4. WICHTIGE ERFAHRUNGS- UND KOMPETENZFELDER DER PSYCHOMOTORIK IN BEZUG AUF SELBSTVERLETZENDEM VERHALTEN: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Körper-, Material- und Sozialerfahrungen innerhalb der psychomotorischen Förderung im Kontext von selbstverletzendem Verhalten. Es wird detailliert erläutert, wie diese Erfahrungen zur Entwicklung von Ich-Kompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz beitragen und somit einen positiven Einfluss auf die Bewältigung von Problemen haben können.
5. PERSPEKTIVEN: In diesem Kapitel werden verschiedene Perspektiven der Psychomotorik im Umgang mit Selbstverletzung vorgestellt und miteinander verknüpft. Es werden die kompetenztheoretische, erkenntnisstrukturierende, selbstkonzeptorientierte sowie die sinnverstehende Perspektive erläutert und ihre Bedeutung für die therapeutische Arbeit herausgearbeitet. Die Autorin integriert diese Perspektiven und bildet ihre eigene Sichtweise.
6. METHODISCH DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN EINER PSYCHOMOTORISCHEN FÖRDERUNG BEI SELBSTVERLETZENDEM VERHALTEN: Dieses Kapitel befasst sich mit methodisch-didaktischen Überlegungen für den Aufbau einer psychomotorischen Fördereinheit für Kinder und Jugendliche mit selbstverletzendem Verhalten. Es werden didaktische Prinzipien und konkrete methodische Ansätze vorgestellt und diskutiert, die eine erfolgreiche und traumasensible Förderung ermöglichen sollen.
Schlüsselwörter
Psychomotorik, Selbstverletzendes Verhalten, Kinder, Jugendliche, Bewegungsförderung, Körpererfahrung, Sozialkompetenz, Therapie, pädagogische Förderung, Kompetenzentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Psychomotorische Förderung bei selbstverletzendem Verhalten
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einsatz psychomotorischer Förderung bei Kindern und Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten. Das Hauptziel ist es aufzuzeigen, wie eine psychomotorische Fördereinheit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gestaltet werden kann und welche positiven Effekte sie im Umgang mit Selbstverletzung hat.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Motorik, Sensomotorik und Psychomotorik; das Krankheitsbild des selbstverletzenden Verhaltens und seine Ursachen; wichtige Erfahrungs- und Kompetenzfelder der Psychomotorik im Kontext von Selbstverletzung (Körper-, Material- und Sozialerfahrung); verschiedene Perspektiven in der Psychomotorik bezüglich Selbstverletzung; und methodisch-didaktische Überlegungen zur Gestaltung einer psychomotorischen Fördereinheit.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundbegriffe der Motorik (inkl. Sensomotorik, Psychomotorik und Motopädagogik), Krankheitsbild des selbstverletzenden Verhaltens, wichtige Erfahrungs- und Kompetenzfelder der Psychomotorik in Bezug auf selbstverletzendes Verhalten, Perspektiven (kompetenztheoretisch, erkenntnisstrukturierend, selbstkonzeptorientiert und sinnverstehend), methodisch-didaktische Überlegungen, Fördereinheit (Konzept, Menschenbild, Klientel, Inhalte und Ziele, Fachkraft, Setting) und Fazit.
Wie werden Motorik, Sensomotorik und Psychomotorik definiert?
Die Hausarbeit definiert die Begriffe und unterscheidet zwischen physischer und emotionaler Bewegung. Sensomotorik wird als Interaktion von Wahrnehmung und Bewegung beschrieben, während Psychomotorik die Wechselwirkung zwischen Psyche (Wahrnehmung, Emotion, Kognition) und Motorik (Bewegung, Koordination, Gleichgewicht) darstellt. Motopädagogik verbindet psychologische, pädagogische und medizinische Ansätze mit dem Fokus auf Bewegung als zentralen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung.
Wie wird das Krankheitsbild des selbstverletzenden Verhaltens beschrieben?
Die Hausarbeit beschreibt selbstverletzendes Verhalten als ein komplexes Phänomen, das meist mit anderen Störungsbildern einhergeht (z.B. Autismus, Persönlichkeitsstörungen). Es werden verschiedene Formen der Selbstverletzung genannt und das ausgeprägte Selbstwertdefizit und instabile Selbstbild der Betroffenen hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Körper-, Material- und Sozialerfahrung in der psychomotorischen Förderung?
Die Hausarbeit betont die Bedeutung dieser Erfahrungen für die Entwicklung von Ich-Kompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz. Es wird erläutert, wie diese Kompetenzen zur Bewältigung von Problemen und zum Umgang mit selbstverletzendem Verhalten beitragen können.
Welche Perspektiven werden in Bezug auf die psychomotorische Förderung betrachtet?
Die Arbeit präsentiert und verknüpft verschiedene Perspektiven: die kompetenztheoretische, erkenntnisstrukturierende, selbstkonzeptorientierte und die sinnverstehende Perspektive. Ihre Bedeutung für die therapeutische Arbeit wird herausgearbeitet und in eine zusammenhängende Sichtweise integriert.
Welche methodisch-didaktischen Überlegungen werden angestellt?
Das Kapitel befasst sich mit der Gestaltung einer psychomotorischen Fördereinheit. Es werden didaktische Prinzipien und konkrete methodische Ansätze vorgestellt, die eine erfolgreiche und traumasensible Förderung ermöglichen sollen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Psychomotorik, Selbstverletzendes Verhalten, Kinder, Jugendliche, Bewegungsförderung, Körpererfahrung, Sozialkompetenz, Therapie, pädagogische Förderung, Kompetenzentwicklung.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnte ein Link zum vollständigen Dokument eingefügt werden, falls verfügbar.)
- Citation du texte
- Gizem Davulcu (Auteur), 2019, Kinder und Jugendliche mit selbstverletzendem Verhalten. Wie kann eine psychomotorische Förderung eingesetzt werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505509