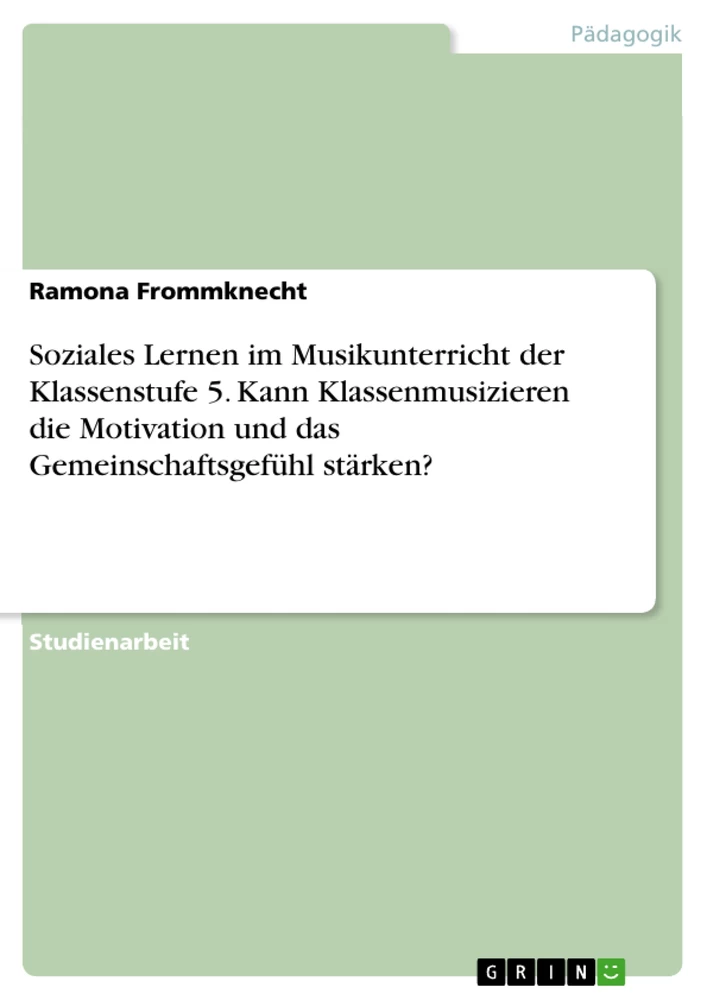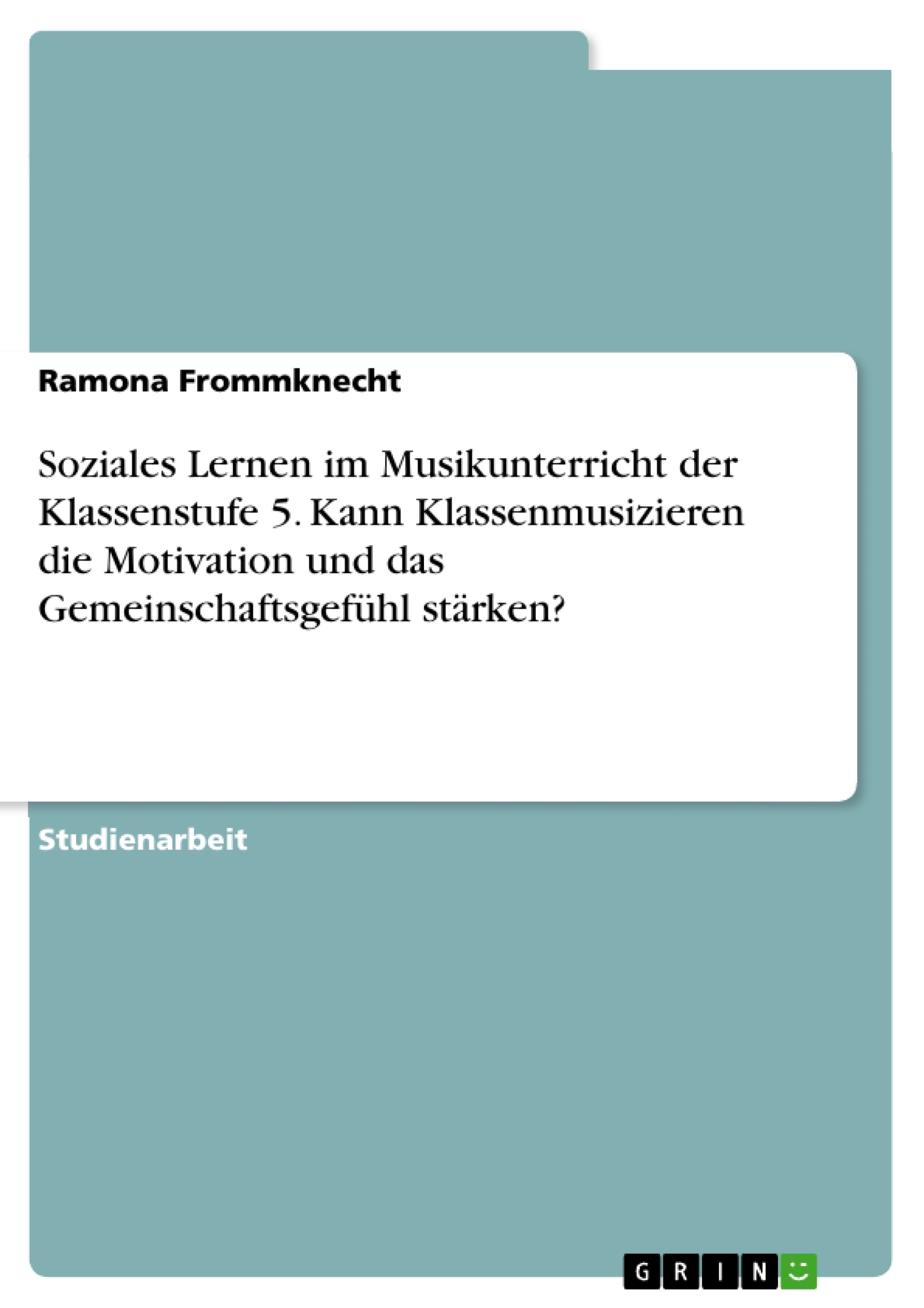Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Lehrpersonen im Fach Musik (mit zwei Unterrichtsstunden in der Woche) in unruhigen Schulklassen ein besseres Arbeits- und Lernklima schaffen können. Für die Autorin stellte sich konkret die Frage, wie sie die Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler (SuS) gezielt fördern kann, um sowohl die Motivation als auch das Gemeinschaftsgefühl in der Klasse zu stärken. Zu Beginn dieser Ausarbeitung wird ein theoretischer Überblick über das soziale Lernen gegeben. Dabei wird speziell auf die Einbettung im Musikunterricht (hier: durch Klassenmusizieren) eingegangen. Zudem soll ein Bezug zu den Ausbildungsstandards und zum Bildungsplan hergestellt werden, um die Wichtigkeit für die SuS und für die Lehrpersonen zu verdeutlichen. Im weiteren Verlauf wird die praktische Umsetzung im Unterricht dargestellt. Es wird erläutert, welche Methoden und Maßnahmen in der Klasse eingesetzt wurden und zu welchen Beobachtungen und Erfolgen diese geführt haben. Der Schwerpunkt wird hierbei auf die Entwicklung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls der SuS gelegt. Des Weiteren werden die Ergebnisse der zwei Fragebögen, welche von den SuS ausgefüllt wurden, analysiert und auf die Leitfrage "Kann Klassenmusizieren die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl stärken?" bezogen.
Soziales Lernen ist im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen sehr bedeutsam und stellt eine Schlüsselqualifikation in der Berufswelt dar. Sozialkompetenz nimmt neben der Methoden-, Sach- und Selbstkompetenz eine wichtige Rolle ein, da diese Kompetenz einem Menschen ermöglicht, an der Gesellschaft teilzuhaben und mit anderen Menschen situationsangemessen umzugehen. Hierzu zählt die Aneignung sozialer Fertigkeiten und Verhaltensweisen, wie die Entwicklung von Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit, Empathie sowie Kooperations- und Konfliktfähigkeit. Darüber hinaus müssen jedoch auch soziale Einstellungen und Werthaltungen gebildet werden. Bezogen auf die Schule müssen die SuS die Fähigkeit zur Aufnahme einer Schüler-Lehrer-Beziehung, zur Einordnung in die Klassengemeinschaft und die Übernahme einer Rolle als Schüler sowie die Anerkennung von Regeln und Normen und die damit verbundene Zurückstellung eigener Interessen erwerben.
Inhaltsverzeichnis
- Themenbegründung
- Theoretischer Überblick
- Soziales Lernen
- Soziales Lernen im Musikunterricht
- Verankerung des sozialen Lernens durch Klassenmusizieren im Bildungsplan 2016 und in den Ausbildungsstandards
- Umsetzung im eigenen Unterricht
- Überblick über den Verlauf
- Vorüberlegungen und Planung
- Durchführung und Beobachtungen im Musikunterricht
- Zusammenfassende Ergebnisse der Durchführung
- Reflexion
- Schlussfolgerungen
- Kritik
- Persönliches Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Klassenmusizieren im Musikunterricht die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl von Schülerinnen und Schülern (SuS) stärken kann. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Umsetzung des sozialen Lernens in einer Keyboardklasse an der XXXX Schule.
- Theoretische Einordnung des sozialen Lernens im Bildungskontext
- Analyse der Rolle von Klassenmusizieren im Musikunterricht zur Förderung sozialer Kompetenzen
- Praxisnahe Beschreibung der Umsetzung von Klassenmusizieren in einer Keyboardklasse
- Bewertung der Auswirkungen von Klassenmusizieren auf Motivation und Gemeinschaftsgefühl der SuS
- Reflexion der Ergebnisse und Ableitung von Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Thematik des sozialen Lernens im Musikunterricht mit dem Fokus auf Klassenmusizieren eingeführt. Der Autor beleuchtet die Motivation hinter der Untersuchung, die aus Beobachtungen in einer Keyboardklasse der XXXX Schule resultiert.
Das zweite Kapitel bietet einen theoretischen Überblick über das soziale Lernen. Es werden verschiedene Modelle und Theorien vorgestellt, mit Schwerpunkt auf dem Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz. Zudem wird die Bedeutung des sozialen Lernens im Bildungsplan 2016 und in den Ausbildungsstandards hervorgehoben.
Kapitel drei beschäftigt sich mit der praktischen Umsetzung des sozialen Lernens durch Klassenmusizieren im Musikunterricht. Es wird der Verlauf des Projekts, die Planung und die Durchführung in der Keyboardklasse detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Soziales Lernen, Klassenmusizieren, Motivation, Gemeinschaftsgefühl, Keyboardklasse, Bildungsplan 2016, Ausbildungsstandards, SuS, Musik, Unterricht, Empathie, Kooperation, Konfliktfähigkeit, Selbstmanagement, Gruppenarbeit, Selbstregulierung.
Häufig gestellte Fragen
Kann Klassenmusizieren das Gemeinschaftsgefühl in der Schule stärken?
Ja, die Arbeit zeigt durch praktische Beobachtungen in einer Keyboardklasse, dass gemeinsames Musizieren soziale Kompetenzen fördert und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schüler verbessert.
Welche sozialen Fertigkeiten werden im Musikunterricht gelernt?
Schüler entwickeln Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Kooperationsbereitschaft sowie Konfliktfähigkeit durch die Interaktion beim Musizieren.
Wie ist soziales Lernen im Bildungsplan verankert?
Der Bildungsplan 2016 und die Ausbildungsstandards betonen Sozialkompetenz als Schlüsselqualifikation, die neben Sach- und Methodenkompetenz zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigt.
Warum ist soziales Lernen für unruhige Klassen wichtig?
Es hilft, ein besseres Arbeits- und Lernklima zu schaffen, da Schüler lernen, eigene Interessen zurückzustellen und Regeln innerhalb der Klassengemeinschaft anzuerkennen.
Was wurde in der Keyboardklasse konkret beobachtet?
Die Analyse von Fragebögen und Beobachtungen ergab eine Steigerung der Motivation und eine positive Veränderung der Rollenübernahme innerhalb der Schülergruppe.
- Citar trabajo
- Ramona Frommknecht (Autor), 2019, Soziales Lernen im Musikunterricht der Klassenstufe 5. Kann Klassenmusizieren die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl stärken?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506064