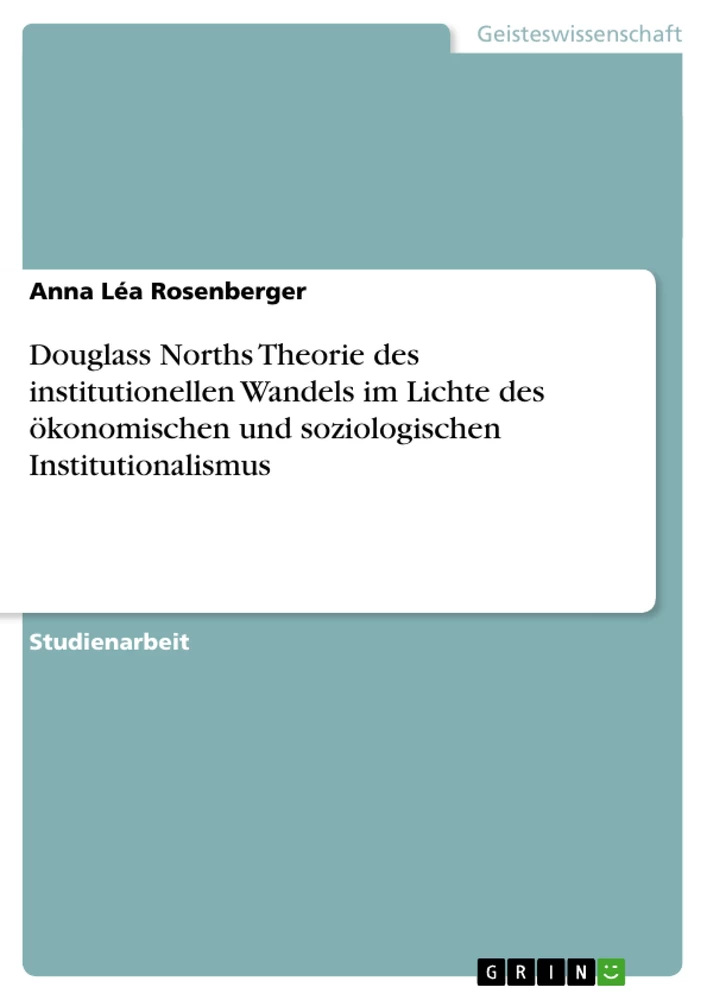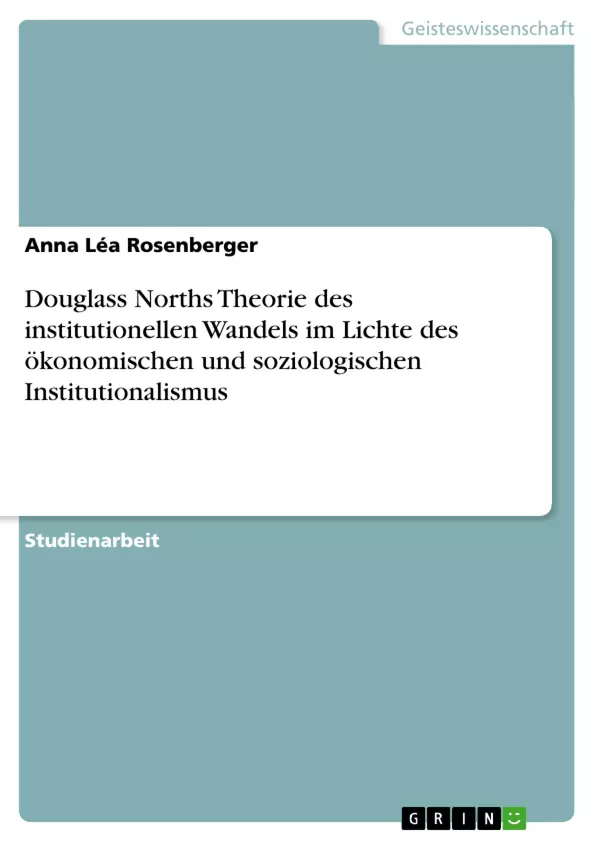Der Wahlspruch „Institutions matter!“ ist in vielen Arbeiten der Neuen Institutionenökonomik zu lesen, dennoch sind die Definitionen des Begriffs ebenso unterschiedlich wie die Erklärungsansätze zu ihrer Entstehung, ihrer Stabilität oder ihrem Wandel. Es gibt evolutionäre, spieltheoretische und vertragstheoretische Entstehungstheorien; Ansätze, die ausschließlich Rational-choice-Modelle verwenden und solche, die den sozialen Kontext der Akteure stärker einbeziehen. Da sich darüber hinaus nicht nur Ökonomen mit Institutionen und ihrer Bedeutung für das menschliche Zusammenleben befassen, sondern insbesondere auch Anthropologen und Soziologen, existieren heute zahlreiche Theorien, die aus verschiedenen Blickwinkeln heraus versuchen, befriedigende Antworten auf die Fragen der Entwicklung und Wirkung von Institutionen einerseits sowie ihrer Stabilität und ihres Wandels andererseits zu finden. Selten nur arbeiten die Wissenschaftler der unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam an den geteilten Fragestellungen; so wird oftmals festgestellt, dass beispielsweise „das Verhältnis zwischen Soziologie und Ökonomie durch Brüche und Ambivalenzen, gewollte und ungewollte Missverständnisse sowie durch die wechselseitige Unkenntnis der theoretisch-empirischen Vorhaben belastet ist“ .
Die vorliegende Arbeit möchte Douglass Norths Verständnis von Institutionen und von institutionellem Wandel darlegen und wird hierfür zunächst einige für seinen Ansatz wesentliche Grundlagen ökonomischer Modelle erläutern. Dabei wird ebenfalls versucht, mögliche Einflüsse soziologischen Gedankenguts zu thematisieren. Abschließend soll untersucht werden, ob Norths Theorie des institu-tionellen Wandels als Bindeglied zwischen soziologischen und ökonomischen Institutionentheorien fungieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Homo oeconomicus, homo sociologicus und das North'sche Individuum
- Das Konzept des homo oeconomicus
- Erweiterungen des ökonomischen Modells
- Das soziologische Modell
- Das North'sche Individuum
- Norths Verständnis von Institutionen und Organisationen
- Informelle und formelle Institutionen
- Organisationen
- Douglass Norths Theorie des institutionellen Wandels
- Brückenbau zwischen ökonomischem und soziologischem Institutionalismus?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Douglass Norths Theorie des institutionellen Wandels und analysiert, wie sein Verständnis von Institutionen und institutionellem Wandel im Lichte des ökonomischen und soziologischen Institutionalismus steht.
- Das North'sche Individuum als Ausgangspunkt für eine Institutionentheorie
- Die Rolle von Institutionen bei der Reduzierung von Unsicherheit und der Förderung von Kooperation
- Die Bedeutung von kulturellem Erbe und Ideologien für den Entscheidungsfindungsprozess
- Die Analyse der Beziehung zwischen formalen und informellen Institutionen
- Die Möglichkeit einer Brücke zwischen ökonomischem und soziologischem Institutionalismus durch Norths Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt Douglass Norths Arbeit im Kontext des Aufschwungs in der Beschäftigung mit Institutionen dar und unterstreicht die Relevanz seiner Beiträge zur Institutionentheorie. Sie erläutert außerdem die Vielfalt der Perspektiven auf Institutionen und ihren Wandel und betont die Notwendigkeit einer interdisziplinären Betrachtungsweise.
- Homo oeconomicus, homo sociologicus und das North'sche Individuum: Dieses Kapitel stellt zunächst die Grundannahmen des homo oeconomicus-Modells dar, einschließlich methodologischen Individualismus, vollständiger Information und Rationalität. Es werden dann Erweiterungen des ökonomischen Modells diskutiert und das soziologische Handlungskonzept vorgestellt. Schließlich wird das North'sche Individuum als ein Konzept eingeführt, das Elemente beider Ansätze integriert.
- Norths Verständnis von Institutionen und Organisationen: Dieses Kapitel beleuchtet Norths Definition von Institutionen als „Schöpfungen von Menschen“ und unterscheidet zwischen informellen und formalen Institutionen. Es werden verschiedene Arten von Organisationen diskutiert, die als Träger institutioneller Strukturen fungieren.
- Douglass Norths Theorie des institutionellen Wandels: Dieses Kapitel stellt Norths Theorie des institutionellen Wandels dar, die auf der Annahme basiert, dass Institutionen sich durch Einwirkung von Menschen verändern. Es werden die Faktoren diskutiert, die den Wandel beeinflussen, wie beispielsweise technologischer Fortschritt, politischer Wandel und kulturelle Entwicklungen.
- Brückenbau zwischen ökonomischem und soziologischem Institutionalismus?: Dieses Kapitel untersucht, ob Norths Theorie des institutionellen Wandels als Bindeglied zwischen ökonomischem und soziologischem Institutionalismus dienen kann. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze analysiert und die Frage untersucht, ob eine Integration möglich ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Institutionentheorie, institutioneller Wandel, homo oeconomicus, homo sociologicus, Douglass North, Neue Institutionenökonomik, Wirtschaftsgeschichte, soziologischer Institutionalismus und interdisziplinäre Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Aussage von Douglass North zum institutionellen Wandel?
North argumentiert, dass Institutionen menschengemachte Strukturen sind, die Unsicherheit reduzieren und Kooperation ermöglichen. Wandel entsteht durch das Handeln von Individuen und Organisationen.
Was unterscheidet den "homo oeconomicus" vom "homo sociologicus"?
Der homo oeconomicus handelt rational und eigennützig unter vollständiger Information, während der homo sociologicus durch soziale Rollen und Normen gesteuert wird.
Was versteht North unter informellen Institutionen?
Informelle Institutionen sind ungeschriebene Regeln wie Traditionen, Bräuche, Sitten und Ideologien, die das menschliche Verhalten oft stärker prägen als formale Gesetze.
Kann Norths Theorie eine Brücke zwischen Ökonomie und Soziologie schlagen?
Die Arbeit untersucht, ob North durch die Integration von Ideologien und kulturellem Erbe in ökonomische Modelle eine Verbindung zum soziologischen Institutionalismus herstellt.
Welche Rolle spielen Organisationen im institutionellen Rahmen?
Organisationen (wie Firmen oder politische Parteien) sind laut North die Akteure, die innerhalb des durch Institutionen (die "Spielregeln") gesetzten Rahmens agieren und diesen durch ihr Handeln verändern.
- Quote paper
- Anna Léa Rosenberger (Author), 2006, Douglass Norths Theorie des institutionellen Wandels im Lichte des ökonomischen und soziologischen Institutionalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50663