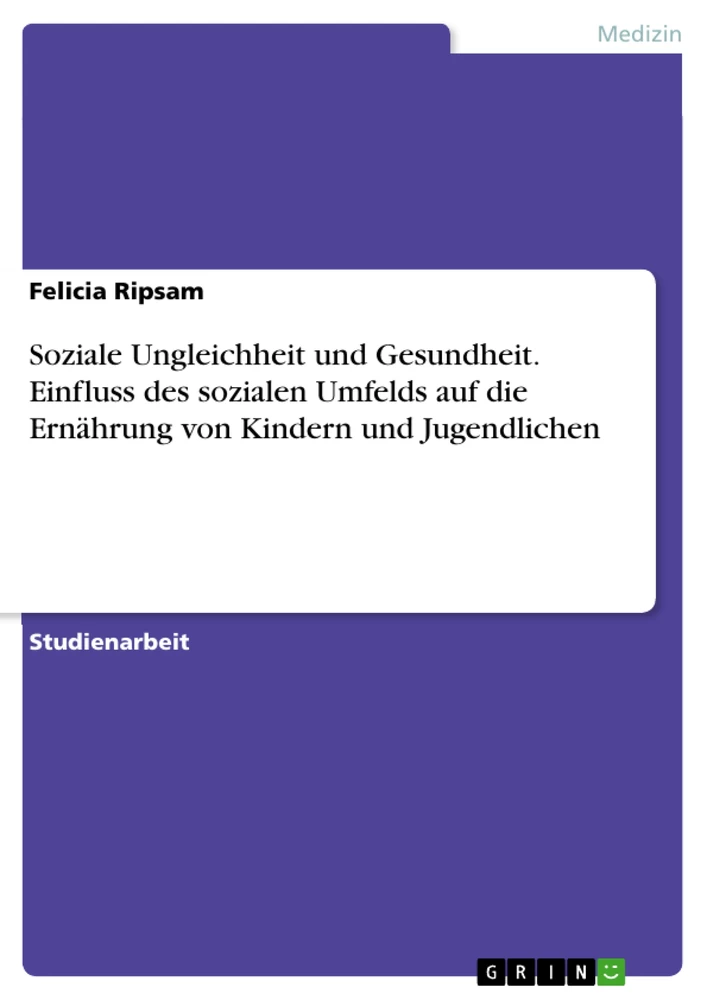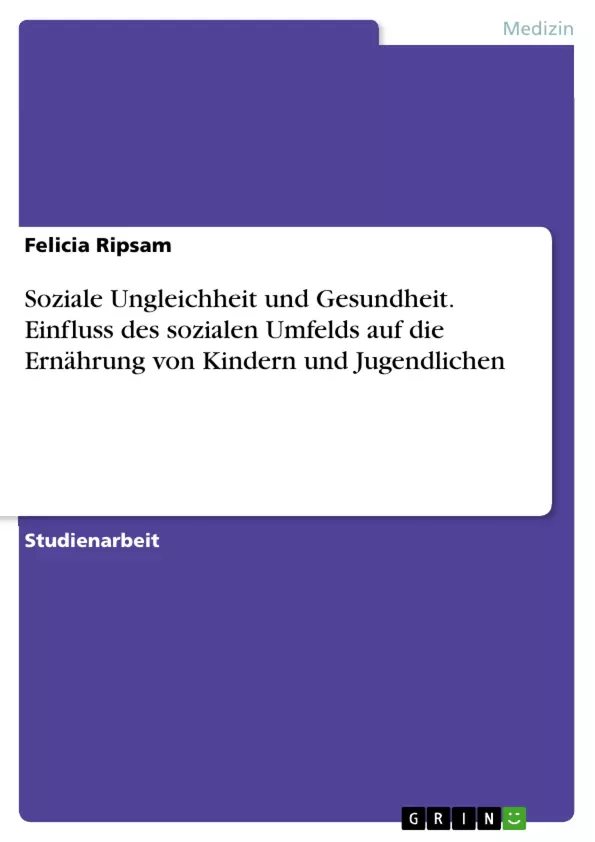Diese Seminararbeit behandelt die Frage, inwiefern sich die soziale Lage von Kindern und Jugendlichen auf deren Ernährung auswirkt und ob die Ernährung von Kindern und Jugendlichen nach sozialer Schicht unterschiedlich stark von einer gesundheitsförderlichen Ernährungsweise abweicht. Des Weiteren sollen hierfür Erklärungsansätze gefunden sowie abschließend Maßnahmen der Prävention aufgezeigt werden. Die aktuelle "Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland" (KiGGS), die im Rahmen des Gesundheitsmonitorings vom Robert Koch-Institut durchgeführt wird, legt hier einen Grundstein für eine solide Datenbasis.
"Kinder und Jugendliche benötigen für ihre körperliche und geistige Entwicklung, ihre Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sowie für die Stärkung ihrer Immunabwehr eine optimale Versorgung mit allen Nährstoffen. Eine ausgewogene Ernährung ist in der Wachstumsphase von besonderer Bedeutung." Ungünstige Ernährungsgewohnheiten stehen in einem engen Zusammenhang mit Erkrankungen wie Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Adipositas sowie vereinzelten Krebsarten.
Deshalb ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung, die bereits im Kindesalter ansetzt, von großer Bedeutung und zählt als beste Voraussetzung dafür, um die Förderung und die Erhaltung der physischen und der psychischen Gesundheit zu gewährleisten. Das im Laufe der Kindheit entwickelte Ernährungsverhalten wird oft im Erwachsenenalter beibehalten und beeinflusst damit die Gesundheit und das Wohlbefinden im späteren Alter. Daher sollte die Elternkompetenz in Ernährungsfragen von Anfang an gestärkt werden.
Aufgrund der mit den ernährungsabhängigen Krankheiten verbundenen steigenden Kosten im Gesundheitswesen sowie der starken gesundheitlichen Unterschiede entlang des sozialen Gradienten könnte die Prävention eine wichtige und bedeutsame Aufgabe darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale und gesundheitliche Ungleichheit
- Soziale Ungleichheit und sozioökonomischer Status
- Gesundheitliche Ungleichheit
- Erklärung von gesundheitlicher Ungleichheit
- Gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen
- Bedeutung
- Aktuelle Datenlage
- Allgemeiner Gesundheitszustand
- Ernährungsverhalten
- Definition
- Soziale Ungleichheit und Ernährung bei Kindern und Jugendlichen
- Erklärung sozialer Ungleichheit im Ernährungsverhalten
- Prävention
- Definitionen
- Mögliche präventive Maßnahmen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit dem Einfluss des sozialen Umfelds auf das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und gesundheitlicher Ungleichheit und beleuchtet die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
- Soziale Ungleichheit und Ernährungsverhalten
- Gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen
- Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten
- Präventionsmaßnahmen zur Verbesserung des Ernährungsverhaltens
- Bedeutung einer gesunden Ernährung für die Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Ungleichheit und Gesundheit sowie der Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für Kinder und Jugendliche ein. Kapitel 2 beleuchtet die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit, sozioökonomischem Status und gesundheitlicher Ungleichheit. Kapitel 3 fokussiert auf die gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen, die aktuelle Datenlage und den allgemeinen Gesundheitszustand. Kapitel 4 untersucht das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen und erklärt die sozialen Ungleichheiten im Ernährungsverhalten. Kapitel 5 beschäftigt sich mit Präventionsmaßnahmen, die zur Verbesserung des Ernährungsverhaltens beitragen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern soziale Ungleichheit, Gesundheit, Ernährung, Kinder und Jugendliche, Prävention, sozioökonomischer Status, Gesundheitszustand, Ernährungsverhalten, Gesundheitsmonitoring, KiGGS-Studie.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen soziale Lage und Ernährung bei Kindern zusammen?
Studien zeigen, dass Kinder aus niedrigeren sozialen Schichten häufiger von einer gesundheitsförderlichen Ernährungsweise abweichen, was langfristig gesundheitliche Risiken birgt.
Was ist die KiGGS-Studie?
Die „Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS) des Robert Koch-Instituts liefert die Datenbasis für die Analyse gesundheitlicher Ungleichheiten.
Welche Krankheiten werden durch schlechte Ernährung begünstigt?
Ungünstige Ernährungsgewohnheiten stehen in engem Zusammenhang mit Adipositas, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebsarten.
Warum ist die Elternkompetenz in Ernährungsfragen so wichtig?
Das im Kindesalter entwickelte Ernährungsverhalten wird oft bis ins Erwachsenenalter beibehalten. Eltern legen somit den Grundstein für die lebenslange Gesundheit ihrer Kinder.
Was kann Prävention im Bereich Kinderernährung leisten?
Präventive Maßnahmen können gesundheitliche Unterschiede entlang des sozialen Gradienten verringern und langfristig Kosten im Gesundheitswesen einsparen.
- Quote paper
- Felicia Ripsam (Author), 2016, Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Einfluss des sozialen Umfelds auf die Ernährung von Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506708