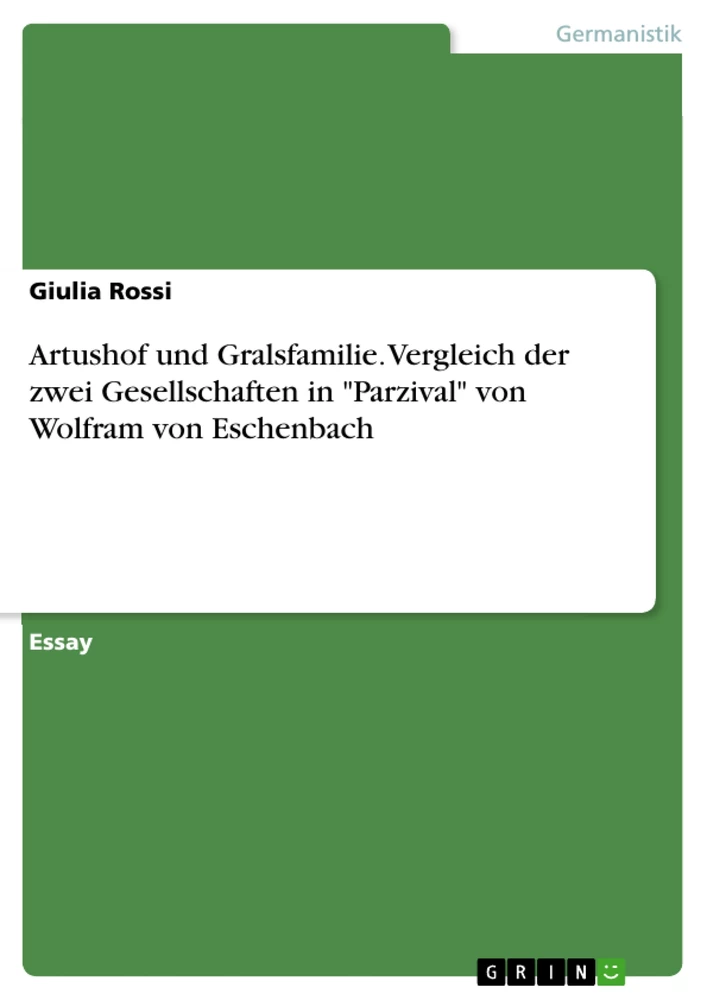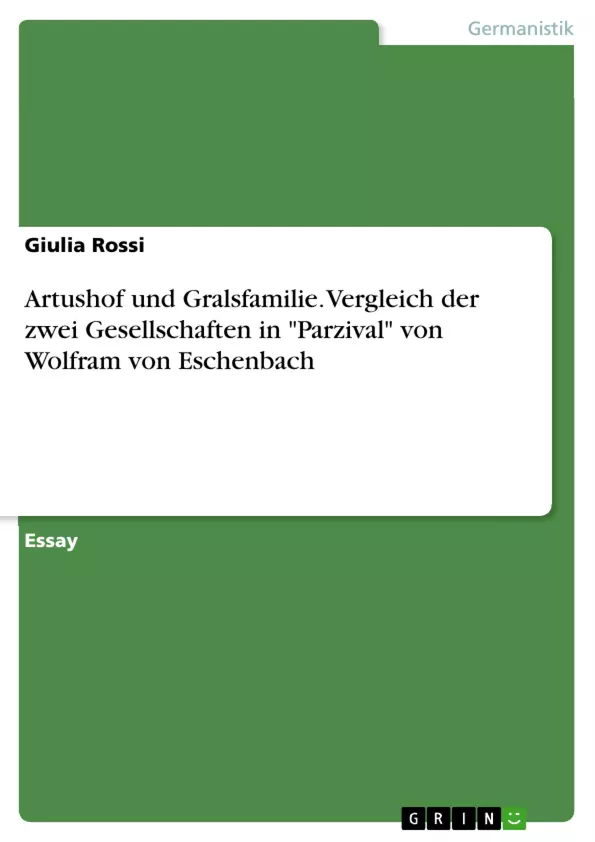Inwiefern sich die Gruppierungen, der Artushof und die Gralsfamilie, in Wolframs von Eschenbach "Parzival" unterscheiden oder Ähnlichkeiten aufweisen und welche Rolle dabei der Protagonist Parzival einnimmt, soll in dieser Arbeit anhand der Aspekte der Erbfolge und der Gemeinschaftszugehörigkeit, der Geographie, der Gemeinschaftszentren und Gemeinschaftsaufgaben sowie der minne und der triuwe untersucht werden.
Nicht selten werden die beiden Gruppierungen in Kontrast zueinander gestellt, wobei jedoch zum Teil sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen werden. So werden besonders vor 1950 vermehrt Vergleiche gezogen, in denen die beiden Gesellschaften in Bezug auf die Stellung innerhalb der hierarchischen Ordnung unterschiedlich bewertet werden. Danach lassen sich weniger wertende, hierarchisch orientierte Sichtweisen sichten, das Konzept der Opposition der beiden Gesellschaftsmodelle und deren vermeintliche Unvereinbarkeit bleibt jedoch Gegenstand der mediävalen Forschung.
Inhaltsverzeichnis
- Verwandtschaft und Herrschaftslegitimation durch Familienzugehörigkeit
- Artus und die Tafelrunde
- Anfortas und die Gralsgesellschaft
- Parzivals doppelte Herkunft
- Geographie
- Artus' Ländereien
- Anfortas' Gralsreich
- Parzivals Reisen
- Gemeinschaftszentren und Aufgaben
- Der Artushof
- Der Gralshof
- Parzivals Streben nach beiden Zentren
- Minne und Triuwe
- Die Artusritter und die Minne
- Die Gralsgesellschaft und die Minne
- Parzivals Suche nach Minne und Treue
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die beiden Gesellschaften im Wolfram von Eschenbachs «Parzival», den Artushof und die Gralsfamilie, und analysiert ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Der Schwerpunkt liegt auf der Erforschung der Aspekte der Erbfolge, der Geographie, der Gemeinschaftszentren und Aufgaben sowie der Minne und der Triuwe in beiden Gesellschaften.
- Vergleich der Herrschaftsstrukturen und der Rolle der Erbfolge in beiden Gesellschaften
- Analyse der geographischen Unterschiede und der Mobilität der beiden Gesellschaften
- Untersuchung der Gemeinschaftszentren und Aufgaben von Artus' Hof und Anfortas' Gralsburg
- Bewertung der unterschiedlichen Konzeptionen der Minne und der Triuwe in beiden Gesellschaften
- Analyse der Rolle Parzivals als Verbindungsglied zwischen den beiden Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Verwandtschaft und Herrschaftslegitimation in beiden Gesellschaften. Der Artushof wird als zeitlos dargestellt, während die Gralsgesellschaft auf den genetisch vorbestimmten Erben und Erlöser wartet. Parzival vereint durch sein Erbe beide Welten, gehört er doch zu den Artusrittern und zur Gralssippe.
Das zweite Kapitel untersucht die geographischen Unterschiede zwischen den beiden Gesellschaften. Artus' Hof ist mobil, während Anfortas' Reich Terre Salvaesche, um dessen Burg herum sich keine Anzeichen menschlichen Lebens befinden, als mystisch und nicht wirklichkeitsnah dargestellt wird. Parzival scheint als physischer Berührungspunkt beider Reiche zu existieren.
Im dritten Kapitel werden die Gemeinschaftszentren und Aufgaben der beiden Gesellschaften analysiert. Artus steht im Zentrum der Artusgesellschaft, während der Gral selbst die zentrale Instanz am Gralshof ist. Parzival strebt nach beiden Zentren und erringt schlussendlich das Rittertum der Tafelrunde sowie den Gral und somit das Gralskönigtum.
Das vierte Kapitel widmet sich der Minne und der Triuwe in beiden Gesellschaften. Die Artusritter betrachten die Minne als Motivation zur Ritterlichkeit, während sie für die Gralsgesellschaft verboten ist. Parzival vereint die unterschiedlichen Auffassungen von Triuwe mit dem arturschen Minnedienst.
Schlüsselwörter
Artushof, Gralsfamilie, Wolfram von Eschenbach, Parzival, Erbfolge, Geographie, Gemeinschaftszentren, Aufgaben, Minne, Triuwe, Rittertum, Gral, Gralskönig, Gesellschaftsstrukturen, Vergleich, Unterschied, Gemeinsamkeit
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich der Artushof und die Gralsfamilie in „Parzival“?
Der Artushof repräsentiert das weltliche Rittertum und die soziale Anerkennung, während die Gralsfamilie eine sakrale, religiös-mystische Gemeinschaft mit strengeren Regeln darstellt.
Welche Rolle spielt Parzival in Bezug auf beide Gesellschaften?
Parzival ist das Bindeglied: Durch seine Abstammung gehört er beiden Welten an und muss lernen, die ritterlichen Tugenden des Artushofes mit der spirituellen Tiefe des Grals zu vereinen.
Was bedeutet „Triuwe“ im Kontext des Romans?
Triuwe steht für Treue, Beständigkeit und Aufrichtigkeit – Werte, die sowohl für den Ritterdienst als auch für die Nachfolge als Gralskönig essenziell sind.
Dürfen Gralsritter die „Minne“ (Liebe) ausleben?
Im Gegensatz zu den Artusrittern ist der Gralsgemeinschaft die Minne weitgehend untersagt; nur der Gralskönig darf unter bestimmten Bedingungen eine Ehe führen.
Was ist das Besondere an der Geographie des Gralsreichs?
Das Gralsreich „Terre Salvaesche“ ist ein verborgener, mystischer Ort, der nur von Berufenen gefunden werden kann, während der Artushof eher als mobiler Mittelpunkt der bekannten Welt fungiert.
- Quote paper
- Giulia Rossi (Author), 2017, Artushof und Gralsfamilie. Vergleich der zwei Gesellschaften in "Parzival" von Wolfram von Eschenbach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506946