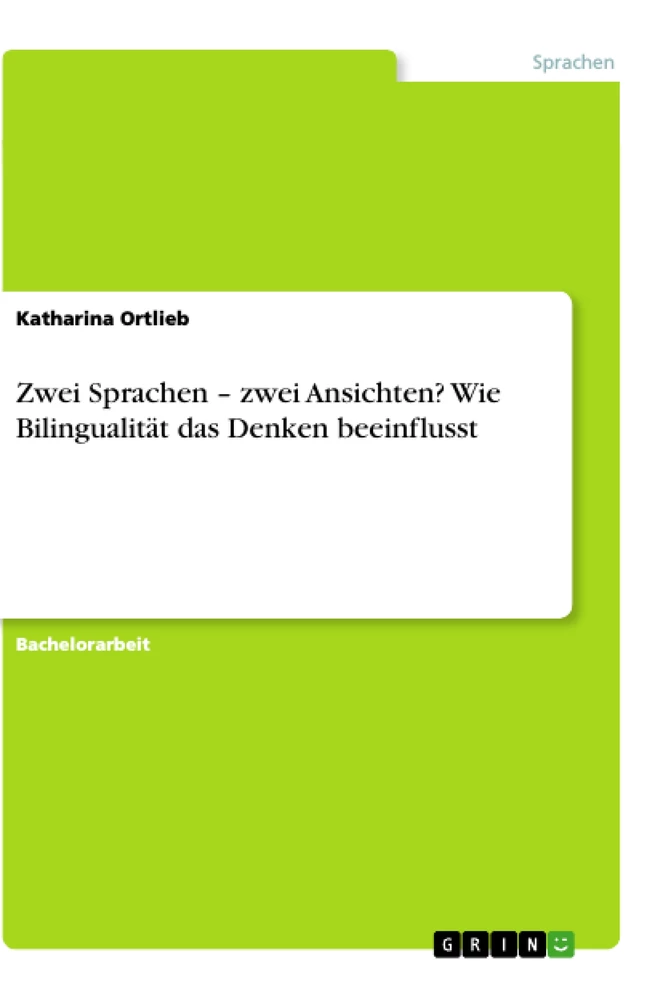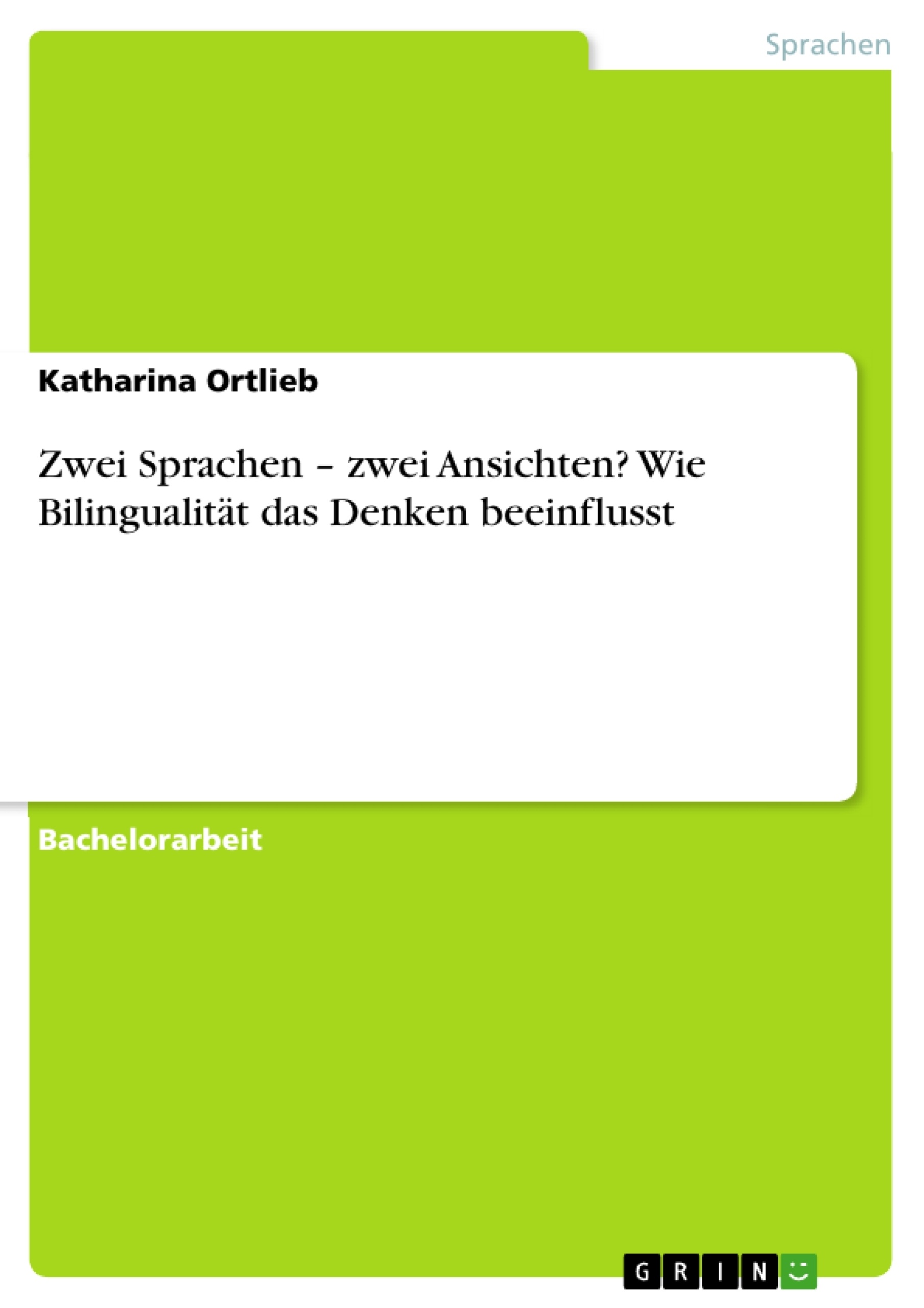Sprache schafft nicht Realität, sondern geht von den universellen Erfahrungen der Menschen aus und formuliert Realität sowohl ideell als auch materiell auf einzelsprachlich eigene Weise. Dass die über Jahrhunderte hinweg entstandenen Begriffe und Strukturen sich dabei von Sprache zu Sprache unterscheiden, führt zu einer einzelsprachlich spezifischen Weltansicht. Die Idee der einzelsprachlichen Weltansicht wird auf Wilhelm von Humboldt zurückgeführt, dessen sprachphilosophisches Denken gerade im Kontext neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wiederentdeckt wird. Man spricht von einer „Humboldt-Renaissance“ in den letzten zehn Jahren, was Anlass dazu gibt, das Prinzip der sprachlichen Relativität neu zu überdenken. In der vorliegenden Arbeit soll eine sprachphilosophische Neubetrachtung angestellt werden, auf das, was vor dem Hintergrund des Chomsky’schen Universalismus für absurd erklärt wurde, nämlich, dass einzelsprachliche Strukturen in direkter Weise auf Denkprozesse des Menschen Einfluss nehmen. Hierzu soll insbesondere die Betrachtung der Zweisprachigkeit unter sprachphilosophischen Gesichtspunkten neue Erkenntnisse beitragen. Wenn es stimmt, dass wir die Welt stets durch die strukturierende Brille einer Muttersprache wahrnehmen, was passiert dann, wenn ein Mensch zwei Muttersprachen hat? Denkt eine bilinguale Person in ihren jeweiligen Sprachen auf unterschiedliche Art und Weise und wechselt mit der Sprache ihre Weltansicht gleich mit? Aktuelle Erkenntnisse aus der Bilingualismusforschung können die Debatte um die sprachliche Relativitätstheorie erneut anregen, jahrhundertealtes Sprachdenken in ein neues Licht rücken und darüber hinaus die Zweisprachigkeit als individuellen und gesellschaftlichen Gewinn herausstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Verhältnis von Sprache und Denken
- 2.1 Sapir, Whorf und die Sprachdeterminiertheit
- 2.2 Zurück ins 18. Jahrhundert: Humboldts Blick auf Sprache
- 2.3 Eine Neubewertung der Relativitätstheorie
- 3. Bilinguales Weltbild. Zwei Sprachen – zwei Identitäten
- 3.1 „Double thinking“. Die bilinguale Leistung
- 3.2 Weltansichten als Übersetzungsproblem
- 3.3 Emotion, Verhalten und kulturelle Zugehörigkeit
- 4. Mehrsprachigkeit als individueller und gesellschaftlicher Gewinn
- 4.1 Stolperstein Mehrsprachigkeit
- 4.2 Fremdverstehen: Bilingualität als Vermittlerin
- 5. Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Bilingualität auf das Denken. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Beziehung zwischen Sprache und Denken zu beleuchten und die Auswirkungen von Mehrsprachigkeit auf Weltansichten, Identität und interkulturelles Verständnis zu analysieren. Die Arbeit greift dabei auf sprachphilosophische Konzepte zurück und bezieht aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit ein.
- Der Zusammenhang zwischen Sprache und Denken
- Die Sapir-Whorf-Hypothese und ihre Relevanz für die Bilingualitätsforschung
- Die Rolle der Bilingualität in der Gestaltung von Weltansichten und Identitäten
- Mehrsprachigkeit als Ressource im interkulturellen Kontext
- Der Einfluss einzelsprachlicher Strukturen auf Denkprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Beziehung zwischen Sprache und Denken ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss von Bilingualität auf Denkprozesse. Sie hebt die Bedeutung der Muttersprache für die kognitive Entwicklung hervor und skizziert den historischen Kontext der Debatte um die sprachliche Relativitätstheorie, beginnend von Plato bis hin zu aktuellen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Autorin unterstreicht die Bedeutung des Bilingualismus als Forschungsfeld, um die sprachliche Relativitätstheorie neu zu beleuchten.
2. Zum Verhältnis von Sprache und Denken: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplexen Interaktion zwischen Sprache und Denken. Es analysiert die Sapir-Whorf-Hypothese in ihrer radikalen und moderaten Interpretation, beleuchtet Humboldts sprachphilosophische Ansätze und diskutiert aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse, die die Universalität kognitiver Prozesse betonen. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit einzelsprachliche Strukturen Denkprozesse beeinflussen und wie diese Frage im Kontext der Bilingualitätsforschung relevant wird.
3. Bilinguales Weltbild. Zwei Sprachen – zwei Identitäten: Dieses Kapitel erörtert die Auswirkungen von Bilingualität auf die Weltansicht und die Identität des Individuums. Es untersucht das Konzept des „Double Thinking“, die Herausforderungen der Übersetzung zwischen verschiedenen Weltansichten und den Einfluss der Bilingualität auf Emotionen, Verhalten und kulturelle Zugehörigkeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung, wie zwei Sprachen zwei verschiedene Perspektiven auf die Welt ermöglichen und wie diese Perspektiven in der Erfahrung einer bilingualen Person koexistieren.
4. Mehrsprachigkeit als individueller und gesellschaftlicher Gewinn: Dieses Kapitel befasst sich mit den positiven Aspekten der Mehrsprachigkeit. Es behandelt zunächst mögliche Herausforderungen im Umgang mit Mehrsprachigkeit und konzentriert sich dann auf die Rolle der Bilingualität als Brücke im interkulturellen Dialog und als Ressource für ein vertieftes Verständnis anderer Kulturen und Perspektiven. Der Kapitel vertritt die These, dass Mehrsprachigkeit einen bedeutenden individuellen und gesellschaftlichen Gewinn darstellt.
Schlüsselwörter
Bilingualität, Sprache, Denken, Sprachliche Relativität, Sapir-Whorf-Hypothese, Humboldt, Weltansicht, Identität, Interkulturelle Kommunikation, Mehrsprachigkeit, Kognitive Prozesse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Der Einfluss von Bilingualität auf das Denken
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Bilingualität auf das Denken. Sie beleuchtet die Beziehung zwischen Sprache und Denken und analysiert die Auswirkungen von Mehrsprachigkeit auf Weltansichten, Identität und interkulturelles Verständnis. Dabei werden sprachphilosophische Konzepte und aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse einbezogen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken, die Sapir-Whorf-Hypothese und ihre Relevanz für die Bilingualitätsforschung, die Rolle der Bilingualität in der Gestaltung von Weltansichten und Identitäten, Mehrsprachigkeit als Ressource im interkulturellen Kontext und den Einfluss einzelsprachlicher Strukturen auf Denkprozesse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Verhältnis von Sprache und Denken (inkl. Sapir-Whorf-Hypothese und Humboldts Ansatz), ein Kapitel zum bilingualen Weltbild und den damit verbundenen Identitäten, ein Kapitel über Mehrsprachigkeit als individuellen und gesellschaftlichen Gewinn und abschließend eine Zusammenfassung.
Wie wird die Sapir-Whorf-Hypothese behandelt?
Die Arbeit analysiert die Sapir-Whorf-Hypothese in ihren radikalen und moderaten Interpretationen und diskutiert ihre Relevanz im Kontext der Bilingualitätsforschung und aktueller neurowissenschaftlicher Erkenntnisse.
Welche Rolle spielt Humboldt in der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet Humboldts sprachphilosophische Ansätze und setzt sie in Beziehung zu den aktuellen Diskussionen über den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken und die Auswirkungen von Bilingualität.
Wie wird der Einfluss von Bilingualität auf die Identität dargestellt?
Die Arbeit erörtert die Auswirkungen von Bilingualität auf die Weltansicht und die Identität des Individuums, untersucht das Konzept des „Double Thinking“ und den Einfluss der Bilingualität auf Emotionen, Verhalten und kulturelle Zugehörigkeit.
Welche Vorteile der Mehrsprachigkeit werden hervorgehoben?
Die Arbeit betont die positiven Aspekte der Mehrsprachigkeit, insbesondere ihre Rolle als Brücke im interkulturellen Dialog und als Ressource für ein vertieftes Verständnis anderer Kulturen und Perspektiven.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Bilingualität, Sprache, Denken, Sprachliche Relativität, Sapir-Whorf-Hypothese, Humboldt, Weltansicht, Identität, Interkulturelle Kommunikation, Mehrsprachigkeit, Kognitive Prozesse.
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie beeinflusst Bilingualität Denkprozesse?
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit greift auf sprachphilosophische Konzepte und aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse zurück.
- Arbeit zitieren
- Katharina Ortlieb (Autor:in), 2016, Zwei Sprachen – zwei Ansichten? Wie Bilingualität das Denken beeinflusst, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507161