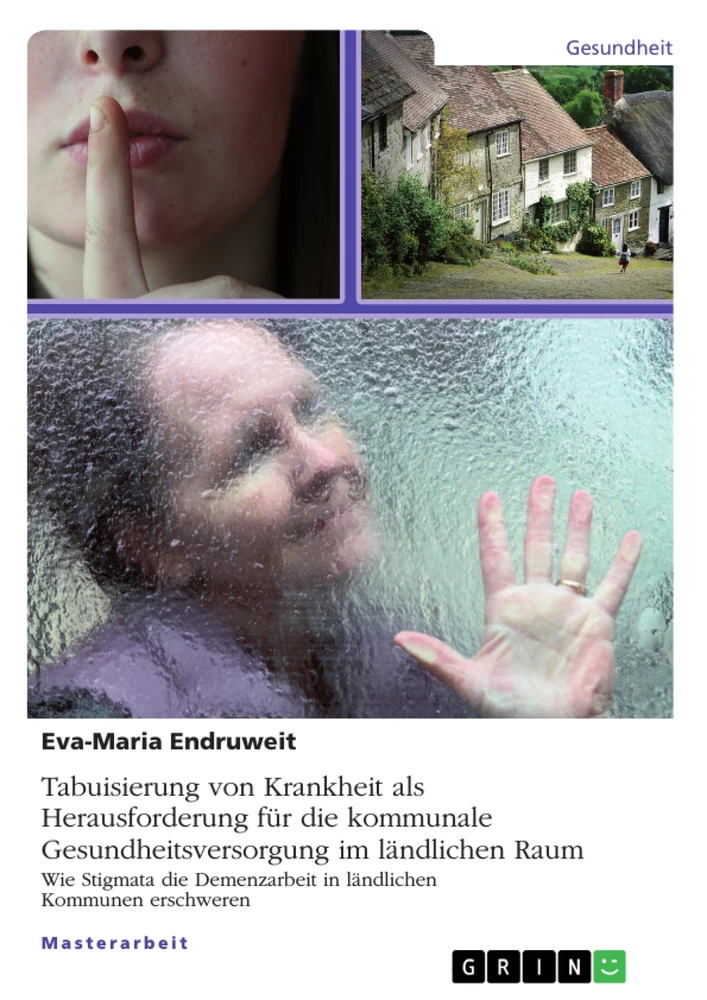Die Forschungsarbeit zeigt die Gründe für eine Tabuisierung bei dementiellen Veränderungen und den Prozess der Stigmatisierung mit all seinen Folgen und Auswirkungen auf die Situation von Menschen mit Demenz, innerhalb des häuslichen Versorgungssettings in der Kommune, auf. Dadurch können mögliche Wirkungsstellen identifiziert werden, an denen der Stigmatisierungsprozess von Menschen mit Demenz durch bestimmte Faktoren des Umfeldes verstärkt wird.
Die Thesis wird die konkreten Folgen, die mit den Stigmatisierungsprozessen für Kommunen verbunden sind, verdeutlichen, da durch die Betrachtung der Prozesse, Schnittstellen oder auch Wirkungsstellen und damit Stellschrauben, identifiziert werden, an denen steuernd Einfluss genommen werden kann. Nach der theoretischen Aufarbeitung der Grundlagen aus den Bezugswissenschaften, wird diese Forschungsarbeit aufzeigen, welche strategischen Maßnahmen innerhalb kommunaler Steuerung eingeleitet werden können und müssen, um eine frühzeitige Enttabuisierung und eine Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz, sowie eine Erhöhung der Motivation von Betroffenen und Angehörigen, zur Nutzung frühzeitiger Hilfen, zu bewirken.
Dadurch könnten Enttabuisierungsprozesse gezielt aktiviert werden, um eine gesellschaftliche Akzeptanzsteigerung bezogen auf tabuisierte Krankheitsbereiche zu erreichen. Anhand von Grafiken werden die Prozesse veranschaulicht. Des Weiteren liefern die Studienergebnisse gegebenenfalls Daten zu bereits vorliegenden Kennzahlen und Indikatoren zur Messbarkeit gesellschaftlicher Stigmatisierungssignale, die eine Veränderung gesellschaftlicher Akzeptanz abbilden können. Diese könnten als Grundlage der Planung weiterer strategischer Steuerungsprozesse Verwendung finden.
Zusammenfassend werden mögliche Strategien und Maßnahmen für Kommunen und Initiatoren kommunaler Projekte abgeleitet, um Enttabuisierungsprozesse frühzeitig in die Planung einzubeziehen und konstruktiv zu nutzen. Ergänzend werden Argumentationen für kommunale Akteure formuliert, die theoretisch fundierte, auf die kommunale Praxis übertragbare Handlungsoptionen, zur Planung kommunaler Demenzversorgung, im Sinne einer Minimierung von mit Stigmatisierung verbundenen Risiken, liefern. Da das Thema Demenz eines von vielen im Gesundheits- und Sozialbereich darstellt, die mit Tabuisierung und Stigmatisierung einhergehen, können die gewonnenen Informationen unter Umständen auch auf andere Bereiche des Pflege- und Gesundheitssektors übertragen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Demenzversorgung im Lebensumfeld Kommune
- Ländliche Räume im demographischen Wandel
- Kennzeichen und Strukturbesonderheiten ländlicher Räume
- Fehlende Strukturen verstärken den bestehenden Versorgungsnotstand
- Kommunen in der Pflicht zur Daseinsvorsorge
- Nachhaltigkeit im Kontext sozialen Wandels
- Tabuisierung und Stigmatisierung im Kontext dementieller Verläufe
- Tabuisierung und Stigmatisierung von Krankheiten als gesellschaftliches Phänomen
- Kennzeichen von Tabus
- Entstehung von Stigmata
- Merkmale eines Tabuisierungs- und Stigmatisierungsprozesses
- Zielsetzung und Fragestellung
- Stigmatisierungsprozesse haben gravierende Folgen
- Auswirkungen auf die Betroffenen
- Folgen des spillover-stigma auf die pflegenden Bezugspersonen
- Public stigma – Die Einstellungen der Gesellschaft zu Demenz
- Methodisches Vorgehen
- Systematische Literaturrecherche in den Bezugswissenschaften
- Review zur internationalen Studienlage von Stigmatisierungsvorgängen
- Datenextraktion
- Auswertung von Sekundärdaten zur aktuellen Versorgungssituation in der BRD
- Situation in Deutschland im Spiegel aktueller Studien
- Reporte liefern Sekundärdaten zum Versorgungsgeschehen
- Gesellschaftliche Auswirkungen aus ökonomischer Perspektive
- Auswirkungen auf die Kommunen
- Empfehlungen zum Umgang mit Stigmatisierung
- WHO- Positionspapier thematisiert Stigmatisierung im Alter
- Esslinger Aufruf an kommunale Akteure und die Gesellschaft
- Indikatoren und Messgrößen zur Abbildung wichtiger Kennzahlen im Zusammenhang mit Stigmatisierung
- Evidente Wissenschaft als Handlungsgrundlage professioneller Akteure
- Erfassung pflegeversorgungsrelevanter Merkmale zur Planung des Versorgungsprozesses
- Ergebnisse ergeben hohen Diskussionsbedarf
- Die Studienlage erfordert dringendes Handeln der Kreise und Kommunen, die umso dringlicher in den ländlichen Regionen des Landes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Tabuisierung von Demenz und die daraus resultierende Stigmatisierung im ländlichen Raum. Ziel ist es, die Herausforderungen der kommunalen Gesundheitsversorgung in diesem Kontext zu beleuchten und Handlungsempfehlungen zu entwickeln.
- Demenzversorgung in ländlichen Regionen
- Stigmatisierungsprozesse im Zusammenhang mit Demenz
- Auswirkungen der Stigmatisierung auf Betroffene und Angehörige
- Herausforderungen für die kommunale Gesundheitsversorgung
- Handlungsempfehlungen zur Entstigmatisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Demenzversorgung im Lebensumfeld Kommune: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik der Demenzversorgung, insbesondere im Kontext des ländlichen Raums. Es werden die besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen in diesen Gebieten beleuchtet, und die Notwendigkeit einer angepassten Versorgungsstruktur wird hervorgehoben. Die Bedeutung der Kommune als zentraler Akteur in der Daseinsvorsorge wird betont.
Ländliche Räume im demographischen Wandel: Der demographische Wandel stellt ländliche Regionen vor immense Herausforderungen, die in diesem Kapitel detailliert dargestellt werden. Es werden die spezifischen Kennzeichen ländlicher Räume, wie z.B. geringe Bevölkerungsdichte, Abwanderung junger Menschen und ein Mangel an Infrastruktur, analysiert. Diese Faktoren verschärfen den bestehenden Versorgungsnotstand, besonders im Hinblick auf die Demenzversorgung, und betonen die Notwendigkeit nachhaltiger Lösungen.
Tabuisierung und Stigmatisierung im Kontext dementieller Verläufe: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Phänomen der Tabuisierung und Stigmatisierung von Demenz. Es werden die gesellschaftlichen Ursachen und die Auswirkungen auf Betroffene und Angehörige analysiert. Das Kapitel beschreibt die Merkmale von Tabus und Stigmata und analysiert den Prozess der Stigmatisierung. Die eigene Forschungsfrage und Zielsetzung der Arbeit werden in diesem Kontext formuliert.
Stigmatisierungsprozesse haben gravierende Folgen: Hier werden die weitreichenden Folgen der Stigmatisierung von Demenz für Betroffene, Angehörige und die Gesellschaft als Ganzes untersucht. Die Auswirkungen auf das soziale Leben, die psychische Gesundheit, die Pflegebelastung und die gesellschaftliche Teilhabe werden analysiert. Der Begriff "spillover-stigma" wird erläutert und seine Relevanz für die Angehörigen hervorgehoben.
Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es werden die verwendeten Forschungsmethoden, wie systematische Literaturrecherche, Review internationaler Studien und Auswertung von Sekundärdaten, erläutert und begründet. Der Fokus liegt auf der Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses.
Situation in Deutschland im Spiegel aktueller Studien: Basierend auf aktuellen Studien und Daten werden die Situation der Demenzversorgung und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Stigmatisierung in Deutschland analysiert. Ökonomische Aspekte und die Folgen für die Kommunen werden ebenfalls beleuchtet, um ein umfassendes Bild der Problematik zu zeichnen.
Empfehlungen zum Umgang mit Stigmatisierung: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Empfehlungen zum Umgang mit der Stigmatisierung von Demenz. Es werden verschiedene Ansätze, wie z.B. die Positionierung der WHO und der "Esslinger Aufruf", diskutiert. Es werden Indikatoren zur Messung von Stigmatisierung vorgestellt und die Bedeutung evidenzbasierter Handlungsstrategien hervorgehoben.
Ergebnisse ergeben hohen Diskussionsbedarf: Das Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zeigt die Notwendigkeit weiterer Forschung und Diskussion auf. Die Ergebnisse unterstreichen die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Entstigmatisierung und Verbesserung der Demenzversorgung.
Die Studienlage erfordert dringendes Handeln der Kreise und Kommunen, die umso dringlicher in den ländlichen Regionen des Landes: In diesem Kapitel werden die Schlussfolgerungen der Studie prägnant zusammengefasst und die Notwendigkeit von raschem Handeln auf kommunaler Ebene im ländlichen Raum hervorgehoben. Die bisherigen Erkenntnisse werden nochmals verdichtet und die Notwendigkeit für nachhaltige Veränderungen wird bekräftigt.
Schlüsselwörter
Demenz, Stigmatisierung, Tabuisierung, ländlicher Raum, kommunale Gesundheitsversorgung, Demenzversorgung, Angehörige, gesellschaftliche Teilhabe, ökonomische Auswirkungen, Handlungsempfehlungen, Entstigmatisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Demenzversorgung im ländlichen Raum
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Tabuisierung und Stigmatisierung von Demenz im ländlichen Raum und die daraus resultierenden Herausforderungen für die kommunale Gesundheitsversorgung. Ziel ist es, Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Situation zu entwickeln.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Demenzversorgung im ländlichen Raum, darunter die spezifischen Herausforderungen ländlicher Regionen im demografischen Wandel, die Folgen der Stigmatisierung für Betroffene und Angehörige, die Rolle der Kommunen in der Daseinsvorsorge und die Entwicklung von Strategien zur Entstigmatisierung.
Welche Herausforderungen der Demenzversorgung im ländlichen Raum werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet Herausforderungen wie geringe Bevölkerungsdichte, Abwanderung junger Menschen, Mangel an Infrastruktur und die damit verbundenen Schwierigkeiten in der Versorgung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen. Die besondere Verantwortung der Kommunen in der Daseinsvorsorge wird hervorgehoben.
Wie werden Stigmatisierungsprozesse im Zusammenhang mit Demenz analysiert?
Die Arbeit analysiert die gesellschaftlichen Ursachen und Auswirkungen der Stigmatisierung von Demenz, beschreibt Merkmale von Tabus und Stigmata und untersucht den Prozess der Stigmatisierung selbst. Die Folgen für Betroffene (Auswirkungen auf das soziale Leben, psychische Gesundheit, etc.) und Angehörige (Spillover-Stigma) werden detailliert betrachtet.
Welche Methoden wurden in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturrecherche, einem Review internationaler Studien, der Auswertung von Sekundärdaten zur Versorgungssituation in Deutschland und der Datenextraktion aus relevanten Quellen. Die methodische Vorgehensweise wird transparent dargestellt.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die gravierenden Folgen der Stigmatisierung von Demenz auf und unterstreicht die Notwendigkeit dringenden Handelns auf kommunaler Ebene, insbesondere in ländlichen Regionen. Die Ergebnisse liefern einen hohen Diskussionsbedarf und heben die Notwendigkeit weiterer Forschung und nachhaltiger Veränderungen hervor.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit gibt konkrete Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der Stigmatisierung von Demenz, bezieht Positionierungen der WHO und den "Esslinger Aufruf" mit ein und stellt Indikatoren zur Messung von Stigmatisierung vor. Die Bedeutung evidenzbasierter Strategien wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielen die Kommunen?
Die Kommunen spielen eine zentrale Rolle in der Daseinsvorsorge und tragen eine besondere Verantwortung für die Demenzversorgung. Die Arbeit betont die Notwendigkeit kommunalen Handelns und die Entwicklung von angepassten Versorgungsstrukturen, insbesondere in ländlichen Regionen.
Welche ökonomischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die ökonomischen Auswirkungen der Demenz und der Stigmatisierung auf die Gesellschaft und die Kommunen, um ein umfassendes Bild der Problematik zu zeichnen.
Wo finde ich Schlüsselwörter zu dieser Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Demenz, Stigmatisierung, Tabuisierung, ländlicher Raum, kommunale Gesundheitsversorgung, Demenzversorgung, Angehörige, gesellschaftliche Teilhabe, ökonomische Auswirkungen, Handlungsempfehlungen, Entstigmatisierung.
- Arbeit zitieren
- Eva-Maria Endruweit (Autor:in), 2018, Tabuisierung von Krankheit als Herausforderung für die kommunale Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507394