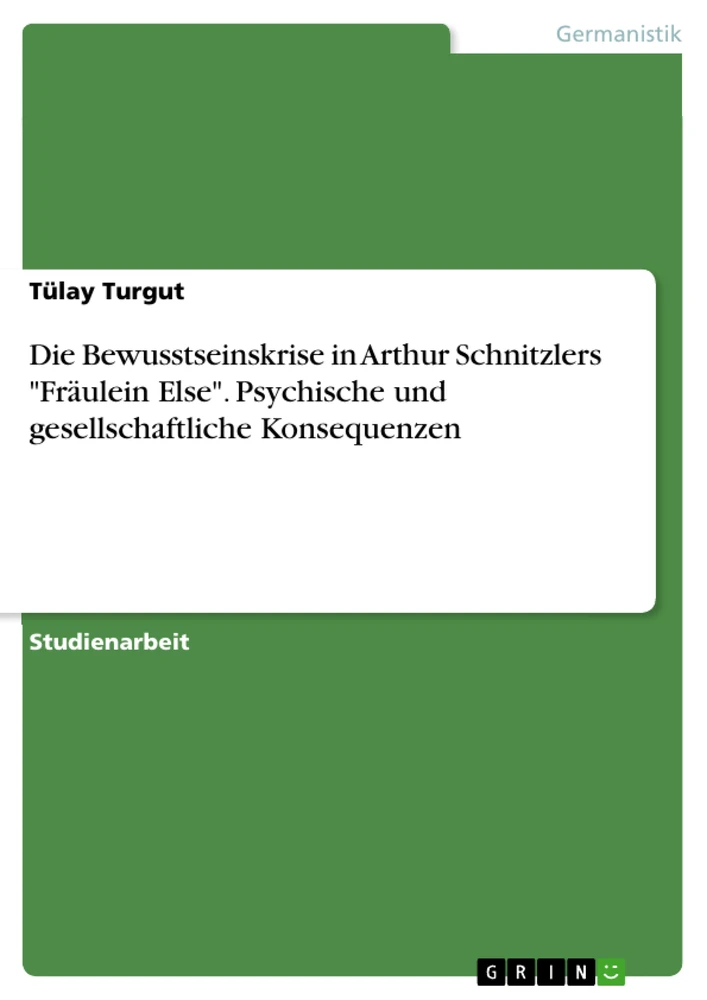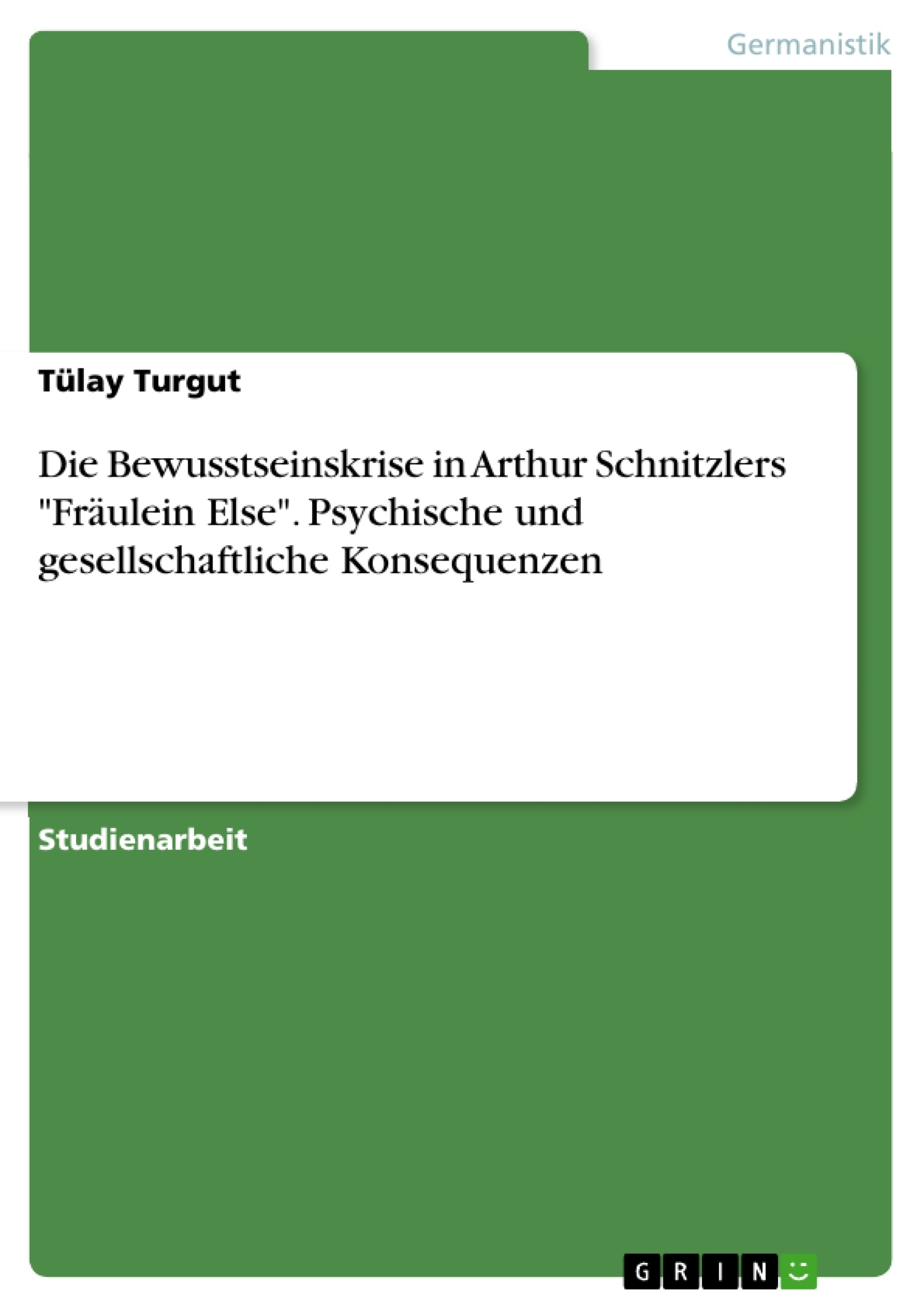Die Arbeit thematisiert die in Artur Schnitzlers Novelle "Fräulein Else" dargestellte Bewusstseinskrise und ihre psychischen und gesellschaftlichen Folgen. Arthur Schnitzler erschafft in seinem Werk ein Bewusstseinsprotokoll der titelgleichen Hauptfigur. In dem sozioökonomischen Wirkungszusammenhang der Novelle wird die Reinheit einer jungen Frau als gesellschaftliches Kapital einer Familie angesehen.
Um das Thema der Bewusstseinskrise überhaupt angehen zu können, bedarf es einer künstlerischen Darstellungsform der Erzählung, die es den Lesenden ermöglicht, am Bewusstsein der Figur teilzuhaben. Durch die Erzähltechnik des taktisch gewählten inneren Monologs bekommen die Lesenden exklusive Einblicke in Elses Gedanken- und Gefühlswelt, sowie die sozioökonomischen Einflüsse auf diese und die unmittelbare innere Reaktion. Die lesende Person kann sich als GedankenleserIn verstehen und befindet sich in einer Machtposition gegenüber den Figuren in der fiktiven Welt. Elses Handlungen erscheinen den Lesenden als gravierende Konsequenz der gesellschaftlichen Rollenzuweisungen, hingegen werden sie in der fiktiven Welt als hysterisch empfunden. Eine Vielzahl von Widersprüchlichkeiten wie Traum-Realität, Leben-Tod, gutbürgerliche Tochter-Prostuierte spiegeln Elses gespaltenes Ich wider und entführen sie in die Bewusstseinskrise.
Der Titel Fräulein definiert Else als junge, unberührte Frau, die auf der einen Seite Männern gefallen soll, aber auf der anderen Seite sie nicht an sich heranlassen darf, um die Chancen auf dem Heiratsmarkt zu bewahren. Diese Bedingung eines Fräuleins wird jedoch auf eine harte Probe gestellt, als Else den Anblick ihres nackten Körpers zur Schau stellen muss, um ihren Vater vor dem Gefängnis zu bewahren. Dieses Dilemma fordert Elses psychisches Innenleben in einem hohen Maße heraus und mündet in einer Bewusstseinskrise.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textstruktur
- 2.1. Der innere Monolog - Eine allgemeine Definition
- 2.2. Der innere Monolog in Fräulein Else
- 3. Die Bewusstseinskrise
- 3.1. Traum und Realität - die Selbstinszenierung des Wunsch-Ichs
- 3.2. Der Blickwechsel
- 3.3. Der Akt der Entblößung
- 3.4 Psychische und gesellschaftliche Konsequenzen
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“ mit dem Fokus auf die Bewusstseinskrise der Protagonistin. Es wird untersucht, wie Schnitzler diese Krise durch die Erzähltechnik des inneren Monologs darstellt und welche Rolle gesellschaftliche und persönliche Faktoren spielen.
- Der innere Monolog als erzählerisches Mittel zur Darstellung von Bewusstseinsinhalten
- Die Konfrontation von Traum und Realität in Elses Psyche
- Die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen im frühen 20. Jahrhundert
- Elses Selbstinszenierung und ihr Kampf um die Bewahrung ihrer Identität
- Die psychischen und sozialen Konsequenzen von Elses Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Novelle „Fräulein Else“ ein und stellt die zentrale Frage nach der Darstellung der Bewusstseinskrise der Protagonistin in den Mittelpunkt. Sie benennt die gesellschaftlichen Zwänge, denen Else ausgesetzt ist, und deutet die Bedeutung des inneren Monologs als literarisches Mittel zur Erforschung von Elses innerem Konflikt an. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit und formuliert die Forschungsfrage, die im Laufe der Analyse beantwortet werden soll.
2. Textstruktur: Dieses Kapitel analysiert die Struktur der Novelle und die Funktion des inneren Monologs. Es wird dargelegt, wie Schnitzler die psychologische und soziale Ebene der Handlung miteinander verknüpft und wie der Leser durch den inneren Monolog Zugang zu Elses Gedanken und Gefühlen erhält. Der Fokus liegt auf dem Wechselspiel zwischen der äußeren Handlung und Elses subjektiver Wahrnehmung, wobei die Diskrepanz zwischen den beiden Ebenen als zentraler Aspekt herausgestellt wird. Die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten der „Bewusstseinsstromtechnik“ werden diskutiert, wobei die Autorin auf die Besonderheiten der gewählten Erzählform eingeht.
2.1. Der innere Monolog - Eine allgemeine Definition: Dieser Abschnitt bietet eine allgemeine Definition des inneren Monologs als literarisches Stilmittel. Es wird auf die direkte Präsentation von Gedanken und Bewusstseinsinhalten ohne Vermittlung durch den Erzähler eingegangen. Die syntaktischen Besonderheiten, wie die assoziative Aneinanderreihung von Bildern, werden hervorgehoben und im Kontext der Erzählperspektive erläutert. Der Abschnitt legt das theoretische Fundament für die spätere Analyse des inneren Monologs in Schnitzlers Werk.
2.2. Der innere Monolog in Fräulein Else: In diesem Abschnitt wird der innere Monolog in Schnitzlers Novelle im Detail analysiert. Es wird gezeigt, wie die Darstellung der krisenhaften psychischen Zustände Elses durch die Technik des inneren Monologs verstärkt wird. Die Dominanz der Gedankenrede Elses und die damit verbundene Transparenz ihrer Impulsivität, Spontanität und Affektivität werden als zentrale Aspekte der Erzähltechnik herausgestellt.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, Fräulein Else, Bewusstseinskrise, innerer Monolog, Bewusstseinsstromtechnik, soziale Determinierung, gesellschaftliche Erwartungen, Frauenrolle, Psychologie, Realität und Traum, Selbstinszenierung.
Häufig gestellte Fragen zu „Fräulein Else“ - Eine Analyse der Bewusstseinskrise
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“ mit dem Fokus auf die Bewusstseinskrise der Protagonistin. Es wird untersucht, wie Schnitzler diese Krise durch die Erzähltechnik des inneren Monologs darstellt und welche Rolle gesellschaftliche und persönliche Faktoren spielen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem inneren Monolog als erzählerisches Mittel, der Konfrontation von Traum und Realität in Elses Psyche, den gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen im frühen 20. Jahrhundert, Elses Selbstinszenierung und ihrem Kampf um die Bewahrung ihrer Identität sowie den psychischen und sozialen Konsequenzen von Elses Handlung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Textstruktur (inkl. einer allgemeinen Definition des inneren Monologs und dessen Anwendung in „Fräulein Else“), ein Kapitel zur Bewusstseinskrise mit Unterkapiteln zu Traum und Realität, dem Blickwechsel, dem Akt der Entblößung und den psychischen und gesellschaftlichen Konsequenzen, und schließlich ein Fazit.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik der Novelle ein, stellt die zentrale Frage nach der Darstellung der Bewusstseinskrise in den Mittelpunkt, benennt die gesellschaftlichen Zwänge und deutet die Bedeutung des inneren Monologs an. Sie skizziert den methodischen Ansatz und formuliert die Forschungsfrage.
Was wird im Kapitel zur Textstruktur analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Struktur der Novelle und die Funktion des inneren Monologs. Es wird die Verknüpfung der psychologischen und sozialen Ebene der Handlung und der Zugang des Lesers zu Elses Gedanken und Gefühlen durch den inneren Monolog beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Wechselspiel zwischen äußerer Handlung und subjektiver Wahrnehmung und den unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten der „Bewusstseinsstromtechnik“.
Wie wird der innere Monolog definiert und in der Novelle angewendet?
Der innere Monolog wird als literarisches Stilmittel definiert, das Gedanken und Bewusstseinsinhalte direkt präsentiert, ohne Vermittlung durch den Erzähler. In „Fräulein Else“ verstärkt er die Darstellung der krisenhaften psychischen Zustände Elses durch die Dominanz der Gedankenrede und die Transparenz ihrer Impulsivität, Spontanität und Affektivität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arthur Schnitzler, Fräulein Else, Bewusstseinskrise, innerer Monolog, Bewusstseinsstromtechnik, soziale Determinierung, gesellschaftliche Erwartungen, Frauenrolle, Psychologie, Realität und Traum, Selbstinszenierung.
- Citation du texte
- Tülay Turgut (Auteur), 2019, Die Bewusstseinskrise in Arthur Schnitzlers "Fräulein Else". Psychische und gesellschaftliche Konsequenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507435