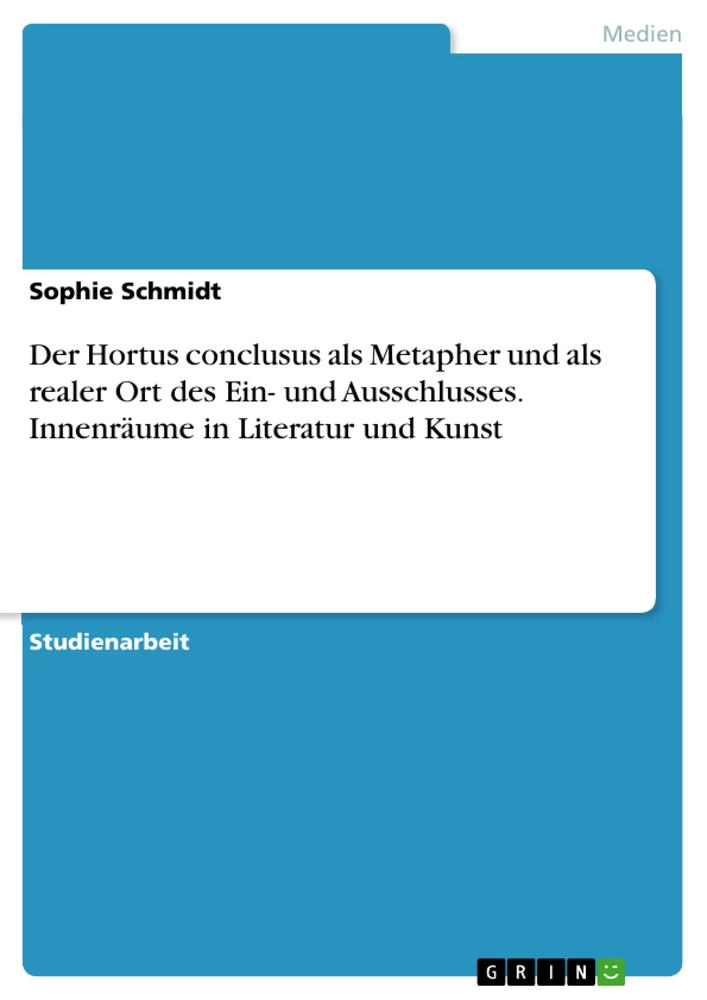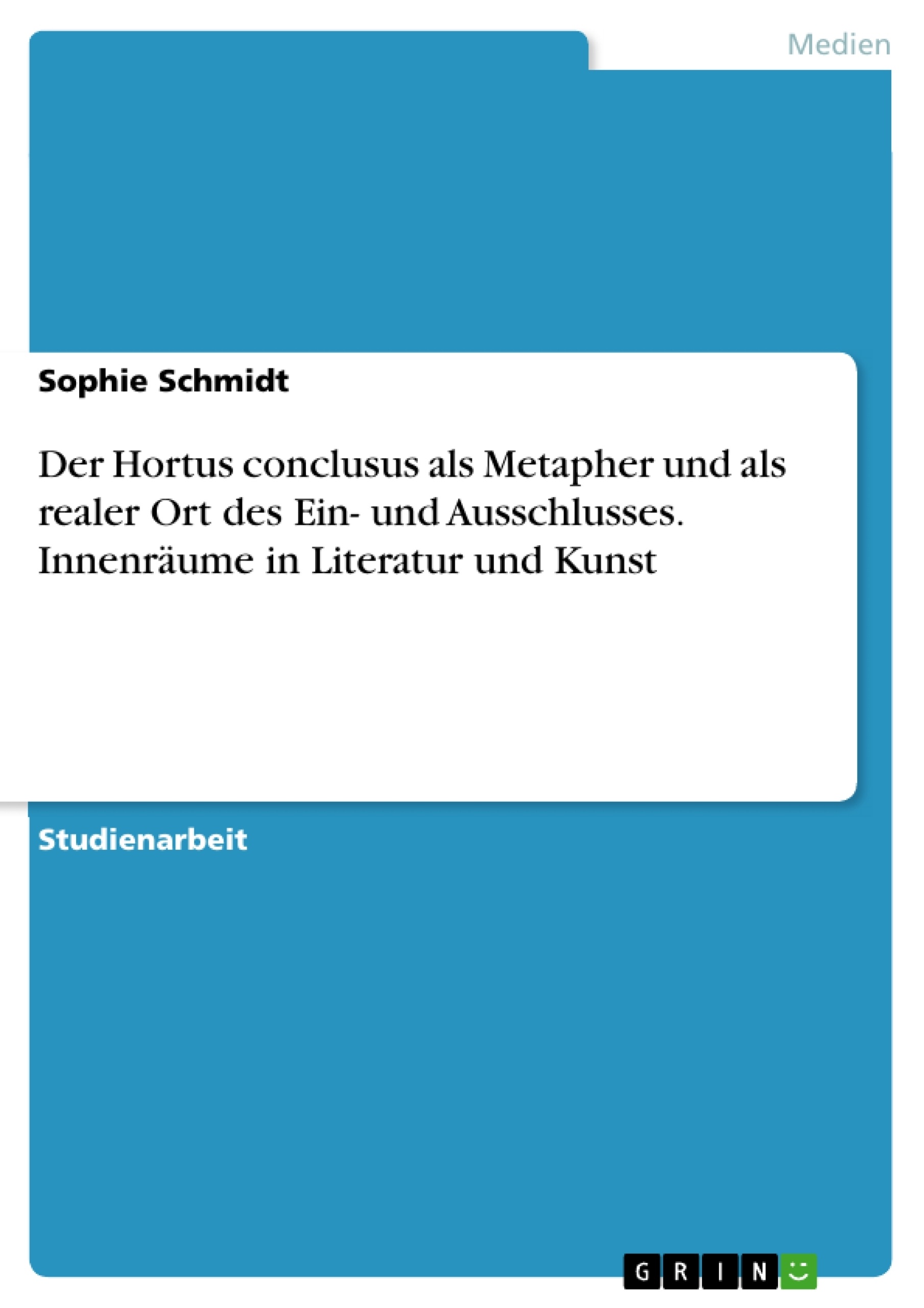Wie stark der Hortus conclusus von seiner Umzäunung, die ein klar definiertes Innen und Außen schafft, geprägt ist, und ob man ihn gar als Interieur bezeichnen kann, wird in dieser Arbeit untersucht. Es kann sich bei einem verschlossenen Garten um einen metaphorischen Ort handeln, aber auch um einen realen, betretbaren Garten. Der Hortus conclusus schlechthin ist das Paradies. Diesen paradiesischen Hortus conclusus findet man auch auf den Darstellungen Mariens im Garten wieder.
Doch auch ein realer Garten kann ein Hortus conclusus sein, wenn er ringsum von einer Einfriedung jeglicher Art umschlossen ist. Anders als der metaphorische Mariengarten kann dieser tatsächlich betreten werden. Hier stellt sich die Frage, wer das Privileg hat, den Garten zu betreten und warum ein Eintritt überhaupt erstrebenswert ist. Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten, sondern ist individuell an den jeweiligen Garten geknüpft. In dieser Arbeit wird ein Überblick über die Ein- und Ausschlusssituationen unterschiedlicher Horti conclusi gegeben, seien sie nur im Geiste betretbar, nur von bestimmten Zugangsberechtigten, von der Allgemeinheit oder gar nur von einer bestimmten Person. Abschließend wird der "enchanted garden", ebenfalls ein hortus conclusus, in H. G. Wells' Kurzgeschichte "The Door in the Wall" behandelt. Ob es sich um einen tatsächlich existierenden Ort oder nur eine Phantasie des Protagonisten handelt, bleibt offen.
Der Hortus conclusus ist ein Phänomen, das sowohl in der darstellenden Kunst und Literatur als auch in der Gartenkunst selbst über die Jahrhunderte und Kontinente hinweg auftritt. Die ersten ummauerten Formalgärten, einer strengen Symmetrie folgenden Gärten, schufen ca. 400 v. Chr. die Perser, die für ihre Gartenkunst bekannt sind. Dabei bezeichnet Hortus conclusus zuallererst nur einen rundum geschlossenen Garten. Beim Hortus conclusus liegt die Betonung stark auf dem Fakt der Verschlossenheit, denn auch das Wort Garten leitet sich von Einfriedung, Umzäunung ab. Das Wort "hortus" steht im etymologischen Zusammenhang mit dem indogermanischen Wort "ghordo", was so viel wie Hof oder auch Gehege bedeutet. Die Begrenzung ist jedem Garten also schon immanent.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Garten Mariens
- als Analogie zum Körper Mariens und Abbreviatur des Paradieses
- Das Betreten des Gartens im Geiste
- Der ummauerte Garten als Schutzraum und Ort der Freude und Kontemplation
- Die Sehnsucht nach dem Paradies
- Natur als Interieur
- Wer ist innen, wer außen?
- Der Garten als Kontrast zur realen Welt in H. G. Wells',,The Door in the Wall\"
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Hortus conclusus, einen ummauerten Garten, als Metapher und als realen Ort des Ein- und Ausschlusses. Sie beleuchtet die symbolische Bedeutung des Hortus conclusus in der Kunst und Literatur, insbesondere in Bezug auf die Mariensymbolik.
- Der Hortus conclusus als Symbol für die unbefleckte Empfängnis und Maria
- Die Bedeutung des Gartens als geschlossener Raum der Kontemplation und des Schutzes
- Die Frage nach dem Ein- und Ausschluss in realen und metaphorischen Gärten
- Die Rolle des Hortus conclusus in der Literatur, insbesondere in H. G. Wells' „The Door in the Wall“
- Der Vergleich von realen und metaphorischen Hortus conclusi
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Hortus conclusus ein und erläutert seine Bedeutung als geschlossener Raum. Das zweite Kapitel analysiert die Symbolik des Mariengartens, der als Abbreviatur des Paradieses und als Analogie zum Körper Mariens betrachtet wird. Das dritte Kapitel untersucht den ummauerten Garten als Schutzraum und Ort der Kontemplation, wobei verschiedene Aspekte wie die Sehnsucht nach dem Paradies, die Natur als Interieur und die Frage nach dem Ein- und Ausschluss in den Fokus gerückt werden.
Schlüsselwörter
Hortus conclusus, Mariensymbolik, Ein- und Ausschluss, Schutzraum, Kontemplation, Paradies, Natur als Interieur, „The Door in the Wall“, H. G. Wells.
- Quote paper
- Sophie Schmidt (Author), 2018, Der Hortus conclusus als Metapher und als realer Ort des Ein- und Ausschlusses. Innenräume in Literatur und Kunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507884