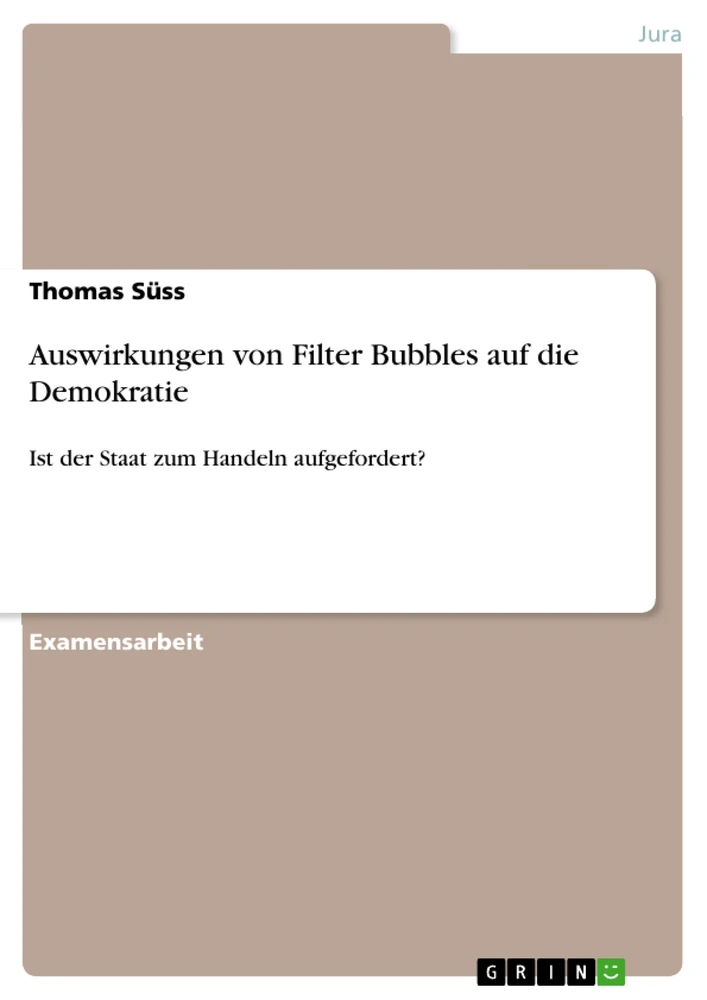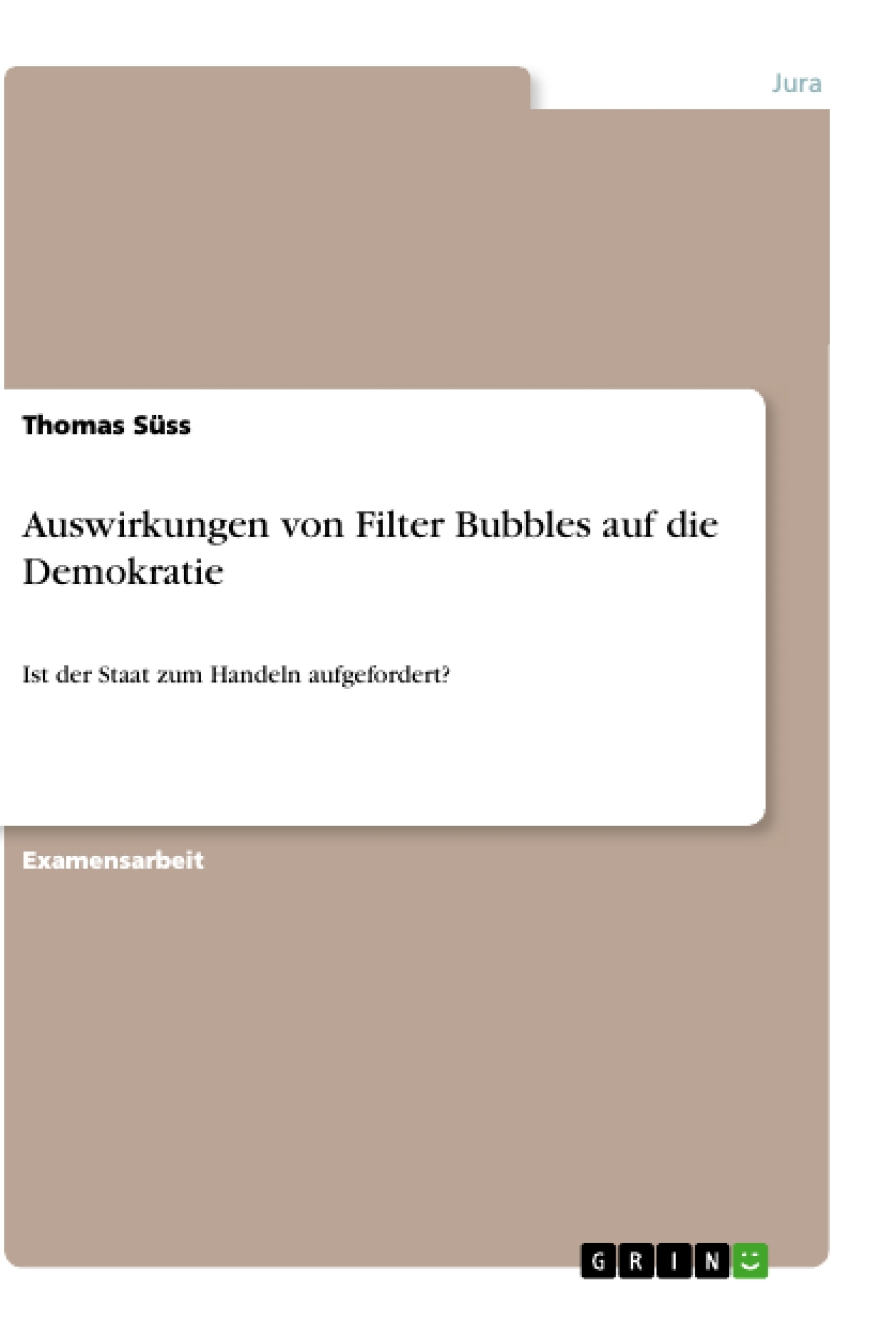Das Internet war eine Verheißung. Durch die enorme Vielfalt an verschiedenen Quellen, die für jeden einfach zugänglich und immer auf dem aktuellsten Wissensstand sind, sollte jeder die Möglichkeit haben, sich entsprechend zu informieren und somit an den demokratischen Prozessen teilzuhaben. Das Internet sollte eine informierte Gesellschaft schaffen und die politische Partizipation fördern. Jedoch treten anstelle der Journalisten, die in etablierten Medien die Funktion des Gatekeepers übernehmen, Algorithmen, welche die Masse an Informationen für den jeweiligen Nutzer vorsortieren und deren Interesse entsprechend filtern. Was als Empfehlungsmechanismus in Onlineshops begann, breitete sich auf das gesamte World Wide Web aus. Die Ära der Personalisierung begann. Suchen verschiedene Personen nach demselben Begriff, werden alle unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Das daraus entstehende Phänomen, wonach Webnutzer ausschließlich oder hauptsächlich mit von ihnen als positiv bewerteten Inhalten konfrontiert werden und auf diese Weise, in einem selbstverstärkenden Prozess, eine einseitige Weltsicht erlangen, wird als Filter Bubble bezeichnet. Damit geht es bei dem Begriff der Filterblase folglich nicht nur um die Ergebnisse einer Suchmaschine oder die Auswahl von Nachrichten in einem sozialen Netzwerk, sondern um alle Onlineanbieter, die Filteralgorithmen verwenden, um durch die gezielte Auswertung nutzergenerierter Daten personalisierte Angebote zu erstellen.
Viele daraufhin entstandene Diskussionen um die Filter Bubble beziehen sich dabei auf soziologische oder ökonomische Ansätze, lassen juristische Betrachtungsweisen jedoch oft außen vor. Diese Lücke versucht die vorliegende Arbeit zu schließen, indem aus rechtswissenschaftlicher Sicht die Auswirkungen von Filter Bubbles auf die Demokratie betrachtet werden, um die Frage zu beantworten, ob der Staat diesbezüglich zum Handeln aufgefordert ist.
Inhaltsverzeichnis
- Auswirkungen von Filter Bubbles auf die Demokratie - Ist der Staat zum Handeln aufgefordert?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit untersucht die Auswirkungen von Filter Bubbles auf die Demokratie und die Frage, ob der Staat zum Handeln verpflichtet ist. Sie analysiert, wie Filter Bubbles die Meinungsbildung und die öffentliche Diskussion beeinflussen und welche Gefahren für die Demokratie durch diese Phänomene entstehen können. Darüber hinaus werden mögliche staatliche Handlungsoptionen diskutiert.
- Filter Bubbles und Meinungsbildung
- Gefahren von Filter Bubbles für die Demokratie
- Staatliche Handlungsoptionen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Zukünftige Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Filter Bubbles auf die Demokratie und die Frage, ob der Staat zum Handeln verpflichtet ist. Sie analysiert zunächst die Funktionsweise von Filter Bubbles und ihre Auswirkungen auf die Meinungsbildung. In diesem Zusammenhang werden auch die Gefahren für die Demokratie diskutiert, die durch Filter Bubbles entstehen können.
Im weiteren Verlauf werden verschiedene staatliche Handlungsoptionen zur Bekämpfung von Filter Bubbles beleuchtet.
Schließlich wird die rechtliche Rahmenbedingungen für die staatliche Intervention im Bereich der digitalen Medien diskutiert.
Schlüsselwörter
Filter Bubbles, Demokratie, Meinungsfreiheit, Medienrecht, Datenschutz, Algorithmen, Soziale Medien, Information, Digitalisierung, Meinungsbildung, Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Thomas Süss (Autor:in), 2019, Auswirkungen von Filter Bubbles auf die Demokratie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508147