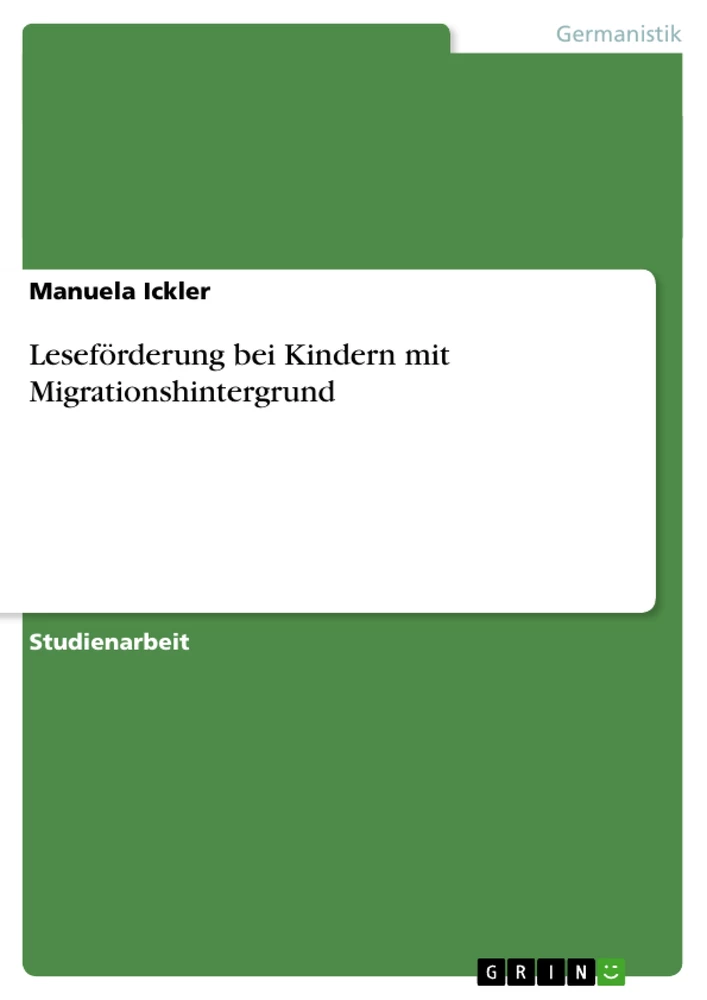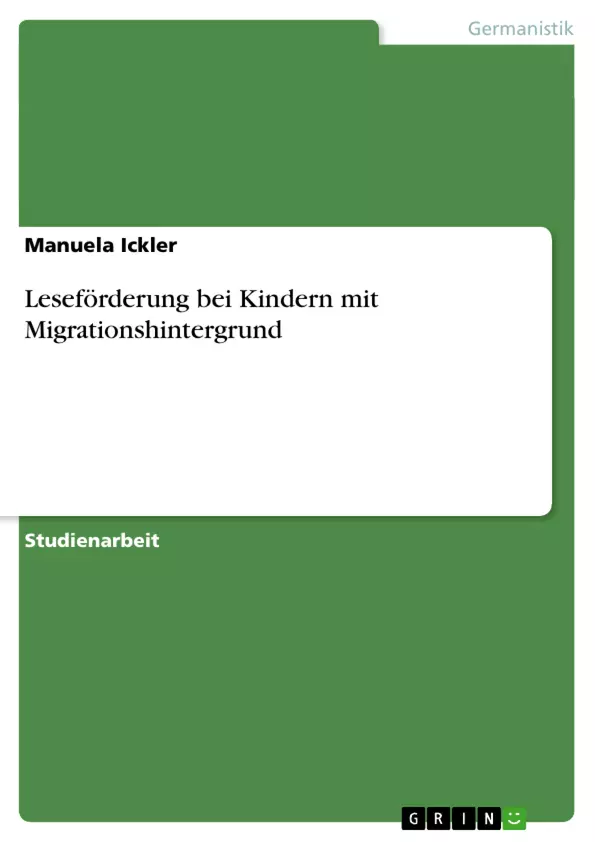Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Förderung des Lesens. Einleitend wird zunächst darauf eingegangen, was unter Leseförderung zu verstehen ist und worin sich die Wichtigkeit der Leseförderung begründet. Das besondere Augenmerk liegt hierbei auf der Leseförderung für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Es werden deren besondere Ausgangslagen und Probleme beleuchtet. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten der Leseförderung, die die Schule gestalten kann. Beispielhaft werden verschiedene Leseförderungsprojekte und –aktionen vorgestellt werden, wobei immer wieder der Bezug zu dem Deutschen als Zweitsprache und –kultur hergestellt werden soll.
(...)
Um die Bedeutung des Lesens und damit auch der Leseförderung erkennen zu können, ist es hilfreich den Begriff der Lesekompetenz nach Auffassung der PISA-Autoren zu betrachten.
Unter Lesekompetenz wird in der Studie die Fähigkeit verstanden, den Inhalt, die Absicht und die formale Struktur von verschiedenen Texten zu verstehen. Der lesekompetente Schüler kann das Gelesene in andere Kontexte einord-nen und selbstständig Texte für verschiedene Zwecke auswählen und nut-zen. Damit stellt die Lesekompetenz zum einen ein Mittel zur Erreichung per-sönlicher Ziele dar und ist Bedingung für die Weiterentwicklung des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten. Zum anderen befähigt sie darüber hinaus den Menschen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben (vgl. Artelt 2001, S. 11).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leseförderung
- Ziel der Leseförderung
- Modelle der Leseförderung
- Bedeutung der Leseförderung
- Hauptteil
- Leben in einer multikulturellen Gesellschaft
- Schulische Möglichkeiten zur Leseförderung
- Literaturangebot
- Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht
- Lesebücher
- Leseförderung am Computer
- Leseförderung durch das Fernsehen
- Zusammenarbeit mit Bibliotheken
- Einbindung der Eltern
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung des Lesens, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Dabei wird die Bedeutung der Leseförderung für diese Gruppe hervorgehoben und die besonderen Herausforderungen, die sich aus ihrer Ausgangslage ergeben, beleuchtet. Die Arbeit konzentriert sich auf die konkreten Möglichkeiten, die Schulen zur Leseförderung anbieten können. Dazu werden verschiedene Leseförderungsprojekte und -aktionen vorgestellt und der Bezug zum Deutschen als Zweitsprache und -kultur hergestellt.
- Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Bedeutung und Zielsetzung von Leseförderung
- Besondere Herausforderungen und Ausgangslagen von Kindern mit Migrationshintergrund
- Praktische Umsetzungsmöglichkeiten der Leseförderung in der Schule
- Bedeutung des Deutschen als Zweitsprache und -kultur für die Leseförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert zunächst den Begriff der Leseförderung und beleuchtet deren Zielsetzung und Bedeutung, wobei der Fokus auf die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegt. Der Hauptteil befasst sich mit dem Leben in einer multikulturellen Gesellschaft und stellt verschiedene Möglichkeiten der Leseförderung in der Schule vor, wie z.B. das Angebot an Literatur, handlungs- und produktionsorientierten Unterricht, Lesebücher, Leseförderung am Computer, durch das Fernsehen, Zusammenarbeit mit Bibliotheken und die Einbindung der Eltern.
Schlüsselwörter
Leseförderung, Kinder mit Migrationshintergrund, Zweitsprache, Mehrsprachigkeit, Interkulturelle Kompetenz, Lesekompetenz, Schulische Leseförderung, Literaturangebot, Handlungsorientierter Unterricht, Medienpädagogik, Elternarbeit.
- Quote paper
- Manuela Ickler (Author), 2005, Leseförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50830