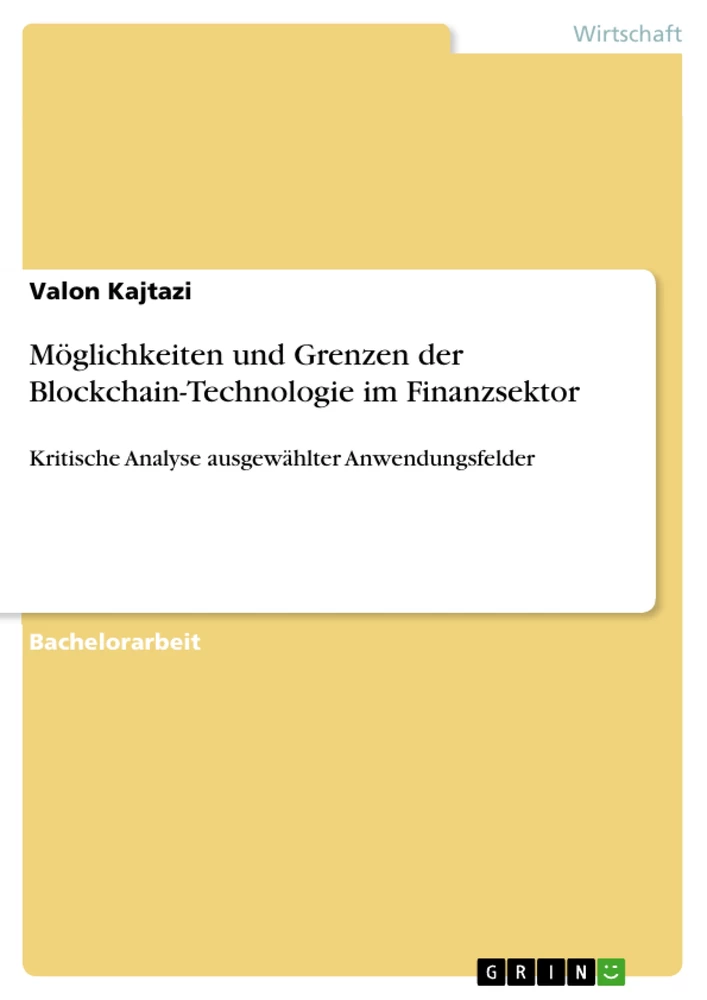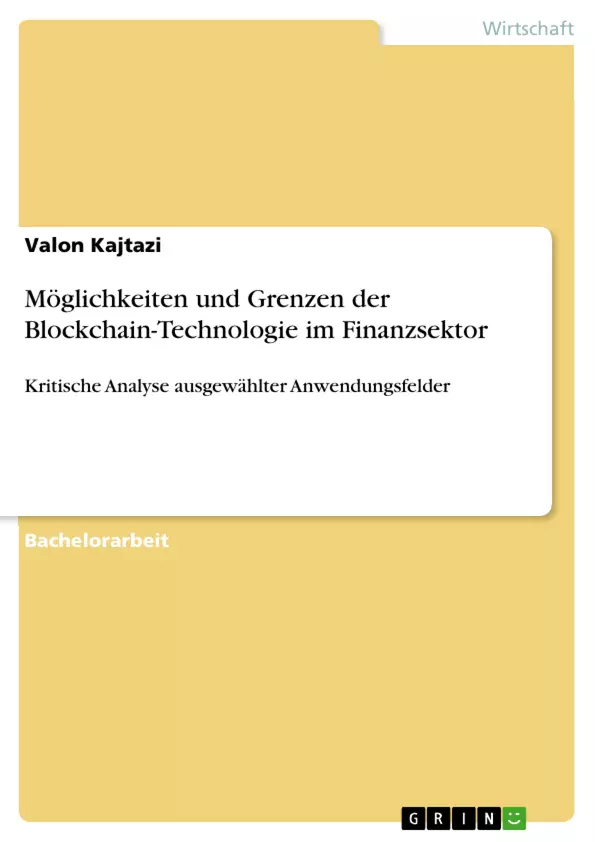Die Zielsetzung der Arbeit besteht darin, zu analysieren, welche Möglichkeiten und Grenzen die Blockchain-Technologie in ausgewählten Anwendungsfeldern des Finanzsektors aufweist. Daraus sollen Handlungs- und Gestaltungempfehlungen
abgeleitet werden. Dabei wird wie folgt vorgegangen. Nach einer Definition und einer thematischen Eingrenzung der Begriffe "Blockchain" und "Finanzsektor" in Kapitel "Begriffsdefinitionen und Grundlagen der Blockchain-Technologie erfolgt eine Darstellung der historischen und technologischen Entwicklung sowie der Grundlagen und Herausforderungen, die die
Blockchain-Technologie zu lösen versucht.
Im Kapitel 3 findet eine detaillierte Darstellung der Blockchain-Technologie. Dabei werden die wesentlichen Bestandteile der Blockchain-Technologie veranschaulicht. Um eine verständliche Darstellung der Blockchain-Technologie zu ermöglichen, wird sich bei der Darstellung auf das Beispiel "Bitcoin" bzw. der "Bitcoin-Blockchain" bezogen. Im Kapitel 3.2 werden der Transaktionsablauf und die wesentlichen Eigenschaften der Blockchain-Technologie thematisiert. Anschließend wird eine Kategorisierung der Entwicklungen und Angebote dargestellt, um ein ganzheitliches Bild des Anwendungsspektrums der Blockchain-Technologie zu ermöglichen.
Zudem werden im Kapitel 3.3 mögliche Varianten der Blockchain-Technologie erläutert. Abschließen werden im Kapitel 3.4 grundsätzliche Anwendungsfelder der Blockchain-Technologie vorgestellt. Im Kapitel 4 erfolgt zunächst die Darstellung aktueller Herausforderungen im Finanzsektor sowie diverser Studien über das Interesse und mögliche Anwendungsfelder der Blockchain-Technologie im Finanzsektor. Anschließend erfolgt eine Analyse ausgewählter Anwendungsfelder, um Rückschlüsse über Möglichkeiten und Grenzen der Technologie zu gewinnen. Abschließend werden aus den Erkenntnissen der Analyse mögliche Handlungs- und Gestaltungmöglichkeiten abgeleitet. Die Zusammenfassung stellen das Ende der Arbeit dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition und Grundlagen
- Begriffsdefinition und technologische Einordnung
- Historische und technologische Entwicklung
- Grundlagen und Herausforderungen
- Darstellung der Blockchain-Technologie
- Bestandteile
- Netzwerk
- Verschlüsselung
- Konsensfindung und Blockstruktur
- Transaktionsablauf und Eigenschaften
- Anwendungskategorien und Varianten
- Grundsätzliche Anwendungsfelder
- Kritische Analyse der Anwendungspotenziale der Blockchain-Technologie im Finanzsektor
- Ausgewählter Anwendungsfelder - Möglichkeiten
- Informationssicherheit
- Konformitätsprüfung
- Zahlungsverkehr
- Börsen- und Handelsplattform
- Grenzen der Blockchain-Technologie
- Bewertung
- Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten und Grenzen der Blockchain-Technologie in ausgewählten Anwendungsfeldern des Finanzsektors. Sie zielt darauf ab, Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen abzuleiten, die den Einsatz der Technologie im Finanzsektor optimieren.
- Definition und Einordnung der Blockchain-Technologie
- Historische Entwicklung und Herausforderungen der Blockchain-Technologie
- Bestandteile und Funktionsweise der Blockchain-Technologie
- Anwendungspotenziale der Blockchain-Technologie im Finanzsektor
- Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Blockchain-Technologie im Finanzsektor
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Blockchain-Technologie im Kontext des Finanzsektors vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
- Das Kapitel „Begriffsdefinition und Grundlagen“ definiert den Begriff „Blockchain“ und ordnet die Technologie historisch und technologisch ein. Es werden zudem die grundlegenden Herausforderungen der Blockchain-Technologie beleuchtet.
- Das Kapitel „Darstellung der Blockchain-Technologie“ präsentiert die wesentlichen Bestandteile der Blockchain-Technologie, darunter Netzwerk, Verschlüsselung, Konsensfindung und Blockstruktur. Es erläutert den Transaktionsablauf und die Eigenschaften der Technologie und kategorisiert die verschiedenen Anwendungsfelder.
- Das Kapitel „Kritische Analyse der Anwendungspotenziale der Blockchain-Technologie im Finanzsektor“ untersucht die Anwendungspotenziale der Blockchain-Technologie in ausgewählten Anwendungsfeldern des Finanzsektors, wobei die Grenzen der Technologie berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Blockchain-Technologie, Finanzsektor, Kryptowährungen, Informationssicherheit, Konformitätsprüfung, Zahlungsverkehr, Börsen- und Handelsplattformen, Decentralized Finance (DeFi), Smart Contracts.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wichtigsten Vorteile der Blockchain im Finanzsektor?
Zu den Vorteilen gehören erhöhte Informationssicherheit, effizienterer Zahlungsverkehr, schnellere Konformitätsprüfungen und die Möglichkeit, Handelsplattformen ohne zentrale Instanz zu betreiben.
Welche Rolle spielt Bitcoin bei der Erklärung der Blockchain?
Bitcoin dient oft als Referenzbeispiel, um den Transaktionsablauf, die Verschlüsselung und die Konsensfindung in einer öffentlichen Blockchain zu veranschaulichen.
Was sind die Grenzen der Blockchain-Technologie?
Herausforderungen liegen in der Skalierbarkeit, dem hohen Energieverbrauch bestimmter Konsensmechanismen, regulatorischen Unsicherheiten und der Integration in bestehende IT-Systeme.
Was versteht man unter Smart Contracts?
Smart Contracts sind selbstausführende Verträge, deren Bedingungen direkt in Code geschrieben sind und die auf einer Blockchain automatisch ausgeführt werden, sobald Kriterien erfüllt sind.
Welche Varianten der Blockchain gibt es?
Man unterscheidet primär zwischen öffentlichen (permissionless) Blockchains wie Bitcoin und privaten oder konsortialen (permissioned) Blockchains, die oft in Unternehmen genutzt werden.
- Citation du texte
- Valon Kajtazi (Auteur), 2019, Möglichkeiten und Grenzen der Blockchain-Technologie im Finanzsektor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508340