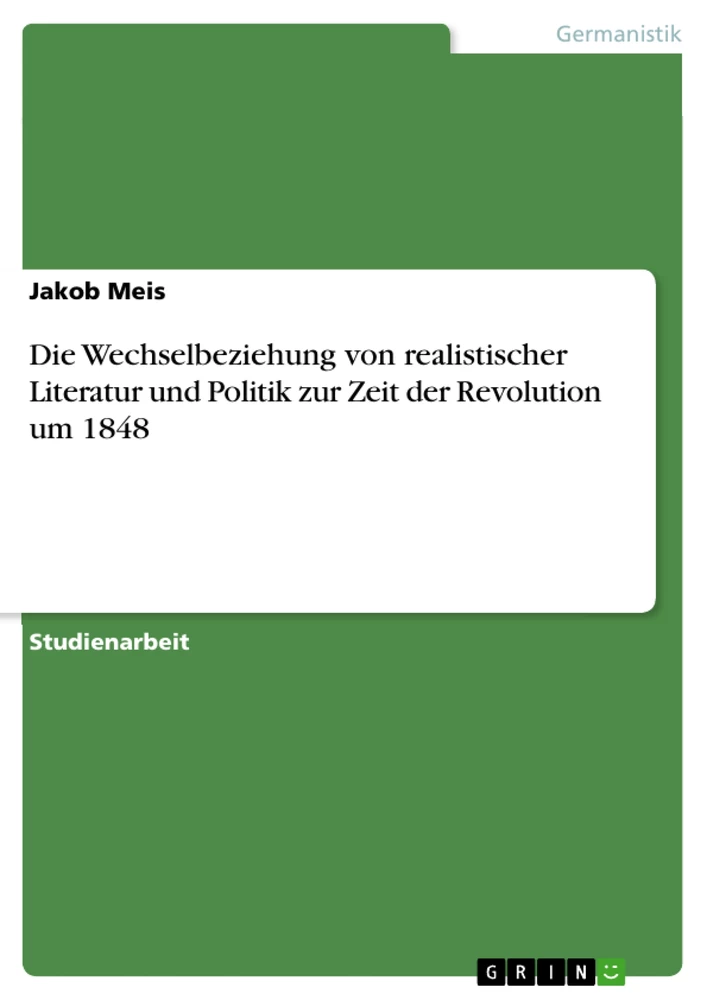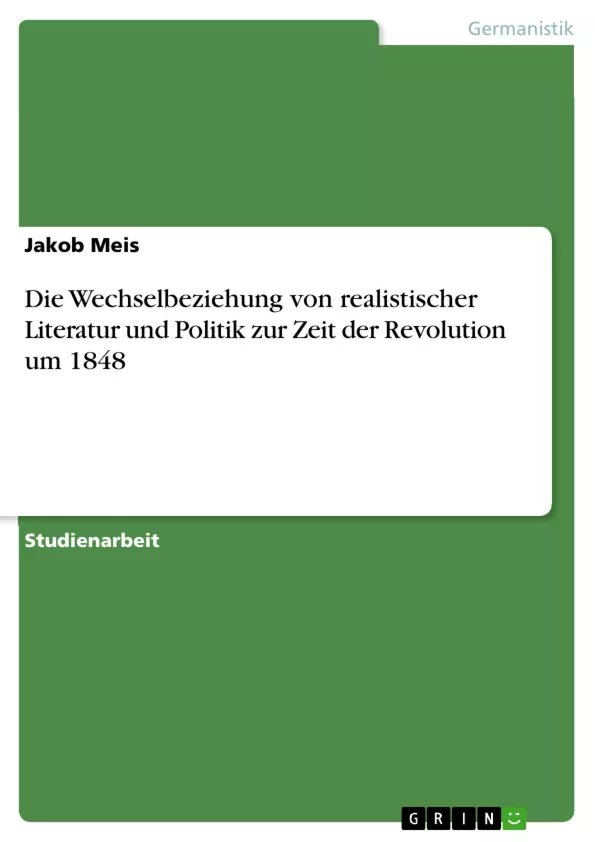Die realistische Literaturgattung, deren Erfolg in engem Zusammenhang mit den sozialen und politischen Geschehnissen ihrer Zeit steht, stellt das Thema dieser Hausarbeit dar. Hat sich die Politik durch die realistische Literaturgattung verändert? Wurde die realistische Literatur durch die politischen Geschehnisse beeinflusst? Kann man von einer Wechselwirkung beider Systeme sprechen? Diese Fragen bilden den Kern dieser Arbeit. Anhand der Analyse zweier nahezu zeitgleich veröffentlichter Texte der Literaturforscher Robert Prutz und Wilhelm Riehl wird der Versuch ihrer Beantwortung unternommen.
Da beide Autoren sich in den betreffenden Werken mit den Ereignissen um 1848 auseinandersetzen und die Schriften auch nur wenig später 1854 veröffentlicht wurden, wird zu Beginn der Bearbeitung ein Überblick zum politischen und gesellschaftlichen Geschehen, das sich mit der Märzrevolution abspielte, vorangestellt. Folgend werden die Texte, durch wichtige biografische Aspekte der Autoren eingeleitet, analysiert, um sie abschließend zu vergleichen und signifikante Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede herauszustellen. Im Anschluss an die Fragmentierung der beiden Schriften und dem konkludierenden Vergleich wird die Leitthematik der Arbeit im abschließenden Fazit wieder aufgenommen und der Versuch unternommen, die anfangs formulierten Orientierungsfragen zur Interferenz von realistischer Literatur und Politik zu beantworten.
Deutschlands realistische Literaturgattung entstand zu einer Zeit des Umbruchs, des Änderungswillens und der Neugier im Volk. Sie löste sich von alten Kunstidealen und beschäftigte sich mit ihrer Umwelt, indem sie die menschliche Verfassung thematisierte, historisch-politisch konkretisierte, regional differenzierte und an repräsentativen Einzelfällen problematisierte. Die Märzrevolution 1848 kann aus heutiger Sicht als das Ende einer langen Zündschnur betrachtet werden. Ein revolutionärer Ausbruch lag bereits in der Luft und wurde vom Volk erwartet. Soziale Ungerechtigkeit und das Nichtumsetzen erhoffter Reformen wie den Freiheitsrechten hatten das deutsche Staatssystem ins Wanken gebracht. Durch die Hungersnot und wirtschaftliche Turbulenzen 1847 wurde das deutsche Volk seiner Perspektivlosigkeit immer mehr gewahr und der Ruf nach Veränderung, nach einer freiheitlich-volkstümlichen Neuordnung wurde lauter.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutschland im Wandel
- Das Streben nach Einigkeit, Recht und Freiheit
- Robert Eduard Prutz
- Zur Geschichte einer politischen Poesie in Deutschland
- Der Import von Politik in die Literatur
- Wilhelm Heinrich Riehl
- Sondergeist und Einigungstrieb im deutschen Volksleben
- Zu der Bedeutung von Literatur für die Politik
- Sondergeist und Einigungstrieb im deutschen Volke versus Zur Geschichte einer politischen Poesie in Deutschland – Ein Textvergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wechselbeziehung zwischen realistischer Literatur und Politik im Kontext der Revolution von 1848. Sie analysiert, wie politische Ereignisse die Entwicklung der realistischen Literatur beeinflussten und inwieweit literarische Werke die politische Landschaft veränderten.
- Die Rolle der realistischer Literatur in der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Der Einfluss politischer Ereignisse auf die Entwicklung der realistischer Literatur
- Die Darstellung von gesellschaftlichen Konflikten und Problemen in der realistischer Literatur
- Der Zusammenhang zwischen Literatur und Politik im Kontext der Revolution von 1848
- Der Vergleich zweier Werke von Robert Eduard Prutz und Wilhelm Heinrich Riehl als Beispiele für die Wechselwirkung zwischen Literatur und Politik.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage und den Fokus der Arbeit vor. Es beleuchtet die Entstehung der realistischer Literatur im Kontext des gesellschaftlichen Umbruchs im 19. Jahrhundert.
- Deutschland im Wandel: Dieses Kapitel analysiert die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in Deutschland im Vorfeld der Revolution von 1848. Der Fokus liegt auf dem Streben nach Einigkeit, Recht und Freiheit und den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die an den Revolutionen beteiligt waren.
- Robert Eduard Prutz: Dieses Kapitel beleuchtet die politische und literarische Entwicklung von Robert Eduard Prutz im Kontext der Revolution von 1848. Seine Werke und sein politisches Engagement werden analysiert.
- Wilhelm Heinrich Riehl: Dieses Kapitel analysiert die Werke und das politische Engagement von Wilhelm Heinrich Riehl im Kontext der Revolution von 1848.
- Sondergeist und Einigungstrieb im deutschen Volke versus Zur Geschichte einer politischen Poesie in Deutschland – Ein Textvergleich: Dieses Kapitel vergleicht die beiden analysierten Werke von Robert Eduard Prutz und Wilhelm Heinrich Riehl und hebt wichtige Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen: realistische Literatur, Revolution von 1848, politische Poesie, Deutschland, Einigkeit, Recht und Freiheit, Robert Eduard Prutz, Wilhelm Heinrich Riehl, Textvergleich, Wechselwirkung, Literatur und Politik.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen realistische Literatur und die Revolution von 1848 zusammen?
Die realistische Literatur entstand in einer Zeit des politischen Umbruchs. Sie löste sich von alten Idealen und thematisierte konkret die sozialen und politischen Probleme der Märzrevolution.
Welche Rolle spielten Robert Prutz und Wilhelm Riehl?
Beide waren Literaturforscher, die sich in ihren Werken mit den Ereignissen um 1848 auseinandersetzten. Prutz fokussierte auf politische Poesie, während Riehl die Bedeutung der Literatur für das Volksleben untersuchte.
Was war das Ziel der realistischen Literaturgattung?
Sie wollte die menschliche Verfassung historisch-politisch konkretisieren und gesellschaftliche Missstände anhand von repräsentativen Einzelfällen problematisieren.
Gab es eine Wechselwirkung zwischen Literatur und Politik?
Ja, die Arbeit untersucht, ob die Politik die Literatur beeinflusste und ob literarische Werke wiederum zur Veränderung des politischen Bewusstseins im Volk beitrugen.
Was forderte das Volk während der Märzrevolution?
Zentrale Forderungen waren Einigkeit, Recht und Freiheit sowie soziale Gerechtigkeit und die Umsetzung von Reformen gegen die Perspektivlosigkeit.
Wie unterschieden sich die Ansätze von Prutz und Riehl?
Die Arbeit vergleicht Prutz' Werk zur politischen Poesie mit Riehls Analyse von Sondergeist und Einigungstrieb, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Sicht auf die Literatur herauszustellen.
- Quote paper
- Jakob Meis (Author), 2013, Die Wechselbeziehung von realistischer Literatur und Politik zur Zeit der Revolution um 1848, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508390