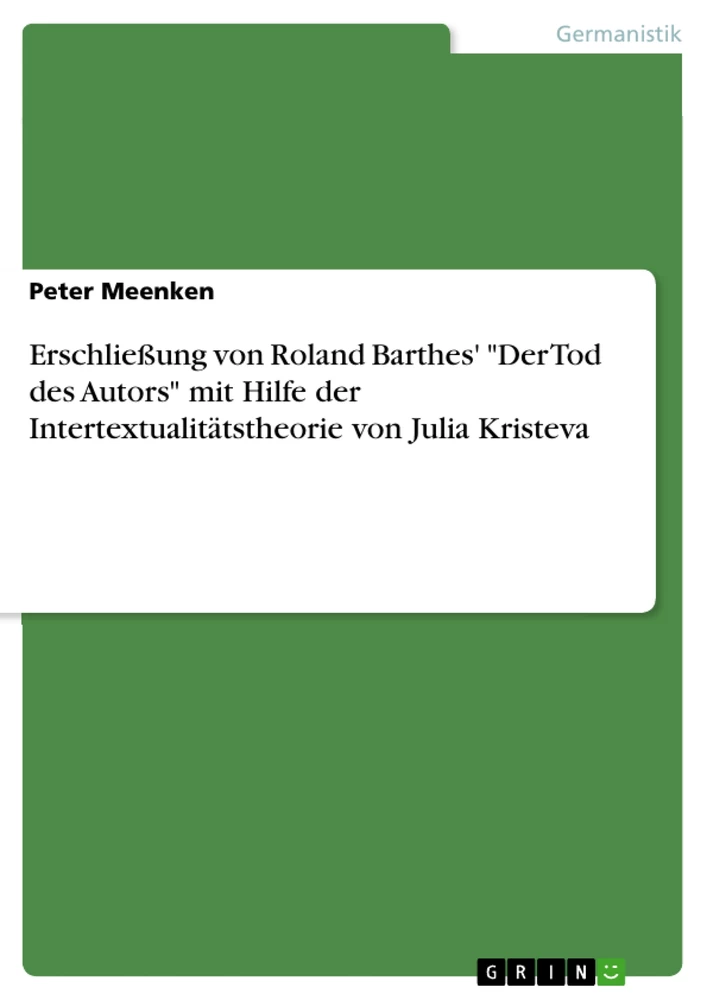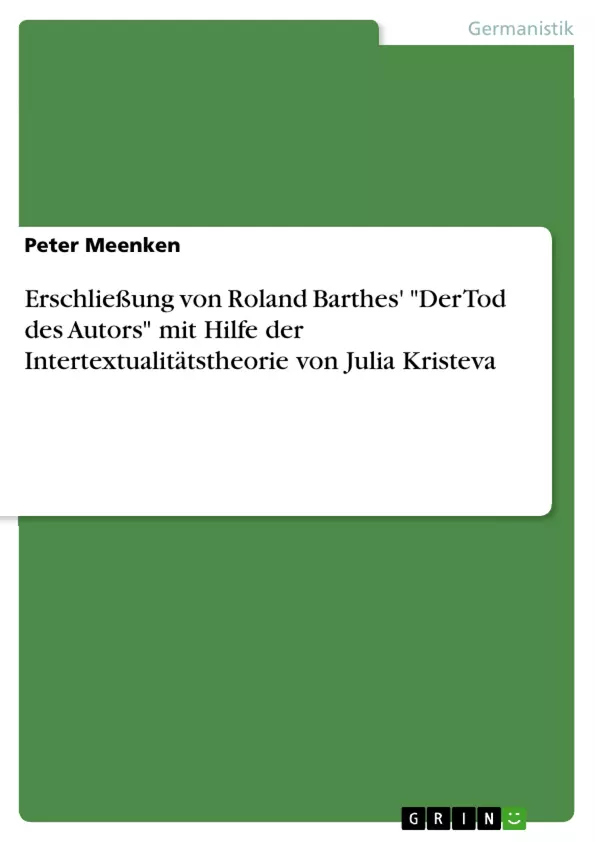Diese Ausarbeitung behandelt das programmatische Werk von Roland Barthes: "Der Tod des Autors". Die These lautet: Roland Barthes‘ "Der Tod des Autors" lässt sich anhand einer Kontextualisierung mit Julia Kristevas Intertextualitätstheorie tiefergehend erschließen. Der polarisierende Text mit beinahe polemischer Wirkung wurde erstmals in dem experimentellen, nordamerikanischen Magazin "Aspen" im Jahre 1967 veröffentlicht. 1968 folgte die Veröffentlichung in dem französischen Magazin "Manteia". Bemerkenswert an der Rezeption von Barthes' essayistischer Dekonstruktion der Autorperson ist, dass sie eine beeindruckende Sprengkraft besaß, welche bis heute akademische Diskurse beschäftigt.
Die Sprengkraft von Barthes‘ Arbeit erklärt sich vor allem aufgrund des zeitlichen Kontextes. So war das schulische wie akademische Umfeld stark von der literaturwissenschaftlichen Tradition der explication du texte geprägt. Diese Tradition konstituierte, dass es das höchste Ziel literaturwissenschaftlicher Tätigkeit sei, Korrespondenzen zwischen der semantischen sowie formalen Gestalt literarischer Werke und der Autorbiographie zu konstruieren. Somit würde sowohl die komplette Gestalt, Inhalt, Semantik allein auf den Autor zurückgehen, er besäße sogar die alleinige Deutungshoheit über das literarische Werk. Dieser Umstand wird in dem auf Barthes‘ Essay folgenden Diskurs oftmals als "tyranny of the author" bezeichnet.
Barthes hingegen fasste diese Herangehensweise als höchst einschränkend für die literaturwissenschaftliche Tätigkeit auf und proklamierte eine immense Bedeutung des Rezipienten für die Semantik eines literarischen Werkes. Am Ende des Essays postuliert er: "Die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors." Hiermit reiht sich Barthes in die Tradition der poststrukturalistischen Literaturwissenschaft ein. Wie Barthes argumentativ zu dieser Konklusion gelangt, soll in der nun folgenden Diskussion erläutert werden. Jedoch gestaltet sich dieses Unterfangen aufgrund von Barthes‘ stark essayistischem Vorgehen als komplex. Carlos Spoerhase begegnet dieser Problematik mithilfe einer Kontextualisierung von "Der Tod des Autors" mit Focaults Literaturtheorie. Ein ähnliches Vorgehen wird in dieser Arbeit umgesetzt, jedoch wird als Vergleichsmaterial die poststrukturalistische Intertextualitätstheorie herangezogen. Allen voran wird dabei auf Manfred Pfisters Auseinandersetzung mit Julia Kristeva zurückgegriffen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Ausarbeitung
- 1. Hinführung
- 2. Poststrukturalistische Literaturtheorien
- 3. Barthes Argumentationsstruktur
- 4. Kristevas Intertextualitätstheorie
- 5. Zusammenschau
- 6. Resümee
- 7. Literatur- und Quellenverzeichnis
- 7.1 Primärliteratur
- 7.2 Sekundärliteratur
- II. Reflexion
- 1. Referat
- 2. Ausarbeitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich mit Roland Barthes' programmatischem Essay „Der Tod des Autors“ und untersucht dessen Bedeutung im Kontext der poststrukturalistischen Literaturtheorie. Der Fokus liegt dabei auf der Dekonstruktion des traditionellen Autorbegriffs und der Herausstellung des Rezipienten als zentralen Akteur der Interpretation. Die Arbeit analysiert Barthes' Argumentation im Vergleich zu Julia Kristevas Intertextualitätstheorie, um die Relevanz des Konzeptes der Intertextualität für die literaturtheoretische Rezeption von Barthes' Essay zu verdeutlichen.
- Dekonstruktion des traditionellen Autorbegriffs
- Hervorhebung des Rezipienten als zentralen Akteur der Interpretation
- Vergleich von Barthes' Argumentation mit Kristevas Intertextualitätstheorie
- Relevanz der Intertextualität für die literaturtheoretische Rezeption von Barthes' Essay
- Kontextualisierung von Barthes' Essay in der poststrukturalistischen Literaturtheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Hinführung zu Barthes' Essay „Der Tod des Autors“ dar. Es beleuchtet den historischen Kontext des Essays und die Bedeutung von Barthes' Arbeit für die literaturwissenschaftliche Diskussion. Kapitel zwei widmet sich den poststrukturalistischen Literaturtheorien, in denen Barthes' Werk verortet wird. Es skizziert die zentralen Grundannahmen dieser Theorien und beleuchtet, wie Barthes' Konzepte in dieses theoretische Feld einzuordnen sind. Kapitel drei widmet sich der detaillierten Analyse von Barthes' Argumentation, wobei die historische Entwicklung des Autorbegriffs sowie die Kritik am traditionalistischen Verständnis von Autorschaft im Vordergrund stehen. Kapitel vier stellt Kristevas Intertextualitätstheorie dar, die als wichtiges Vergleichsmodell für die Interpretation von Barthes' Essay dient. Es werden die zentralen Elemente der Intertextualitätstheorie erläutert und ihre Relevanz für die literaturtheoretische Rezeption von Barthes' Arbeit verdeutlicht. Kapitel fünf befasst sich mit der Zusammenschau von Barthes' Konzepten und Kristevas Intertextualitätstheorie. Es wird untersucht, inwiefern Kristevas Theorie zur Vertiefung von Barthes' Argumentation beitragen kann und wie die Intertextualität das Verständnis des literarischen Textes erweitert. Kapitel sechs fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bietet eine schematische Darstellung, welche die erarbeitete Sichtweise auf die poststrukturalistische Theorie von der traditionellen Herangehensweise an die explication du texte abgrenzt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Ausarbeitung sind die poststrukturalistische Literaturtheorie, der Tod des Autors, Intertextualität, Rezeption, Dekonstruktion, und die Bedeutung des Rezipienten für die Interpretation. Der Essay von Roland Barthes „Der Tod des Autors“ steht im Mittelpunkt der Analyse und wird in Bezug auf die Intertextualitätstheorie von Julia Kristeva untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Kritik am traditionalistischen Autorbegriff und verdeutlicht die Relevanz des Rezipienten als zentralen Akteur der Interpretation. Die Ausarbeitung widmet sich der Erforschung der poststrukturalistischen Herangehensweise an die Literaturwissenschaft und den Einfluss dieser Theorie auf die literaturtheoretische Diskussion.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Roland Barthes mit der These vom "Tod des Autors"?
Barthes dekonstruiert die Idee, dass der Autor die alleinige Deutungshoheit über einen Text besitzt. Er argumentiert, dass die Bedeutung erst im Moment des Lesens durch den Rezipienten entsteht.
Wie hängen Barthes' Essay und Julia Kristevas Intertextualitätstheorie zusammen?
Die Arbeit nutzt Kristevas Theorie, um zu zeigen, dass Texte aus Zitaten und Verweisen bestehen, was die Rolle des Autors als "Schöpfer" weiter relativiert und den Text als Gewebe aus anderen Texten versteht.
Was ist die "tyranny of the author"?
Damit ist die traditionelle Literaturwissenschaft gemeint, die den Sinn eines Werkes ausschließlich in der Biografie und den Absichten des Autors suchte.
Warum ist die "Geburt des Lesers" laut Barthes so wichtig?
Für Barthes ist der Leser der Ort, an dem sich die vielfältigen Fäden eines Textes vereinen; ohne den Leser bleibt der Text semantisch unvollständig.
In welche literaturtheoretische Strömung lässt sich Barthes einordnen?
Barthes' Essay gilt als programmatisches Werk des Poststrukturalismus, das die festen Strukturen von Autor, Werk und Bedeutung infrage stellt.
- Quote paper
- Peter Meenken (Author), 2019, Erschließung von Roland Barthes' "Der Tod des Autors" mit Hilfe der Intertextualitätstheorie von Julia Kristeva, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508894