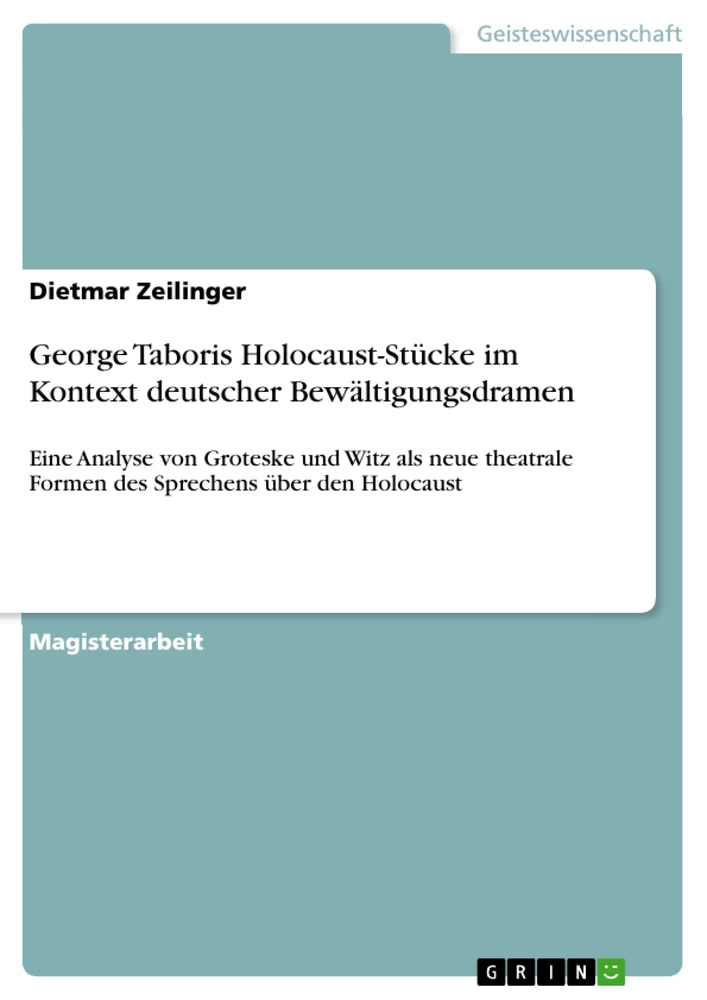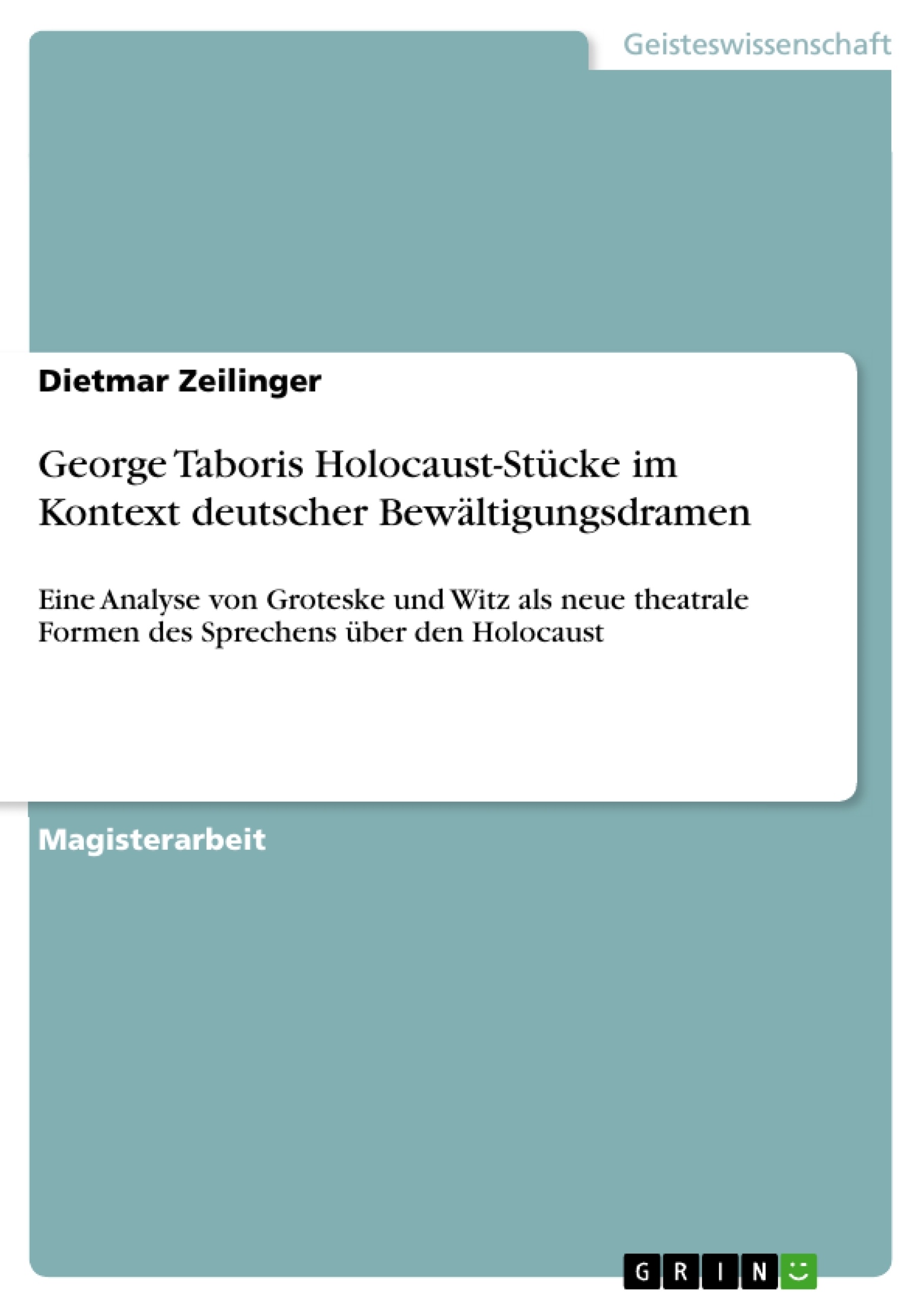Als 1998 Roberto Benignis Film Das Leben ist schön in die Kinos kam, provozierte er eine sehr kontrovers geführte Debatte um die angemessene Darstellung von Auschwitz und der Massenvernichtung der europäischen Juden im Medium Film. Zum einen wurde an dem Film kritisiert, dass die Leiden der Insassen von Konzentrationslagern in einer Komödie gezeigt werden, zum anderen war die mangelnde Authentizität Gegenstand der Angriffe. Guido, die männliche Hauptfigur, lügt im Film seinem vierjährigen Sohn Giosue vor, Auschwitz sei nur ein Spiel; es werde nach Punkten bewertet, wie gut man die Schwierigkeiten übersteht, und der Sieger werde einen echten Panzer gewinnen. Diese Fabel, angelegt in einer Komödie, zog sich schnell den Vorwurf zu, den Holocaust zu verharmlosen und seinem Gegenstand nicht gewachsen zu sein. Die Debatte, in die sich auch der Schriftsteller und Auschwitz-Überlebende Imre Kertesz einschaltete, wurde mit Argumenten geführt, die, seit es Literatur über den Holocaust gibt, immer wieder auftauchen. Wichtig ist hierbei die Frage, ob eine fiktionale Darstellung des Holocaust machbar ist, und inwieweit eine solche Fiktion in historischen Dokumenten fußen sollte. Der Schriftsteller Kertesz spricht sich eindeutig für eine fiktionale Bearbeitung des Stoffes aus, für ihn ist „das Konzentrationslager (...) ausschließlich als Literatur vorstellbar, als Realität nicht“.1 Ihm gegenüber stehen so prominente Persönlichkeiten wie Theodor W. Adorno, Claude Lanzmann oder Ellie Wiesel, die, jeder auf seine Weise gegen eine Fiktionalisierung sprechen.2
[...]
1 Kertesz 1998: 3
2 vgl. Strümpel 2000: 18f oder Skloot 1988: 68f
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Holocaust und seine Darstellbarkeit: Von Adorno bis Tabori
- 2.1 Das Unsagbare sagen: Ein Darstellungsverbot und seine Folgen
- 2.1.1 Literatur und Holocaust
- 2.1.2 Drama und Holocaust
- 2.2 Das deutschsprachige Bewältigungsdrama ab 1945
- 2.2.1 Melodramatik im Drama von 1945 bis 1960
- 2.2.2 Parabelstück und Dokumentarisches Theater im Drama der 60er Jahre
- 2.2.3 Das Ende der Bewältigung im Drama der 70er und 80er Jahre
- 2.3 George Tabori
- 2.3.1 Biographisches
- 2.3.2 Theaterarbeit
- 3. Groteske und Witz in George Taboris Holocaust-Dramen
- 3.1 Zur Theorie
- 3.1.1 Groteske
- 3.1.2 Witz
- 3.2 Die Stücke
- 3.2.1 Die Kannibalen
- 3.2.1.1 Handlung, Einordnung und Rezeption
- 3.2.1.2 Groteske
- 3.2.1.3 Witz
- 3.2.2 Jubiläum
- 3.2.2.1 Handlung, Einordnung und Rezeption
- 3.2.2.2 Groteske
- 3.2.2.3 Witz
- 3.2.3 Mein Kampf
- 3.2.3.1 Handlung, Einordnung und Rezeption
- 3.2.3.2 Groteske
- 3.2.3.3 Witz
- 4. Auswertung
- 4.1 Zusammenfassung Groteske
- 4.2 Zusammenfassung Witz
- 4.3 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Analyse der grotesken und komischen Elemente in drei ausgewählten Holocaust-Dramen von George Tabori. Ziel der Arbeit ist es, Taboris Vorgehensweise in Bezug auf den Holocaust zu untersuchen und seine Einordnung im Kontext des deutschsprachigen Bewältigungsdramas zu beleuchten. Die Arbeit geht davon aus, dass Tabori mit seinem Theater bewusst auf zeitgenössische Stücke sowie politische und gesellschaftliche Tendenzen und Entwicklungen reagiert hat.
- Die Darstellbarkeit des Holocausts und die Grenzen der Fiktion
- Die Verwendung von Groteske und Witz als theatralen Formen zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust
- Der Einfluss von Taboris persönlicher Geschichte als Überlebender auf seine Theaterarbeit
- Taboris Kritik an bestehenden Normen im Umgang mit deutscher Geschichte
- Die Einordnung von Taboris Theater im Kontext des deutschsprachigen Bewältigungsdramas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Debatte um die Darstellbarkeit des Holocausts anhand des Films "Das Leben ist schön" von Roberto Benigni einführt und die Relevanz von Taboris Theaterarbeit in diesem Kontext beleuchtet. Kapitel 2 skizziert die theoretischen Voraussetzungen für das Verständnis von Holocaust-Literatur und gibt einen Überblick über das deutschsprachige Bewältigungsdrama der Nachkriegszeit, das den kontextuellen Rahmen für Taboris Dramen liefert. Kapitel 3 widmet sich der Analyse des Grotesken und des Witzes in Taboris Dramen "Die Kannibalen", "Jubiläum" und "Mein Kampf", wobei die Analysegegenstände Groteske und Witz theoretisch erläutert werden. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4 zusammengefasst und ausgewertet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Holocaust, Darstellbarkeit, Groteske, Witz, Tabori, Bewältigungsdrama, deutschsprachiges Theater, Nachkriegszeit, Erinnerungskultur.
Häufig gestellte Fragen
Darf man den Holocaust in einer Komödie darstellen?
Die Arbeit untersucht diese Debatte am Beispiel von George Tabori und Roberto Benigni und fragt, ob Groteske und Witz angemessene Mittel zur Darstellung von Auschwitz sind.
Welche Holocaust-Stücke von George Tabori werden analysiert?
Analysiert werden die Dramen „Die Kannibalen“, „Jubiläum“ und „Mein Kampf“.
Was ist das Besondere an Taboris Theaterarbeit?
Tabori nutzt als Überlebender bewusst Groteske und Witz, um bestehende Normen der deutschen „Bewältigungskultur“ zu kritisieren und das Unsagbare sagbar zu machen.
Was kritisierte Adorno an der Holocaust-Literatur?
Theodor W. Adorno stellte die berühmte Frage nach der Möglichkeit von Lyrik nach Auschwitz und warnte vor einer ästhetischen Verklärung des Grauens.
Was bedeutet „Bewältigungsdrama“?
Es bezeichnet deutschsprachige Theaterstücke nach 1945, die versuchten, die Zeit des Nationalsozialismus und den Holocaust künstlerisch aufzuarbeiten.
Wie wird „Witz“ in Taboris Stücken eingesetzt?
Der Witz dient bei Tabori nicht der Verharmlosung, sondern als Mittel zur Distanzierung und zur Aufdeckung der absurden Logik der Vernichtung.
- Arbeit zitieren
- M.A. Dietmar Zeilinger (Autor:in), 2002, George Taboris Holocaust-Stücke im Kontext deutscher Bewältigungsdramen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50903