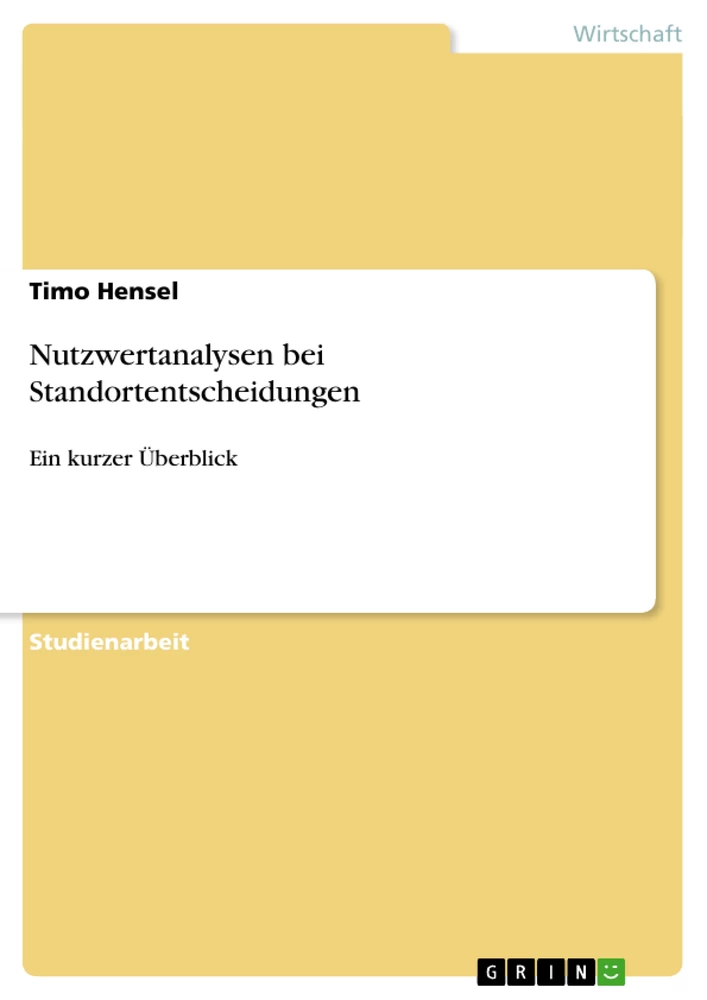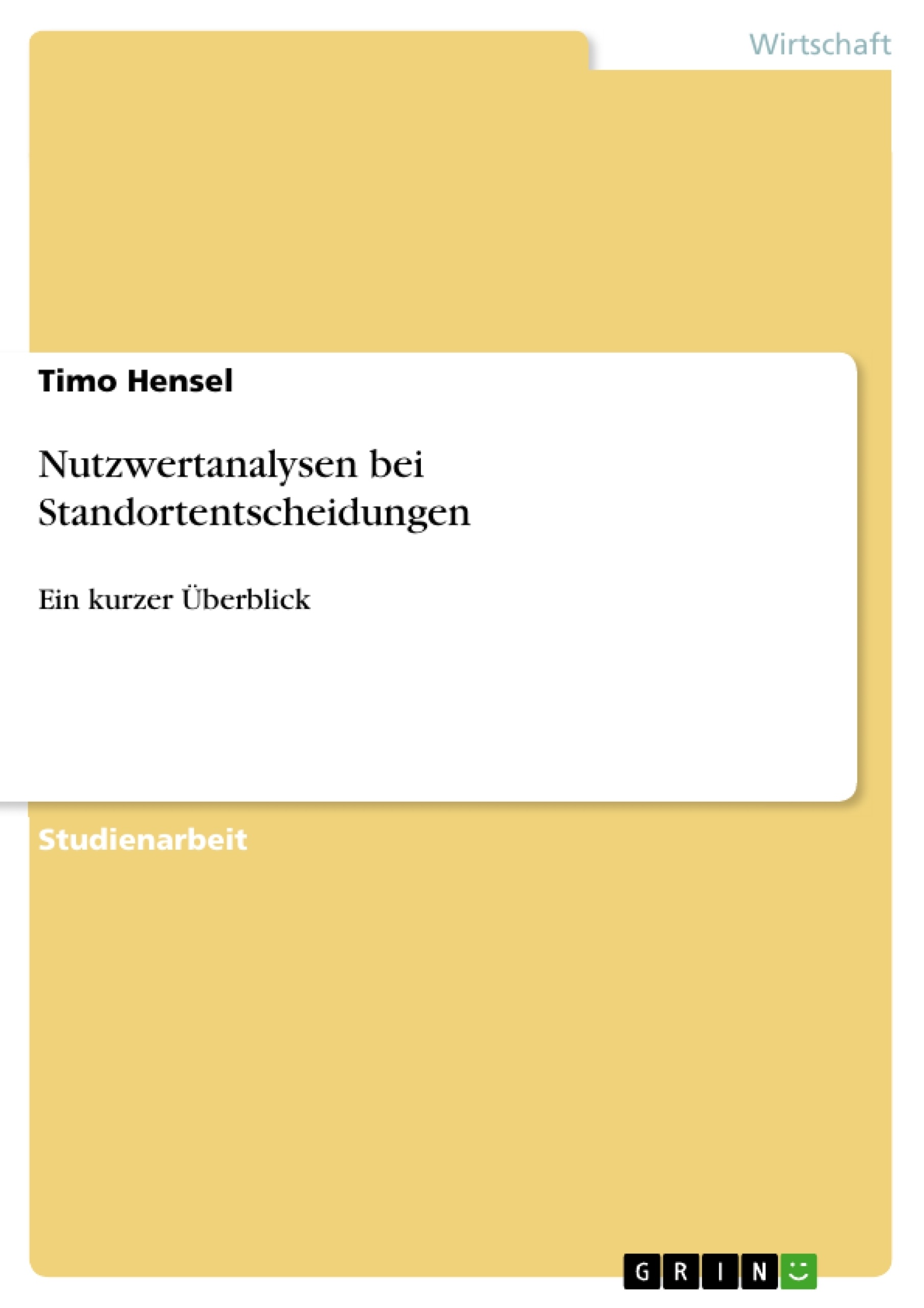Die Standortentscheidung hat in den letzten Jahren nachhaltig an Bedeutung gewonnen. Insbesondere seit die zunehmende Globalisierung und die damit verbundenen politischen Veränderungen die Ländergrenzen zunehmend in den Hintergrund rücken ließen und die Weiterentwicklung der Transport- und Informationssysteme die Überwindung von großen Entfernungen zwischen verschiedenen Standorten erleichtert haben, stehen den heutigen Unternehmen weltweite Standortalternativen zur Verfügung.
Auch innerhalb eines Landes sollte der Suche nach einem Standort ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet werden, da sie eine unternehmerische Entscheidung darstellt, die wie die Wahl der Rechtsform den Aufbau und die Entwicklung des Betriebes mitbestimmt. Durch Grundstücks- und Baupreise hat sie direkten Einfluss auf die Investitionskosten und bestimmt auf Dauer Kostengrößen wie Transportkosten, Regionalabgaben und Löhne. Somit hat die Wahl eines Standortes einen langfristigen Charakter, kann den Erfolg eines Unternehmens nachhaltig positiv wie auch negativ beeinflussen und ist nur schwer, und meist verbunden mit hohen Kosten, revidierbar.
Die nachfolgende Ausführung soll zeigen, wie mit Hilfe der Nutzwertanalyse bei der Standortsuche vorgegangen werden kann und wie möglichst alle wichtigen gewünschten Eigenschaften eines Standortes bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollten. Da die Standortwahl das zu Grunde liegende Problem ist, wird sich diese Hausarbeit zunächst mit dem Standort an sich befassen, bevor sie auf die Möglichkeiten der Lösungsfindung, bzw. die Anwendung der Nutzwertanalyse eingeht. Nach einem kurzen Überblick über die zwei grundlegenden historischen Standorttheorien wird erläutert, was unter dem Begriff der Standortwahl verstanden wird und welche Faktoren hierbei von Bedeutung sein können. Gerade für diese Faktoren haben sich sehr unterschiedliche Modelle mit differierenden Einteilungen entwickelt. Diese Arbeit legt aus- Nutzwertanalysen bei Standortentscheidungen schließlich eine sich an Behrens orientierte Gliederung der Standortfaktoren nach Beschaffung, Fertigung und Absatz zu Grunde. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Standortwahl als Entscheidungsproblem
- Grundlegende Theorien
- von Thünen
- Weber
- Begriff und Wesen
- Standortfaktoren
- Entscheidungmodelle bei Standortwahlen
- Grundlegende Theorien
- Nutzwertanalyse als Teil der Standortwahl
- Merkmale und Vorgehensweise
- Beispiel einer Nutzwertanalyse
- Kritische Auseinandersetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung der Nutzwertanalyse bei Standortentscheidungen. Sie erläutert die grundlegenden Theorien der Standortwahl und beleuchtet die relevanten Standortfaktoren. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Nutzwertanalyse als Entscheidungsmodell für die Standortwahl, wobei ein fiktives Beispiel zur Veranschaulichung dient. Schließlich werden kritische Aspekte der Nutzwertanalyse im Kontext der Standortwahl beleuchtet.
- Grundlegende Theorien der Standortwahl (von Thünen, Weber)
- Relevante Standortfaktoren und deren Klassifizierung
- Nutzwertanalyse als Entscheidungsmodell
- Anwendung der Nutzwertanalyse bei der Standortwahl (inkl. Beispiel)
- Kritik an der Nutzwertanalyse im Kontext der Standortentscheidung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung der Standortentscheidung für Unternehmen in der heutigen Zeit heraus und erläutert den Zusammenhang zwischen Standortwahl und unternehmerischem Erfolg. Sie führt den Leser in das Thema der Nutzwertanalyse als Instrument zur Entscheidungsfindung bei der Standortsuche ein.
- Standortwahl als Entscheidungsproblem: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln der Standortwahl, indem es die Theorien von Thünen und Weber vorstellt. Es definiert den Begriff der Standortwahl, erläutert die Bedeutung der Standortfaktoren und stellt verschiedene Entscheidungmodelle im Kontext der Standortwahl vor.
- Nutzwertanalyse als Teil der Standortwahl: Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale und die Vorgehensweise bei der Anwendung der Nutzwertanalyse bei der Standortentscheidung. Es legt den Fokus auf die Bestimmung und Gewichtung von Zielkriterien, die Ermittlung des Teilnutzens und die Berechnung des Nutzwerts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Standortentscheidung, Nutzwertanalyse, Standortfaktoren, Entscheidungstheorie, Betriebswirtschaftslehre, von Thünen, Weber, Behrens, Globalisierung, Transportkosten, Investitionskosten, Kostendruck, Unternehmensgründung, Expansion, Innovation, Marktmotiv, Kapazitätsmotiv, Innovationsmotiv, Auslagerungsmotiv, Kostendruckmotiv.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Standortentscheidung für Unternehmen so wichtig?
Sie hat langfristigen Charakter, beeinflusst Investitions- und Betriebskosten (Transport, Löhne) maßgeblich und ist meist nur mit hohem Aufwand revidierbar.
Wie hilft die Nutzwertanalyse bei der Standortwahl?
Die Nutzwertanalyse ermöglicht es, verschiedene Standortalternativen anhand gewichteter qualitativer und quantitativer Kriterien vergleichbar zu machen.
Welche historischen Standorttheorien werden erwähnt?
Die Arbeit gibt einen Überblick über die klassischen Theorien von Johann Heinrich von Thünen und Alfred Weber.
Nach welchen Kategorien lassen sich Standortfaktoren gliedern?
Die Arbeit orientiert sich an der Gliederung nach Behrens: Beschaffung, Fertigung und Absatz.
Was sind typische Motive für eine Standortwahl?
Dazu zählen das Marktmotiv, Kapazitätsmotiv, Innovationsmotiv sowie Kostendruck- und Auslagerungsmotive.
Welche Kritik gibt es an der Nutzwertanalyse?
Kritische Aspekte sind die oft subjektive Gewichtung der Kriterien und die Schwierigkeit, alle weichen Faktoren präzise in Zahlenwerten auszudrücken.
- Citation du texte
- Timo Hensel (Auteur), 2005, Nutzwertanalysen bei Standortentscheidungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50931