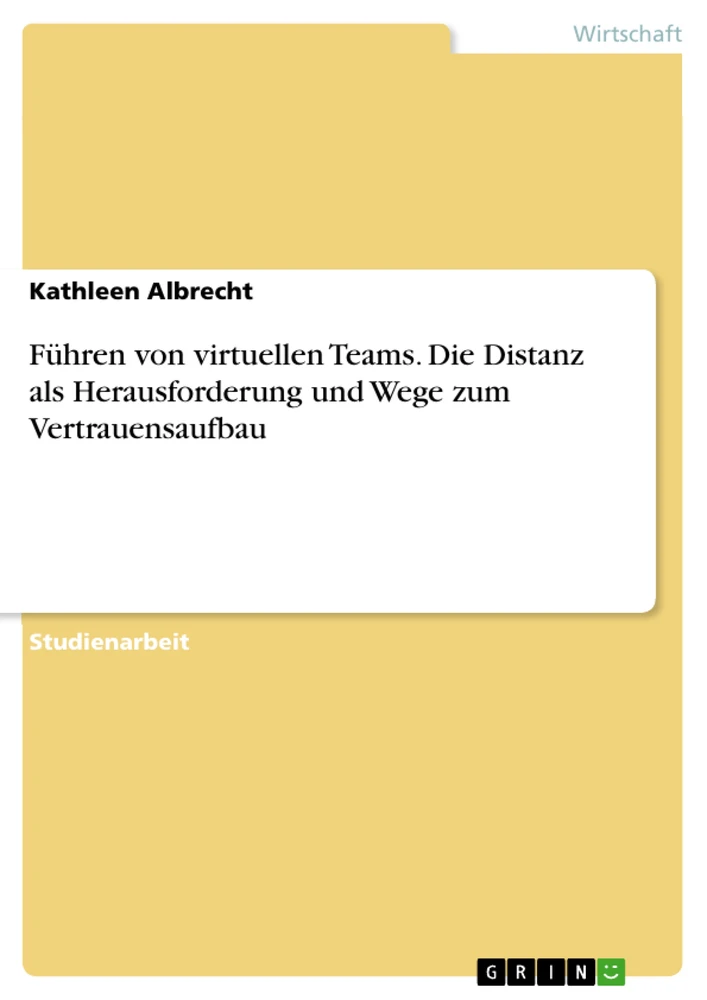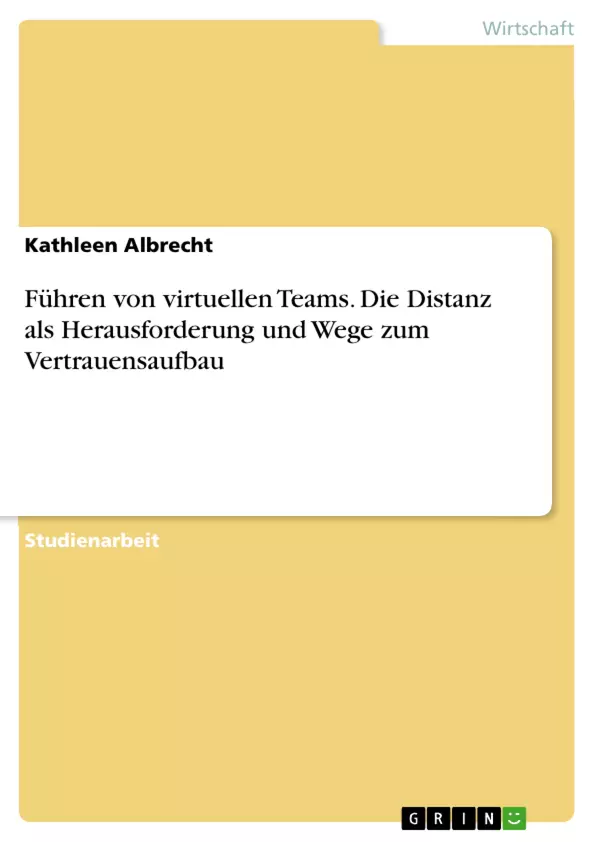Diese Arbeit behandelt das Thema "Führen von virtuellen Teams", da die Autorin selbst in einem international agierenden Informations- und Telekommunikationsunternehmen tätig ist und ihr dort immer häufiger virtuelle Teams begegnen.
Die Autorin möchte mit dieser Arbeit belegen, dass Führung von virtuellen Teams möglich ist. Diese Teams haben die gleichen Aufgaben an verschiedenen Standorten. Es stellt sich die Frage, wie Vertrauen auf Distanz aufgebaut werden kann, obwohl die Führungskraft nicht wie früher am gleichen Arbeitsort tätig ist und meist nur virtuell feststellen kann, was der Mitarbeiter tatsächlich leistet. Außerdem wird darauf eingegangen, wie Führungskräfte aus einem virtuellen Team ein richtiges Team machen und auch eine regelmäßige Kommunikation aufrechterhalten können und welche Lösungen es gibt, um mit Konflikten umzugehen.
Nachdem zunächst lokale Teams von "virtuellen Teams" abgegrenzt werden, wird anschließend die Abgrenzung von Führung zu "virtueller Führung" vorgenommen. Dabei wird deutlich, dass virtuelle Teams über wesentliche Vorteile verfügen, aber die Führung auch einige Herausforderungen mit sich bringt. Um darzustellen, dass die Führung virtueller Teams möglich ist, geht die Autorin im nächsten Kapitel auf die Führung ein.
Da die Distanz eine Herausforderung für alle Teammitglieder darstellt, schildert die Autorin, wie ein Vertrauensaufbau in virtuellen Teams funktionieren und die Teamentwicklung gestaltet werden kann. Anschließend wird in dieser Arbeit dargestellt, wie der Arbeitsalltag virtueller Teams geregelt werden sollte, welche Möglichkeiten der Kommunikation bestehen und wie mit Konflikten umgegangen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgrenzung der Begriffe
- Teams und „virtuelle Teams“
- Führung und „Führung virtueller Teams“
- Führung von virtuellen Teams
- Distanz als Herausforderung
- Wege zum Vertrauensaufbau
- Förderung der Teamentwicklung
- Der Arbeitsalltag
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Führung von virtuellen Teams im Kontext der digitalen Transformation von Unternehmen. Ziel ist es aufzuzeigen, dass erfolgreiche Führung in virtuellen Teams möglich ist, trotz der Herausforderungen durch räumliche Distanz und die ausschließliche oder überwiegende Kommunikation über digitale Medien. Die Arbeit beleuchtet Wege zum Vertrauensaufbau, zur Förderung der Teamentwicklung und zur Gestaltung des Arbeitsalltags in virtuellen Teams.
- Abgrenzung von lokalen und virtuellen Teams
- Herausforderungen der Führung in virtuellen Teams
- Strategien zum Vertrauensaufbau in virtuellen Teams
- Förderung der Teamentwicklung in der virtuellen Umgebung
- Gestaltung des Arbeitsalltags in virtuellen Teams
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Führung virtueller Teams“ ein und begründet die Relevanz der Arbeit im Kontext der digitalen Transformation von Unternehmen. Sie beschreibt den Arbeitskontext der Autorin und formuliert die Forschungsfrage, wie Vertrauen auf Distanz aufgebaut und ein funktionierendes Team in einer virtuellen Umgebung geschaffen werden kann. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die zu behandelnden Aspekte, wie die Abgrenzung der Begriffe, die Herausforderungen der Distanz und die Gestaltung des Arbeitsalltags virtueller Teams.
Abgrenzung der Begriffe: Dieses Kapitel differenziert zwischen lokalen und virtuellen Teams, wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Aufgaben, Ziele und Verantwortlichkeiten herausgearbeitet werden. Es werden die Vorteile virtueller Teams bezüglich der Personalauswahl, der Flexibilität und der Kosteneffizienz hervorgehoben. Der Fokus liegt auf den spezifischen Kommunikations- und Informationstechnologien, die für das Funktionieren virtueller Teams unerlässlich sind und die sich von den Kommunikationsmethoden in lokalen Teams unterscheiden. Die Autorin betont die Bedeutung der effektiven Informationsweitergabe und -vermittlung in virtuellen Teams und die Notwendigkeit spezifischer Regeln für die Kommunikation über digitale Medien.
Führung von virtuellen Teams: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen der Führung virtueller Teams und stellt verschiedene Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen vor. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung des Vertrauensaufbaus, der Förderung der Teamentwicklung und der Gestaltung des Arbeitsalltags unter Berücksichtigung der räumlichen Distanz. Es werden Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Kommunikation, zum Umgang mit Konflikten und zur Organisation von Präsenzmeetings beleuchtet, um ein funktionierendes und leistungsstarkes Team zu gewährleisten. Die Autorin analysiert, wie Führungskräfte die Zusammenarbeit innerhalb des Teams effektiv steuern und koordinieren können, trotz der Herausforderungen der virtuellen Umgebung.
Schlüsselwörter
Virtuelle Teams, Führung, digitale Transformation, Distanz, Vertrauen, Teamentwicklung, Kommunikation, Informationstechnologie, Konflikte, Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Führung Virtueller Teams
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Führung virtueller Teams. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen der Führung auf Distanz und Strategien zum Aufbau von Vertrauen und zur Förderung der Teamentwicklung in virtuellen Umgebungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Abgrenzung von lokalen und virtuellen Teams, die Herausforderungen der Führung in virtuellen Teams (insbesondere die Distanz), Strategien zum Vertrauensaufbau, die Förderung der Teamentwicklung in virtuellen Umgebungen und die Gestaltung des Arbeitsalltags in virtuellen Teams. Es werden spezifische Kommunikations- und Informationstechnologien sowie der Umgang mit Konflikten beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Abgrenzung der Begriffe "Teams" und "virtuelle Teams" sowie "Führung" und "Führung virtueller Teams", ein Kapitel zur Führung von virtuellen Teams mit den Unterpunkten Distanz als Herausforderung, Wege zum Vertrauensaufbau, Förderung der Teamentwicklung und der Arbeitsalltag, und schließlich eine Schlussbemerkung.
Wie wird der Vertrauensaufbau in virtuellen Teams behandelt?
Die Arbeit widmet sich ausführlich dem Thema Vertrauensaufbau in virtuellen Teams. Es werden Strategien und Möglichkeiten aufgezeigt, wie trotz räumlicher Distanz Vertrauen geschaffen und gepflegt werden kann. Dies ist ein zentraler Aspekt für die erfolgreiche Führung und Zusammenarbeit in virtuellen Teams.
Welche Herausforderungen der Führung virtueller Teams werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Herausforderungen der Führung virtueller Teams, darunter die Bewältigung der räumlichen Distanz, der ausschließlichen oder überwiegenden Kommunikation über digitale Medien, der Umgang mit Konflikten und die Organisation der Zusammenarbeit. Es werden Lösungsansätze und Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant zusammenfassen, sind: Virtuelle Teams, Führung, digitale Transformation, Distanz, Vertrauen, Teamentwicklung, Kommunikation, Informationstechnologie, Konflikte, Zusammenarbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, aufzuzeigen, dass erfolgreiche Führung in virtuellen Teams trotz der Herausforderungen durch räumliche Distanz und digitale Kommunikation möglich ist. Sie präsentiert Wege zum Vertrauensaufbau, zur Förderung der Teamentwicklung und zur Gestaltung eines funktionierenden Arbeitsalltags in virtuellen Teams.
Wie werden lokale und virtuelle Teams abgegrenzt?
Das Kapitel zur Abgrenzung der Begriffe differenziert zwischen lokalen und virtuellen Teams hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf Aufgaben, Ziele, Verantwortlichkeiten und Kommunikationsmethoden. Die Vorteile virtueller Teams bezüglich Personalauswahl, Flexibilität und Kosteneffizienz werden ebenfalls hervorgehoben.
Wie wird die Teamentwicklung in virtuellen Teams gefördert?
Die Arbeit beschreibt Strategien und Methoden zur Förderung der Teamentwicklung in virtuellen Teams. Dies umfasst Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Kommunikation, zum Umgang mit Konflikten und zur Organisation von Präsenzmeetings, um ein funktionierendes und leistungsstarkes Team zu gewährleisten.
Wie wird der Arbeitsalltag in virtuellen Teams gestaltet?
Die Arbeit behandelt die Gestaltung des Arbeitsalltags in virtuellen Teams, indem sie Möglichkeiten zur effektiven Kommunikation, Koordination und Steuerung der Zusammenarbeit trotz der räumlichen Distanz beleuchtet. Es werden praktische Ansätze zur Organisation und Optimierung des Arbeitsablaufs in virtuellen Teams vorgestellt.
- Arbeit zitieren
- Kathleen Albrecht (Autor:in), 2018, Führen von virtuellen Teams. Die Distanz als Herausforderung und Wege zum Vertrauensaufbau, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509679