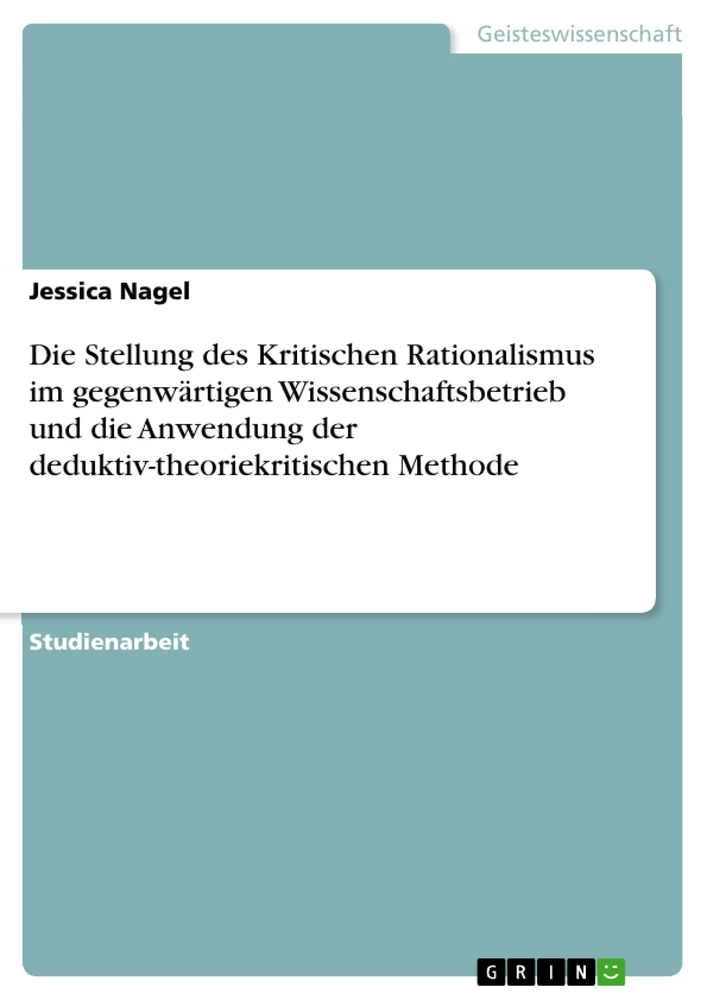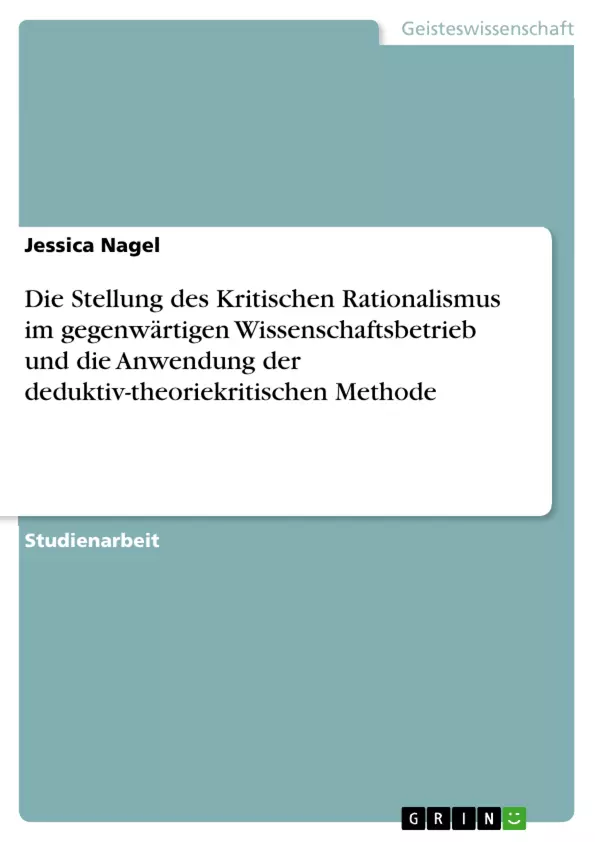Das Finalziel dieser Arbeit ist es, die Stellung des Kritischen Rationalismus im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb bewerten zu können. Dafür wird zunächst die Grundidee des Kritischen Rationalismus erläutert sowie die konkrete Anwendung der deduktiv-theoriekritischen Methode anhand einer zuvor formulierten All-Aussage erläutert. Diese Aussage muss den Anforderungen des Kritischen Rationalismus genügen. Aus den Ergebnissen dieser Modalziele kann dann die Stellung des Kritischen Rationalismus anhand einer Kritischen Betrachtung dieser Methode erarbeitet werden.
Es liegt in der Natur des Menschen, Begründungen für aufgestellte Theorien zu sammeln und danach zu streben, diese zu verifizieren. Damit die Wissenschaft an Erkenntnisse gelangt, gibt es verschiedene wissenschaftliche Methoden. Eine der wichtigsten wissenschaftstheoretischen Methoden des 20. Jahrhunderts ist der Kritische Rationalismus, welcher von Karl Raimund Popper begründet wurde. Der Kritische Rationalismus ist eine Erkenntnistheorie, die vor allem durch die deduktiv-theoriekritische Methode geprägt wurde. Eine Theorie wird hierbei immer Kritisch betrachtet und kann niemals verifiziert, jedoch durch eine einzelne Aussage falsifiziert werden. Die Anwendung der deduktiv-theoriekritischen Methode sowie deren Stellung im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb sollen in der vorliegenden Ausarbeitung behandelt werden.
Um die Grundlagen für das Verständnis der Arbeit zu schaffen, werden zunächst die zentralen Begriffe Theorie, Empirismus und Rationalismus sowie Verifikation und Falsifikation definiert. Aus der Definition dieser Begriffe werden im Hauptteil der Kritische Rationalismus sowie die deduktiv-theoriekritische Methode definiert. Darauf aufbauend wird die Anwendung dieser Methode anhand einer vorher formulierten Theorie gezeigt sowie das Zusammenspiel der bereits definierten Begriffe Empirie, Theorie, Verifikation und Falsifikation im Detail erläutert. Nachdem der Kritische Rationalismus als solcher betrachtet wurde, kann eine Aussage über die Stellung des Kritischen Rationalismus im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb getroffen werden. Zum Schluss werden die Methode des Kritischen Rationalismus sowie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit Kritisch betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen
- Theorie
- Empirismus und Rationalismus
- Verifikation und Falsifikation
- Kritischer Rationalismus
- Grundidee des Kritischen Rationalismus
- Anwendung der deduktiv-theoriekritischen Methode
- Stellung des kritischen Rationalismus
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Kritischen Rationalismus und seine Rolle im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb. Die Arbeit erörtert die Grundidee des Kritischen Rationalismus, die Anwendung der deduktiv-theoriekritischen Methode und die Bedeutung des Kritischen Rationalismus im wissenschaftlichen Kontext.
- Erklärung der Grundidee des Kritischen Rationalismus
- Anwendung der deduktiv-theoriekritischen Methode anhand einer konkreten Aussage
- Bewertung der Bedeutung des Kritischen Rationalismus im heutigen Wissenschaftsbetrieb
- Definition der zentralen Begriffe Theorie, Empirismus, Rationalismus, Verifikation und Falsifikation
- Untersuchung der Stellung des Kritischen Rationalismus im Vergleich zu anderen Erkenntnistheorien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das Kapitel „Grundlagen“ definiert die zentralen Begriffe Theorie, Empirismus, Rationalismus, Verifikation und Falsifikation. Im Kapitel „Kritischer Rationalismus“ wird die Grundidee des Kritischen Rationalismus erläutert und die deduktiv-theoriekritische Methode anhand einer konkreten Aussage demonstriert. Die Bedeutung des Kritischen Rationalismus im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Kritischer Rationalismus, Deduktiv-Theoriekritische Methode, Verifikation, Falsifikation, Empirismus, Rationalismus, Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie, Theorie, All-Aussage, Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn, Wissenschaftsbetrieb.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Grundidee des Kritischen Rationalismus?
Begründet von Karl Popper, besagt er, dass Theorien niemals endgültig verifiziert, sondern nur durch Falsifikation widerlegt werden können.
Wie funktioniert die deduktiv-theoriekritische Methode?
Man leitet aus einer Theorie spezifische Vorhersagen ab und versucht, diese durch empirische Beobachtungen zu widerlegen (Falsifikation).
Was ist der Unterschied zwischen Verifikation und Falsifikation?
Verifikation sucht nach Bestätigung einer Theorie, während Falsifikation nach dem Gegenbeweis sucht, um wissenschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt die Empirie im Kritischen Rationalismus?
Die Empirie dient als Prüfinstanz, um Theorien an der Realität zu messen und fehlerhafte Annahmen auszusortieren.
Warum kann eine "All-Aussage" niemals verifiziert werden?
Da man niemals alle möglichen Fälle (z.B. alle Schwäne weltweit) beobachten kann, reicht eine einzige gegenteilige Beobachtung zur Widerlegung aus.
- Quote paper
- Jessica Nagel (Author), 2017, Die Stellung des Kritischen Rationalismus im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb und die Anwendung der deduktiv-theoriekritischen Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509774