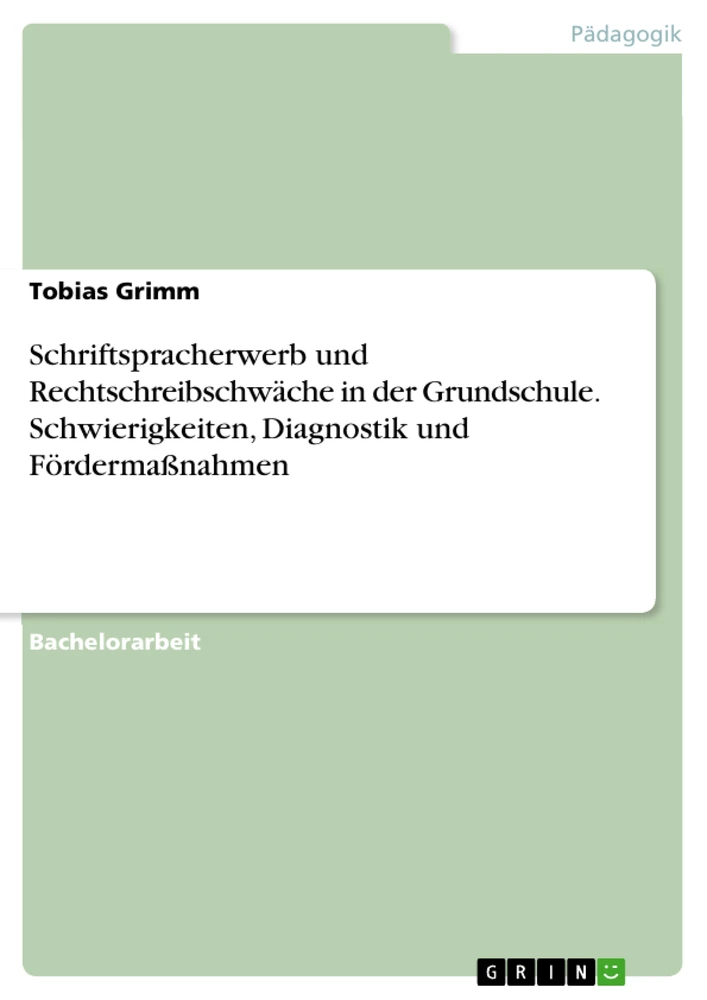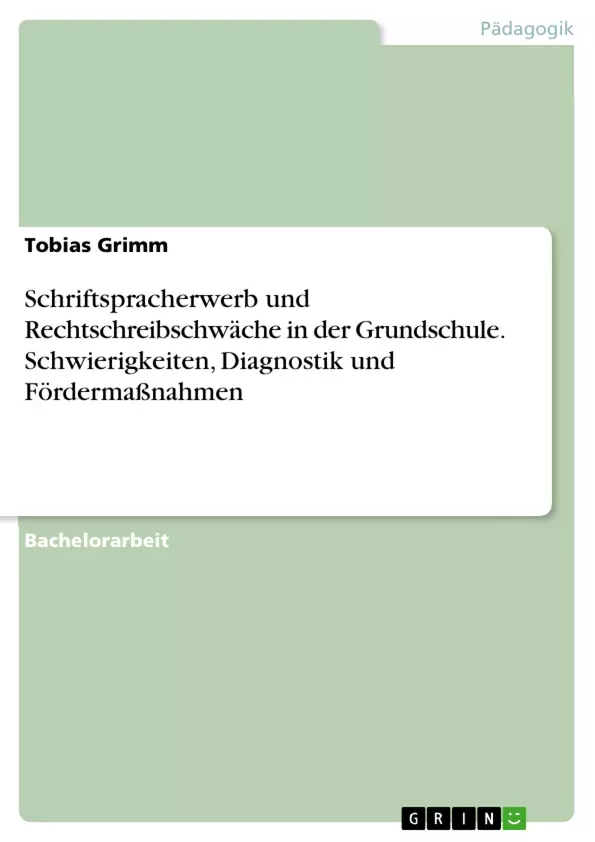Diese Bachelorarbeit setzt sich mit den Fragen auseinander, welche Bereiche Schülerinnen und Schüler vor besondere Schwierigkeiten stellen, wie sich die orthographische Kompetenz diagnostizieren lässt und darüber hinaus, welche Maßnahmen anschließend ergriffen werden müssen, beziehungsweise können.
Schreiben ist wichtig in allen Bereichen und für die Teilhabe an der Gesellschaft. Insofern kommt seiner sorgfältigen Vorbereitung eine besonders hohe Bedeutung zu. Aufgrund dieses hohen Stellenwertes zählt das Schreibenlernen zu den zentralen Lernschwerpunkten in der Grundschule. Jedoch stellt der Schriftspracherwerb die Kinder vor eine große Herausforderung. Die Ergebnisse der IQB1-Studie 2016 unterstreichen dies. Auf Länderebene wurde die Orthographiekompetenz von SuS der vierten Klassenstufe ermittelt. Lediglich 54 % erreichten den Regelstandard und 22 % verfehlten sogar die Mindestanforderungen. Diese Tatsache bedeutet, aufgrund der zentralen Rolle bei der Schaffung eines an dem Ideal der Bildungsgerechtigkeit orientierten Schulsystems, eine genauere Betrachtung der Thematik.
Zunächst sollen theoretische Grundkenntnisse vermittelt werden, Kapitel II widmet sich daher zuerst der näheren Betrachtung der Disziplinen der Graphematik und Orthographie als Funktionsweise und Normierung der Schrift. Anschließend soll im Hinblick auf den Prozess des Schriftspracherwerbs, die Rolle der Phonologischen Bewusstheit, sowohl als Vorläuferfähigkeit, als auch als Begleitprozess, herausgestellt werden. Ferner sollen die Schwierigkeiten und deren Ursachen ausgearbeitet werden. Hierzu werden sowohl konkrete Problemfelder der Schriftsprache als auch Störungen als Ausgangslage des Kindes und didaktisch bedingte Schwierigkeiten dargelegt.
Der empirische Teil dient der konkreten Auseinandersetzung mit orthographischer Kompetenz anhand einer zweiten Klasse. Es folgt eine Untersuchung, einer Diagnose von Rechtschreibkompetenz im Sinne eines Lernstandsberichtes einer ganzen Klasse, aber auch auf individueller Ebene, als mögliche Vorbereitung von Fördermaßnahmen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden zunächst auf Klassenebene, danach auf individueller Ebene dargestellt und anschließend diskutiert. Im abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst, das Diagnoseinstrument kurz reflektiert und weiterführende Fragen als Ausblick generiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretischer Rahmen
- 1. Theoretische Grundlagen zur Schriftsprache
- 1.1 Graphematik - Wie funktioniert unsere Schrift?
- 1.1.1 Phonographisches Prinzip
- 1.1.2 Silbisches Prinzip
- 1.1.3 Morphematisches Prinzip
- 1.1.4 Grammatisches Prinzip
- 1.2 Orthographie - Wie funktioniert unsere Rechtschreibung?
- 2. Schriftspracherwerb
- 2.1 Phonologische Bewusstheit als Vorläuferfertigkeit
- 2.2 Das Stufenmodell nach Valtin (1997)
- 3. Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb
- 3.1 Merkmale und Ursachen
- 3.1.1 Komplexe Beziehung zwischen Phonologie und Graphematik
- 3.1.2 Orthographischen Prinzipien
- 3.1.3 Wahrnehmungsschwierigkeiten
- 3.1.4 Didaktische Zugangswege
- 3.2 LRS vs. Legasthenie
- 4. Diagnostik
- 5. Schulische Fördermaßnahmen
- 5.1 Mögliche Übungen im Unterricht
- 5.2 Die silbenanalytische Methode nach Röber (2006)
- III. Empirischer Teil
- 1. Die Oldenburger Fehleranalyse als Methode
- 2. Begründung der Verfahrensauswahl
- 3. Stichprobe und Forschungsdesign
- 4. Versuchsmaterial
- 5. Ablauf
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Auswertung der OLFA auf Klassenebene
- 6.2 Auswertung der OLFA auf individueller Ebene
- 7. Diskussion
- IV. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb und der Rechtschreibung bei Grundschulkindern. Ziel ist es, häufige Problemfelder zu identifizieren, geeignete Diagnoseverfahren vorzustellen und effektive Fördermaßnahmen zu beschreiben. Die Arbeit berücksichtigt dabei sowohl theoretische Grundlagen als auch empirische Ergebnisse.
- Theoretische Grundlagen des Schriftspracherwerbs und der Rechtschreibung
- Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb: Ursachen und Merkmale
- Diagnostik von Rechtschreibschwächen
- Schulische Fördermaßnahmen bei Rechtschreibschwächen
- Empirische Untersuchung der Rechtschreibkompetenz in einer zweiten Klasse
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung des Schriftspracherwerbs für den Lernerfolg und die gesellschaftliche Teilhabe. Sie verweist auf die Ergebnisse der IQB-Studie, die einen deutlichen Rückgang der Orthographiekompetenz bei Grundschulkindern aufzeigt und begründet damit die Notwendigkeit der vorliegenden Arbeit. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb, Diagnosemethoden und Fördermaßnahmen an. Die Struktur der Arbeit wird skizziert, wobei der theoretische und der empirische Teil klar voneinander abgegrenzt werden.
II. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen zum Verständnis des Schriftspracherwerbs und der damit verbundenen Schwierigkeiten. Es werden die Graphematik und Orthographie der deutschen Sprache erläutert, die phonologische Bewusstheit als Vorläuferfähigkeit des Schriftspracherwerbs beleuchtet und ein Stufenmodell des Schriftspracherwerbs vorgestellt. Schließlich werden verschiedene Schwierigkeiten und ihre Ursachen detailliert beschrieben, inklusive der Unterscheidung zwischen Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) und Legasthenie.
III. Empirischer Teil: Der empirische Teil beschreibt eine Untersuchung der Rechtschreibkompetenz in einer zweiten Klasse mithilfe der Oldenburger Fehleranalyse (OLFA). Die Methode wird detailliert erläutert und die Auswahl der Stichprobe sowie das Forschungsdesign begründet. Der Ablauf der Untersuchung wird dargestellt. Die Ergebnisse der OLFA werden sowohl auf Klassen- als auch auf individueller Ebene ausgewertet und analysiert – aber nicht im Detail vorgestellt um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Rechtschreibschwäche, LRS, Legasthenie, Diagnostik, Förderung, Orthographie, Graphematik, Phonologische Bewusstheit, Oldenburger Fehleranalyse (OLFA), Grundschule, Bildungsgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb und der Rechtschreibung bei Grundschulkindern. Sie identifiziert häufige Problemfelder, stellt geeignete Diagnoseverfahren vor und beschreibt effektive Fördermaßnahmen. Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit empirischen Ergebnissen.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil behandelt die Grundlagen des Schriftspracherwerbs und der Rechtschreibung. Er erläutert die Graphematik und Orthographie der deutschen Sprache, die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit, und stellt ein Stufenmodell des Schriftspracherwerbs vor. Ausführlich werden verschiedene Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb und deren Ursachen beschrieben, inklusive der Unterscheidung zwischen Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) und Legasthenie.
Welche Methode wird im empirischen Teil verwendet?
Der empirische Teil der Arbeit untersucht die Rechtschreibkompetenz in einer zweiten Klasse mithilfe der Oldenburger Fehleranalyse (OLFA). Die Methode wird detailliert beschrieben, ebenso die Auswahl der Stichprobe und das Forschungsdesign. Die Ergebnisse der OLFA werden sowohl auf Klassen- als auch auf individueller Ebene ausgewertet und analysiert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Oldenburger Fehleranalyse (OLFA) sowohl auf Klassen- als auch auf individueller Ebene. Um Spoiler zu vermeiden, werden die Ergebnisse nicht im Detail vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Schriftspracherwerb, Rechtschreibschwäche, LRS, Legasthenie, Diagnostik, Förderung, Orthographie, Graphematik, Phonologische Bewusstheit, Oldenburger Fehleranalyse (OLFA), Grundschule, Bildungsgerechtigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: I. Einleitung, II. Theoretischer Rahmen, III. Empirischer Teil und IV. Schluss. Der theoretische Rahmen umfasst detaillierte Erläuterungen zu Graphematik, Orthographie, Schriftspracherwerb und Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. Der empirische Teil beschreibt die durchgeführte Studie mit der Oldenburger Fehleranalyse (OLFA).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, häufige Problemfelder im Schriftspracherwerb zu identifizieren, geeignete Diagnoseverfahren vorzustellen und effektive Fördermaßnahmen zu beschreiben. Sie soll einen Beitrag zum besseren Verständnis von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb leisten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist klar strukturiert mit einer Einleitung, einem umfangreichen theoretischen Teil, einem empirischen Teil mit der Durchführung und Auswertung einer Studie mittels OLFA und einem abschließenden Kapitel. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern die Navigation.
Welche Bedeutung hat die IQB-Studie im Kontext dieser Arbeit?
Die Einleitung verweist auf die Ergebnisse der IQB-Studie, die einen deutlichen Rückgang der Orthographiekompetenz bei Grundschulkindern aufzeigt. Dies begründet die Notwendigkeit der vorliegenden Arbeit und unterstreicht die Relevanz des Themas.
Welche konkreten Fördermaßnahmen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Fördermaßnahmen, darunter die silbenanalytische Methode nach Röber (2006) und weitere mögliche Übungen im Unterricht. Diese Maßnahmen werden im Kontext der identifizierten Schwierigkeiten und Diagnoseverfahren vorgestellt.
- Citation du texte
- Tobias Grimm (Auteur), 2018, Schriftspracherwerb und Rechtschreibschwäche in der Grundschule. Schwierigkeiten, Diagnostik und Fördermaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509777