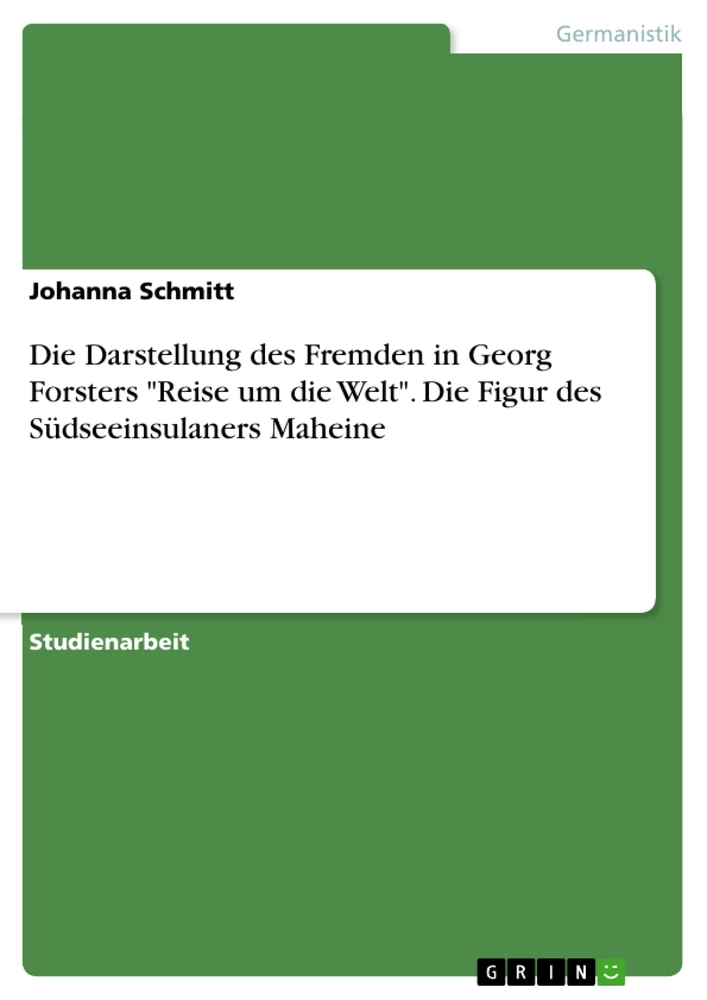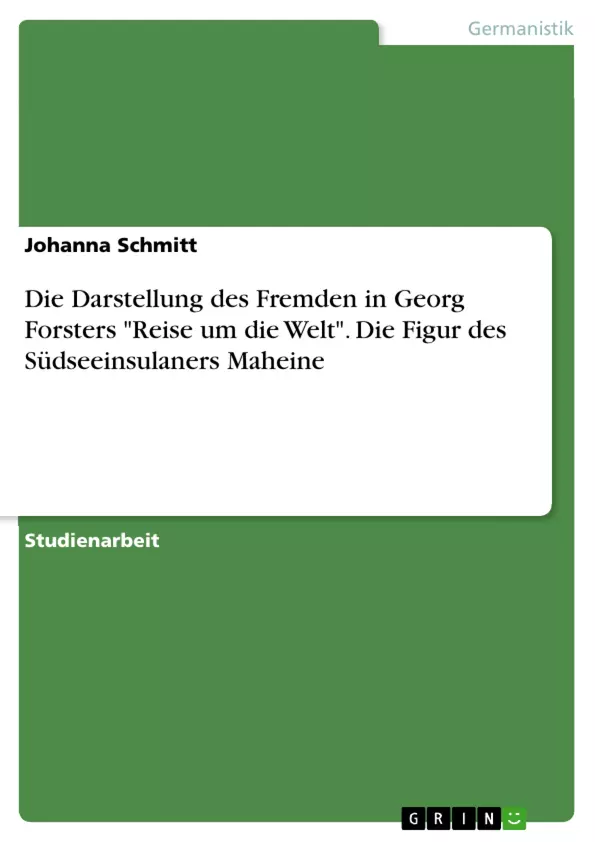Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Fremden in Georg Forsters "Reise um die Welt". Die Figur des Südseeinsulaners Maheine in Georg Forsters "Reise um die Welt" ist Repräsentant eben jener fremden Welt mit ihren Weltbildern und - anschauungen. Der von Forster kritisierte Zeitmangel, fremde Kulturen zu erforschen, ist hier nur bedingt gegeben, da der Südseeinsulaner Maheine eine Zeit auf engstem Raum mit den Seeleuten verbrachte. Aus diesem Grund erscheint unter anderem eine nähere Betrachtung dieser Figur interessant. Trotzdem ist der Rolle des Maheine bisher eher wenig Beachtung zuteil geworden. Zwar hat beispielsweise Michael Harbsmeier Kadu und Maheine in unterschiedlichen Aspekten verglichen, Johannes Gröbere Maheine als Alter Ego Forsters skizziert oder Takashi Mori diesen als Forsters "edlen Wilden" portraitiert, eine eingehende Auseinandersetzung der Figur und deren Funktion blieb aber bis auf kurze Überrisse aus.
In dieser Arbeit soll deswegen der Blick auf jenen Einwohner Bora-Boras gelenkt werden, der zumindest für eine Weile die Cook’sche Entdeckungsreise 1772-1775 begleitete. Dabei eröffnet Maheine Forster und den Rezipienten seines Reiseberichts die Möglichkeit, ein fremdes Denken in Bezug auf Wissenschaft, sozialem Verhalten sowie Begegnungen und den Umgang mit Unbekanntem zu erfahren, welches in dieser Arbeit herausgearbeitet werden soll. Zuerst soll die Frage, wie Fremdheit wahrgenommen und wie diese zugleich in Bezug auf das Eigene gesetzt wird, betrachtet werden. Wie gerade fremde Kulturen und deren Angehörige speziell in der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts, der Zeit der Aufklärung, der Wissenschaft und der Kolonialisierung, beschrieben wurden, soll dabei Berücksichtigung finden. Wie hat vor diesem Hintergrund der junge Wissenschaftler Georg Forster, der sich der Objektivität verpflichtet hat, in seinem Reisebericht einen der europäischen weit entfernten Kultur angehörigen Menschen portraitiert? Zieht Forster Schlüsse oder Reflexionen auf seine eigene Weltanschauung und macht er für sich selbst Entdeckungen aufgrund dieser Begegnung, und wenn ja welche? Diesem soll im Folgenden nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Blick in die Fremde in der Reiseliteratur
- Das Fremde in Bezug auf das Eigene
- Die Darstellung von Fremdheit aus eurozentrischer Perspektive
- Der „edle Wilde“
- Die Darstellung Georg Forsters des „Fremden“ Maheine in Reise um die Welt
- Charakterisierung
- Wissenschaftssystem und Forschung
- Begegnung-Kommunikation-Umgangsform
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Darstellung des „Fremden“ durch Georg Forster in seinem Werk „Reise um die Welt“, insbesondere am Beispiel des Südseeinsulaners Maheine. Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Fremdheit in der Reiseliteratur der Aufklärung und beleuchtet dabei die komplexe Beziehung zwischen Eigenem und Fremdem, die Rolle des „edlen Wilden“ und die eurozentrische Perspektive in der Beschreibung fremder Kulturen.
- Die Darstellung von Fremdheit in der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts
- Die Beziehung zwischen dem Eigenen und dem Fremden im Kontext der europäischen Aufklärung
- Die Darstellung des „edlen Wilden“ und seine Rolle in der Konstruktion von Fremdheit
- Die eurozentrische Perspektive in der Beschreibung fremder Kulturen
- Die Begegnung zwischen Georg Forster und dem Südseeinsulaner Maheine
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Thematik der Arbeit und beleuchtet die Besonderheiten von Weltreisen in der Zeit der Aufklärung, insbesondere im Kontext der Entdeckung der Südseeinseln. Sie stellt den Südseeinsulaner Maheine als zentralen Fokus der Untersuchung dar und erläutert die Bedeutung seiner Rolle im Werk Georg Forsters.
- Der Blick in die Fremde in der Reiseliteratur: Dieser Abschnitt erörtert die Wahrnehmung von Fremdheit in der Reiseliteratur der Aufklärung. Er analysiert die Beziehung zwischen dem Eigenen und dem Fremden, die Konstruktion von Fremdheit als Gegenbild zum Selbst und die Rolle der Ethnie als kulturelles Vergleichskriterium.
- Die Darstellung Georg Forsters des „Fremden“ Maheine in Reise um die Welt: In diesem Kapitel werden die Charakterisierung Maheines, die wissenschaftliche Perspektive auf ihn und die Darstellung von Begegnung, Kommunikation und Umgangsformen im Kontext der Reise erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Reiseliteratur, Fremdheit, Eurozentrismus, Aufklärung, „edler Wilder“, interkulturelle Begegnung, Südsee, Georg Forster, Maheine. Sie fokussiert auf die Konstruktion von Fremdheit in der Reiseliteratur und untersucht den Einfluss eurozentrischer Perspektiven auf die Darstellung von fremden Kulturen.
- Citation du texte
- Johanna Schmitt (Auteur), 2019, Die Darstellung des Fremden in Georg Forsters "Reise um die Welt". Die Figur des Südseeinsulaners Maheine, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509954