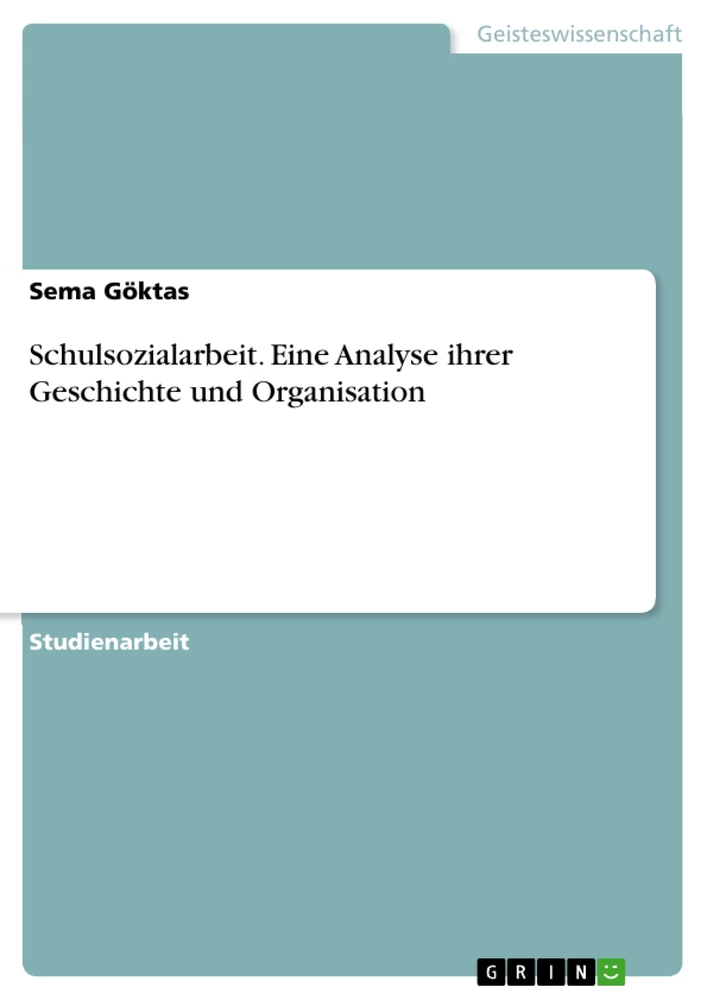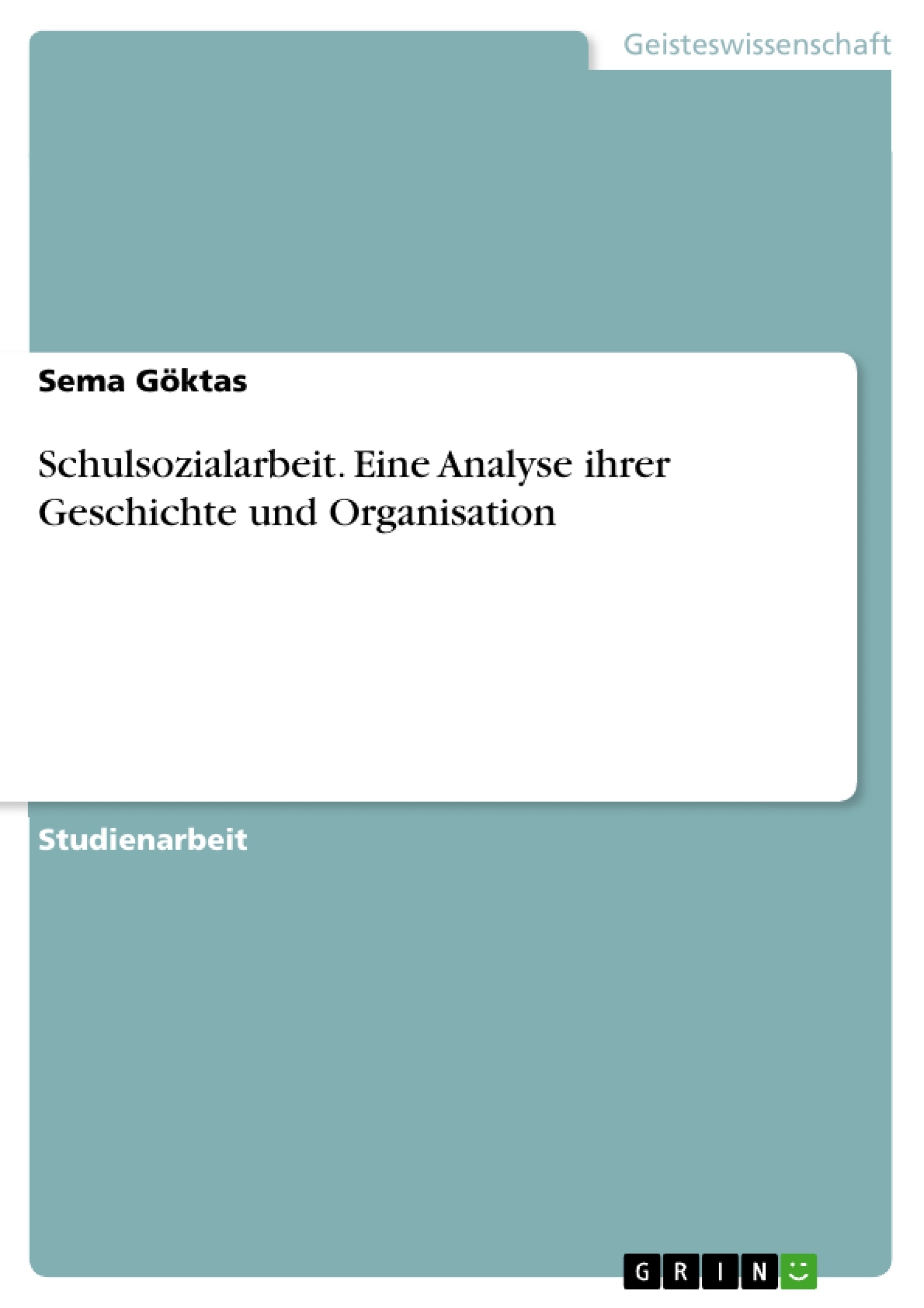In dieser Hausarbeit wird der Begriff der Schulsozialarbeit erklärt und der geschichtliche Hintergrund beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der historischen Entwicklung des Handlungsfeldes und den innerschulisch angewandten Methoden. Anschließend wird thematisch auf die Organisation des Handlungsfeldes eingegangen. Die Ziele und Zielgruppen, mit denen gearbeitet wird, sowie die Aufgaben und Leistungen der Schulsozialarbeiter werden beschrieben. Darauf folgen die Rechtsgrundlagen, die für die Schulsozialarbeit von Bedeutung sind.
Im Anschluss daran werden die strukturellen Rahmenbedingungen beschrieben zum einen wer die Trägerschaften der Schulsozialarbeit sind und, zum anderen wie die Finanzierung des Handlungsfeldes abläuft. Des Weiteren wird auf die räumliche Ausstattung eingegangen. Darauf folgt die Darstellung der Methodik in der Schulsozialarbeit.
Schulsozialarbeit hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutsamen Handlungsfeld in der Sozialen Arbeit entwickelt. Die Schulsozialarbeit stellt ein Arbeitsfeld der Jugendhilfe dar, das auf eine über 40-jährige Geschichte in Deutschland zurückblickt. Sie wird in gemeinsamer Verantwortung von Jugendhilfe und Schule ausgeübt. Vor einigen Jahren waren es noch Lehrer die an den Schnittstellen zwischen Wissensvermittlung, sozialen Problemlagen der Schüler vermittelten und so kam es häufig zu einer Überforderung der Lehrkräfte. In den folgenden Jahren ist eine Zunahme der sozialen Schwierigkeiten der Schüler zu beobachten die einen erheblichen Einfluss auf die Verarbeitung der Unterrichtsinhalte aufweist.
Die unterschiedlichen Charaktere junger Menschen in ihrer sozialen und kulturellen Vielfältigkeit, die am Ort Schule aufeinander treffen benötigen adäquate Unterstützung, um den Interessen und Bedürfnissen der Schüler gerecht werden zu können und ihnen Angebote vorzulegen. Die Institution Schule ist es nicht möglich allein dieses anzugehen, sodass die Schulsozialarbeit eine bedeutsame Rolle einnimmt. Schulsozialarbeit ist relevant für die „Weiterentwicklung des Bildungswesens zu einem Gesamtsystem von Bildung, Erziehung und Betreuung.“ (Kooperationsverbund Schulsozialarbeit, 2015, S. 8).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition - Schulsozialarbeit
- Historische Entwicklung
- Vor den 1970er Jahren
- Einführung der Schulsozialarbeit
- Der aktuelle Stand
- Organisation der Schulsozialarbeit
- Ziel und Zielgruppe der Schulsozialarbeit
- Aufgaben und Leistungen
- Rechtliche Grundlagen
- Strukturelle Rahmenbedingungen
- Träger und Finanzierung
- Räumlichkeiten und Ausstattung
- Methodisches Handeln in der Schulsozialarbeit
- Methoden der Schulsozialarbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte, Organisation und den methodischen Aspekten der Schulsozialarbeit in Deutschland. Sie analysiert die Entwicklung dieses Arbeitsfeldes seit seinen Anfängen, beleuchtet die Rolle der Schulsozialarbeit im Bildungssystem und untersucht die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule.
- Die historische Entwicklung der Schulsozialarbeit in Deutschland
- Die Definition und Organisation der Schulsozialarbeit
- Die Aufgaben und Leistungen von Schulsozialarbeitern
- Die Bedeutung der Schulsozialarbeit für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Die strukturellen Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in das Thema der Schulsozialarbeit ein, beleuchtet die Bedeutung des Handlungsfeldes im Bildungssystem und stellt die Gliederung der Arbeit vor.
- Definition - Schulsozialarbeit: Dieses Kapitel erklärt den Begriff der Schulsozialarbeit und geht auf die Entwicklung der Definition des Begriffs in Deutschland ein.
- Historische Entwicklung: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung der Schulsozialarbeit in Deutschland. Es analysiert die Entwicklung des Handlungsfeldes vor den 1970er Jahren, die Einführung der Schulsozialarbeit und den aktuellen Stand der Entwicklung.
- Organisation der Schulsozialarbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Organisation der Schulsozialarbeit, insbesondere die Zielgruppen und Ziele der Arbeit, die Aufgaben und Leistungen von Schulsozialarbeitern und die rechtlichen Grundlagen des Handlungsfeldes.
- Strukturelle Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel untersucht die strukturellen Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit, einschließlich der Träger und Finanzierung sowie der räumlichen Ausstattung.
- Methodisches Handeln in der Schulsozialarbeit: Dieses Kapitel widmet sich den methodischen Ansätzen und Instrumenten der Schulsozialarbeit.
Schlüsselwörter
Schulsozialarbeit, Jugendhilfe, Bildungssystem, Schule, Kinder, Jugendliche, Entwicklung, Sozialpädagogik, Methoden, Organisation, Geschichte, Rechtliche Grundlagen, Träger, Finanzierung, Räumlichkeiten.
- Quote paper
- Sema Göktas (Author), 2018, Schulsozialarbeit. Eine Analyse ihrer Geschichte und Organisation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510032