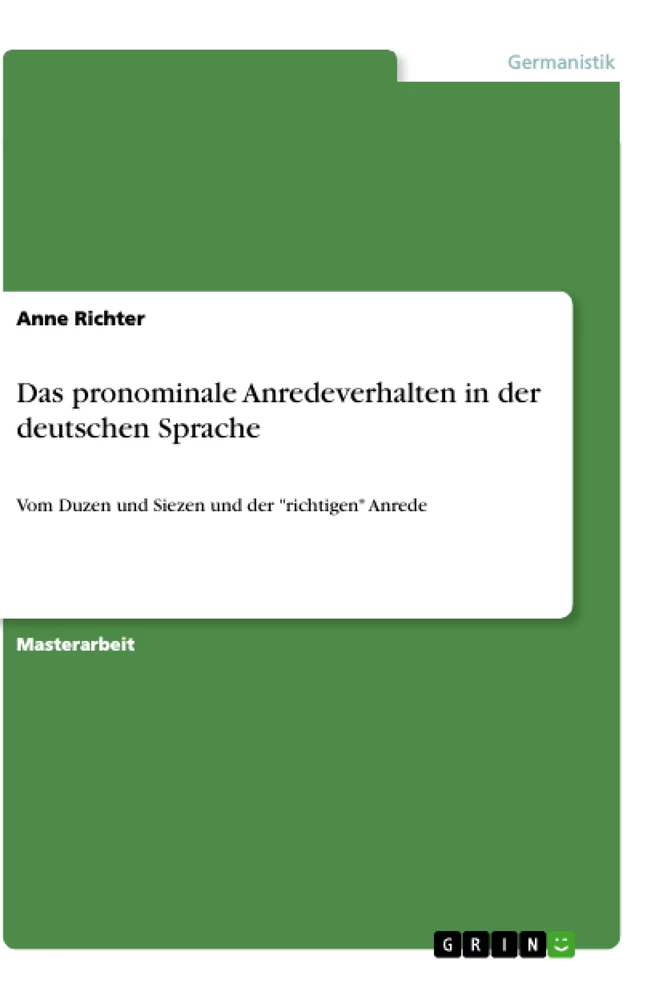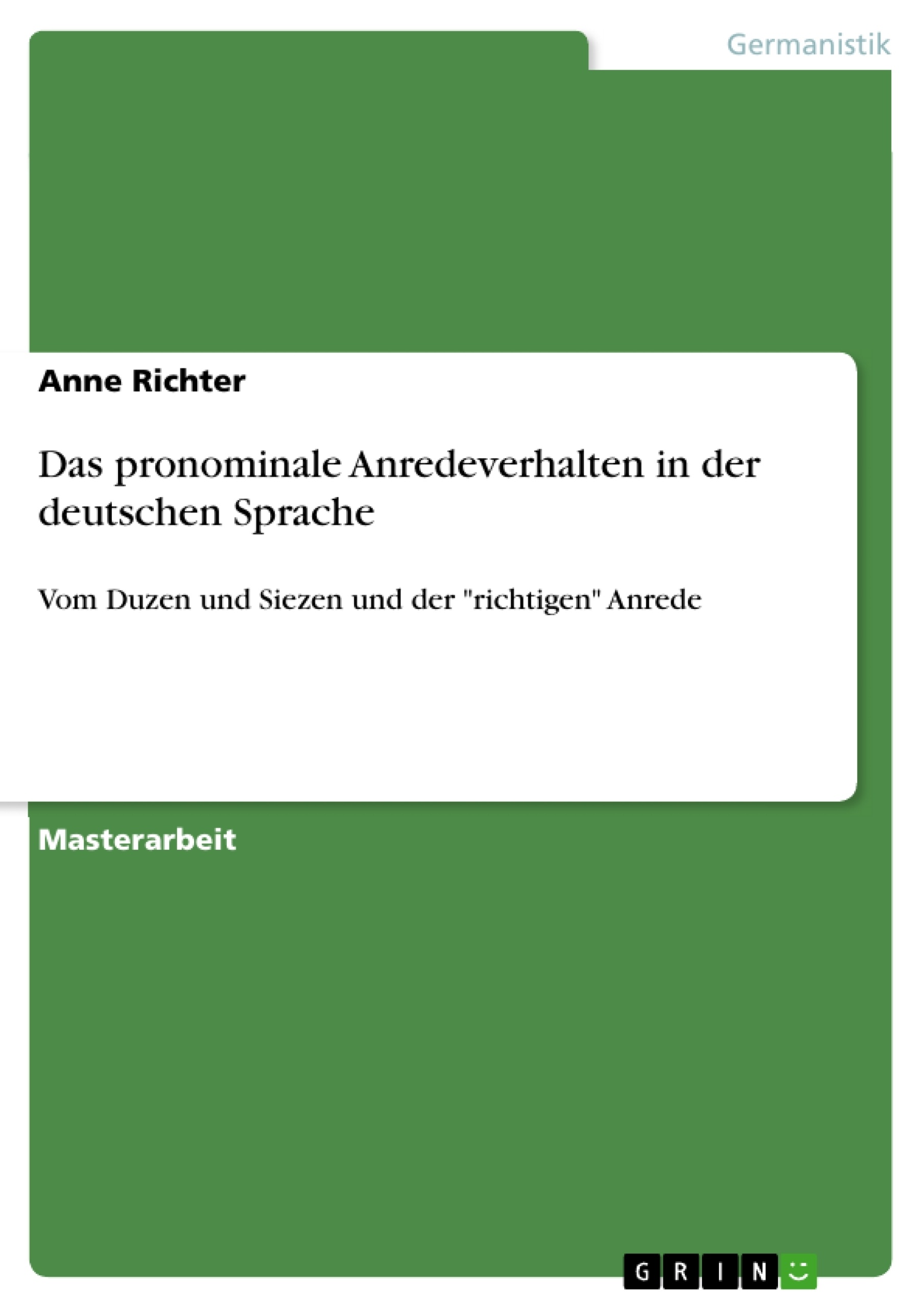Egal, wie die Kommunikation verläuft - wir können meist nicht vermeiden, unserem Gegenüber eine Anrede zuzuschreiben. Doch was beeinflusst uns bei der Wahl der vermeintlich "passenden" Anrede? Mit welchen Intentionen entscheiden wir uns entweder für die eine oder die andere pronominale Anrede? Und in welchen Situationen gehen wir dieser Entscheidung lieber aus dem Weg, um keinen Fehler zu begehen? Diesen Fragen soll unter anderem innerhalb dieser Arbeit nachgegangen werden. Es wird lediglich die pronominale Anrede behandelt, während die nominale Anrede keinerlei Beachtung erfährt.
Zu Beginn wird im Theorieteil eine wissenschaftliche Basis geschaffen, welche sich mit der Sprache als Kommunikationsmittel auseinandersetzt und ein eigens erstelltes Kommunikationsmodell in Anlehnung an fundierte Modelle bekannter Sprachwissenschaftler präsentiert.
Der Praxisteil beruht auf einer durchgeführten empirischen Studie. In dieser soll grundlegend drei Fragestellungen nachgegangen werden, welche vom Allgemeinen ins Detaillierte staffelbar sind. Zu allererst soll bestimmt werden, welche Aussagen sich über das pronominale Anredeverhalten in der deutschen Sprache zum jetzigen Zeitpunkt treffen lassen. Weiterführend sollen personelle Eigenschaften seitens des Sprechers und des Empfängers ermittelt werden, die das Anredeverhalten beeinflussen. Zuletzt soll herausgefunden werden, welche Grauzonen, also Situationen, in denen man sich als Sprecher unsicher in seiner Wahl der korrekten Anrede ist, tendenziell bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 0: Die Einleitung
- Teil I: Der Theorieteil
- 1. Sprache als Kommunikationsmittel zur Entstehung und Aufrechterhaltung zwischenmenschlicher Beziehungen
- 1.1 Ein eigenes Kommunikationsmodell in Anlehnung an Jakobson und Watzlawick
- 1.2 Das Organonmodell nach Bühler
- 2. Höflichkeit in der deutschen Sprache
- 2.1 Das Kooperationsprinzip nach Grice
- 2.2 Die Höflichkeitsregeln nach Lakoff
- 2.3 Das Höflichkeitsprinzip nach Leech
- 2.4 Das face-Konzept nach Brown und Levinson
- 3. Anrede und Anredeverhalten
- 3.1 Forschungsstand
- 3.2 Die geschichtliche Veränderung des pronominalen Anredeverhaltens bis zum heutigen binären Anredesystem
- 3.3 Das heutige binäre System mit seinen Vermeidungsstrategien
- 3.4 Funktionen von Anrede
- 3.5 Kriterien zur Wahl der Anrede und deren Wirkung
- 4. Zwischenfazit
- Teil II: Der Praxisteil
- 1. Untersuchungsziele und Fragestellungen
- 2. Die Hypothesen
- 3. Das Untersuchungsdesign
- 4. Das Untersuchungsmaterial
- 4.1 Vorüberlegungen zur Auswahl des Untersuchungsmaterials
- 4.2 Der Pretest
- 4.3 Das endgültige Untersuchungsmaterial
- 4.4 Gütekriterien des Untersuchungsmaterials
- 4.5 Die Durchführung
- 5. Erläuterungen zu den angewandten Berechnungsmöglichkeiten
- 6. Die Stichprobe
- 7. Die Darstellung der deskriptiven Daten
- 8. Die Ergebnisdiskussion
- 9. Kritischer Rückblick und Reflexion
- 10. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das pronominale Anredeverhalten in der deutschen Sprache aus pragmalinguistischer Perspektive. Ziel ist es, die Faktoren zu analysieren, die die Wahl zwischen „du“ und „Sie“ beeinflussen, sowie die Strategien, die zur Vermeidung von Anredekonflikten eingesetzt werden. Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit empirischen Befunden.
- Sprache als Kommunikationsmittel und ihr Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen
- Der Begriff und die Anwendung von Höflichkeit im Kontext pronominaler Anrede
- Die historische Entwicklung und der aktuelle Stand des deutschen Anredesystems
- Funktionen und Kriterien der Anredewahl
- Empirische Untersuchung des Anredeverhaltens in einer spezifischen Situation
Zusammenfassung der Kapitel
Teil 0: Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema „Vom Duzen und Siezen“ ein und skizziert die Forschungsfrage: Welche Faktoren beeinflussen die Wahl der pronominalen Anrede (Duzen/Siezen) und welche Strategien werden zur Vermeidung von Konflikten eingesetzt? Es wird die Fokussierung auf die pronominale Anrede und die Struktur der Arbeit (Theorie- und Praxisteil) erläutert.
Teil I: Der Theorieteil: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Er behandelt Sprache als Kommunikationsmittel, verschiedene Kommunikationsmodelle (Jakobson, Watzlawick, Bühler) und verschiedene Theorien der Höflichkeit (Grice, Lakoff, Leech, Brown & Levinson). Der Forschungsstand zum Anredeverhalten wird beleuchtet, die historische Entwicklung des deutschen Anredesystems dargestellt und die Funktionen sowie Kriterien der Anredewahl diskutiert. Der Teil gipfelt in einem Zwischenfazit, das die theoretischen Erkenntnisse zusammenfasst.
Teil II: Der Praxisteil: Der Praxisteil beschreibt die empirische Untersuchung des pronominalen Anredeverhaltens. Er beinhaltet die Untersuchungsziele, Hypothesen, das Untersuchungsdesign, die Auswahl und Gütekriterien des Untersuchungsmaterials, die Durchführung der Studie sowie die statistische Auswertung der Daten. Die Stichprobe wird beschrieben und die deskriptiven Daten dargestellt. Dieser Teil wird mit einer Ergebnisdiskussion, einem kritischen Rückblick und einer Reflexion abgeschlossen. (Die Zusammenfassung des Fazits und Ausblicks wurde gemäß Aufgabenstellung ausgelassen.)
Schlüsselwörter
Pronominale Anrede, Duzen, Siezen, Pragmalinguistik, Höflichkeit, Kommunikation, Anredeverhalten, Forschungsstand, Empirische Untersuchung, Deutschland, Binäres Anredesystem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vom Duzen und Siezen - Eine pragmalinguistische Untersuchung des pronominalen Anredeverhaltens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das pronominale Anredeverhalten in der deutschen Sprache, also die Wahl zwischen „du“ und „Sie“, aus pragmalinguistischer Perspektive. Der Fokus liegt auf den Faktoren, die diese Wahl beeinflussen, und den Strategien zur Vermeidung von Anredekonflikten.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Theorien der Kommunikation und Höflichkeit. Es werden Kommunikationsmodelle von Jakobson, Watzlawick und Bühler sowie Höflichkeitskonzepte von Grice, Lakoff, Leech und Brown & Levinson behandelt. Der Forschungsstand zum Anredeverhalten und die historische Entwicklung des deutschen Anredesystems werden ebenfalls eingehend dargestellt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen Theorie- und einen Praxisteil. Der Theorieteil legt die theoretischen Grundlagen dar, während der Praxisteil eine empirische Untersuchung beschreibt. Die Einleitung führt in das Thema ein, und die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick (im Originaltext nicht explizit zusammengefasst).
Welche Methoden wurden in der empirischen Untersuchung angewendet?
Der Praxisteil beschreibt das Untersuchungsdesign, die Auswahl und Gütekriterien des Untersuchungsmaterials, die Durchführung der Studie und die statistische Auswertung der Daten. Die Stichprobe wird detailliert beschrieben, und die deskriptiven Daten werden dargestellt. Eine Ergebnisdiskussion, ein kritischer Rückblick und eine Reflexion runden den empirischen Teil ab.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Faktoren, die die Wahl zwischen „du“ und „Sie“ beeinflussen, und untersucht die Strategien zur Vermeidung von Anredekonflikten. Sie kombiniert theoretische Grundlagen mit empirischen Befunden, um ein umfassendes Verständnis des pronominalen Anredeverhaltens zu liefern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pronominale Anrede, Duzen, Siezen, Pragmalinguistik, Höflichkeit, Kommunikation, Anredeverhalten, Forschungsstand, Empirische Untersuchung, Deutschland, Binäres Anredesystem.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert: einen Theorieteil und einen Praxisteil. Der Theorieteil umfasst Kapitel zu Sprache als Kommunikationsmittel, Höflichkeitstheorien und die historische Entwicklung des Anredesystems. Der Praxisteil behandelt die Untersuchungsmethodik, die Datenerhebung und -auswertung sowie die Ergebnisdiskussion und Reflexion.
- Arbeit zitieren
- Anne Richter (Autor:in), 2017, Das pronominale Anredeverhalten in der deutschen Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510046