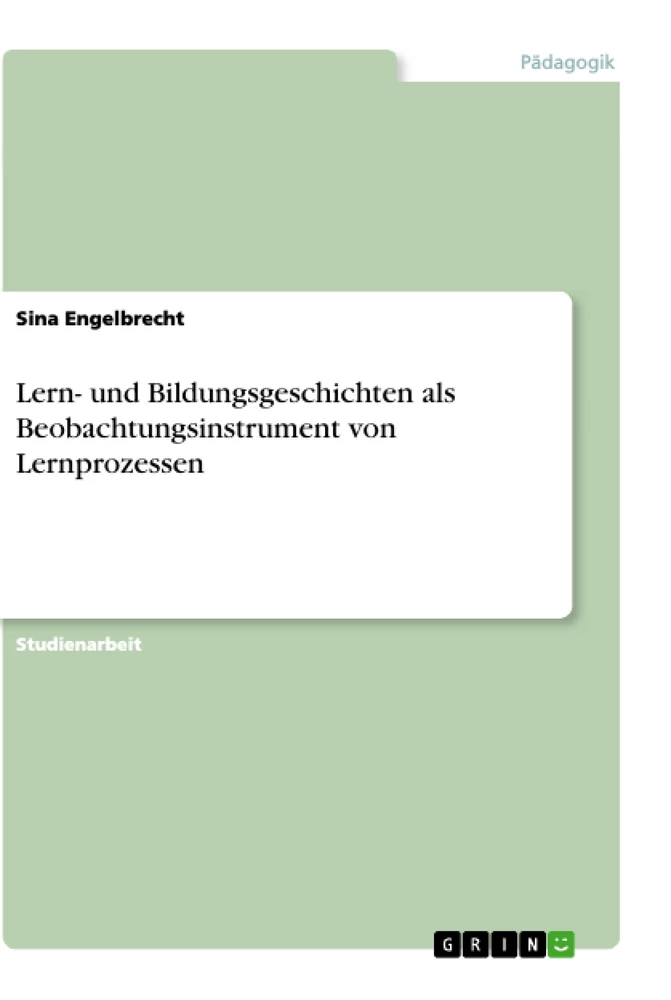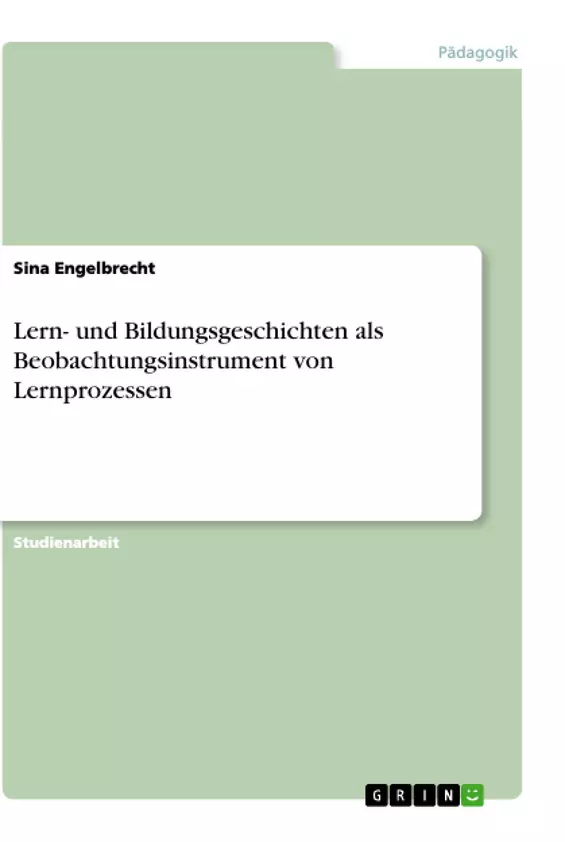Obwohl das Beobachten von Schülerinnen und Schülern zur alltäglichen Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern zählt, findet dieses Themengebiet wenig Beachtung. Doch gerade bei der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft, sind gut ausgebildete Beobachtungsfähigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer notwendig, um Lernausgangslagen für einzelne Kinder ausdifferenzieren zu können und gezielte Fördermaßnahmen zu entwickeln.
In dem Seminar Analyse erschwerter Lern- und Entwicklungsbedingungen wurde sich intensive mit der Thematik des Beobachtens im Schulkontext beschäftigt. Die Arbeitsgruppe, welcher ich zugehörig war, hat sich in fünf Beobachtungssituationen mit dem Arbeits- und Lernverhalten eines Schülers beschäftigt. Wir beobachteten ein sehr passives Lernverhalten, welches unserer Ansicht nach an Arbeitsverweigerung grenzte. Im Laufe des Beobachtungsprozesses stellte sich uns die Frage, ob bei dem Schüler tatsächlich keine Lernprozesse stattfanden beziehungsweise inwiefern Lernprozesse überhaupt beobachtbar sind. Diese gedankliche Auseinandersetzung weckte mein Interesse. Im Laufe meiner Recherche stieß ich auf das Beobachtungsinstrument der Bildungs- und Lerngeschichten aus der frühpädagogischen Praxis, welches in der vorliegenden Arbeit vorgestellt wird. Bei diesem offenen Beobachtungsverfahren wird explizit das Lernen des Kindes thematisiert, damit pädagogisch dort interveniert werden kann, wo bereits Anzeichen für die Entwicklung des Kindes zu beobachten sind. Besonders der Ressourcenorientierte Ansatz interessierte mich in diesem Zusammenhang, da wir bei unseren Beobachtungen eher defizitorientiert gearbeitet haben und dies eine Alternative darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Beobachtung
- 2.1. Lernen beobachten
- 3. Bildungs- und Lerngeschichten
- 3.1. Der konzeptionelle Ansatz
- 3.2. Die Umsetzung in der Praxis
- 3.3 Die Erstellung einer Lerngeschichte
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Bildungs- und Lerngeschichten als Beobachtungsinstrument im Kontext der Analyse erschwerter Lern- und Entwicklungsbedingungen. Ziel ist es, dieses Verfahren aus der frühpädagogischen Praxis vorzustellen und seine Adaptierbarkeit für den Schulkontext zu erörtern.
- Bedeutung von Beobachtung im Schulkontext
- Lernen als Beobachtungsgegenstand
- Konzeptioneller Ansatz der Bildungs- und Lerngeschichten
- Praktische Umsetzung und Erstellung von Lerngeschichten
- Ressourcenorientierte Perspektive
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz von Beobachtung im Schulkontext heraus, insbesondere angesichts der Heterogenität der Schülerschaft. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus passivem Lernverhalten ergeben können und führt zur Vorstellung der Bildungs- und Lerngeschichten als Beobachtungsinstrument.
2. Beobachtung
Dieses Kapitel definiert Beobachtung als Methode der Datengewinnung in den Wirklichkeitswissenschaften und unterscheidet zwischen wissenschaftlichen und Alltagsbeobachtungen. Es beleuchtet den Einsatz von prozessorientierten Beobachtungsansätzen in der Frühpädagogik, die auf die Beschreibung von Alltagssituationen fokussieren.
2.1. Lernen beobachten
Dieser Abschnitt thematisiert die zentrale Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern beim Lernprozess zu unterstützen. Er diskutiert die Frage, inwiefern Lernen überhaupt beobachtbar ist und welche Aspekte beim Beobachten von Lernprozessen relevant sind.
3. Bildungs- und Lerngeschichten
Kapitel 3 stellt das Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten vor, das auf dem Verfahren der „learning stories“ von Marget Carr basiert. Es beleuchtet den konzeptionellen Ansatz und die praktische Umsetzung in der Frühpädagogik.
3.1. Konzeptioneller Ansatz
Der konzeptionelle Ansatz der Bildungs- und Lerngeschichten wird in diesem Abschnitt detailliert erklärt. Es werden die fünf Lerndispositionen von Carr (Interessiert sein, Engagiert sein, Standhalten bei Herausforderungen, Sich ausdrücken und mitteilen, An einer Lerngemeinschaft mitwirken) erläutert und ihre Bedeutung für die Analyse und Interpretation kindlicher Aktivitäten im Sinne der Ressourcenorientierung dargestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Beobachtung, Lernen, Bildungs- und Lerngeschichten, Lerndispositionen, Ressourcenorientierung, Frühpädagogik, Schulkontext, Heterogenität, Lernentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Bildungs- und Lerngeschichten?
Bildungs- und Lerngeschichten sind ein Beobachtungsinstrument aus der frühpädagogischen Praxis, das auf dem Verfahren der „learning stories“ von Margaret Carr basiert. Es dient dazu, Lernprozesse von Kindern qualitativ zu erfassen und pädagogisch zu begleiten.
Welche Rolle spielt die Beobachtung im Schulkontext?
Beobachtung ist eine zentrale Methode für Lehrkräfte, um die individuellen Lernausgangslagen von Schülern in einer heterogenen Schülerschaft zu differenzieren und gezielte Fördermaßnahmen zu entwickeln.
Was ist der ressourcenorientierte Ansatz bei Lerngeschichten?
Im Gegensatz zu defizitorientierten Ansätzen konzentriert sich dieser Ansatz auf die Stärken und Kompetenzen des Kindes. Es wird dort interveniert, wo bereits positive Anzeichen für die Entwicklung sichtbar sind.
Welche fünf Lerndispositionen beschreibt Margaret Carr?
Die fünf Lerndispositionen sind: Interessiert sein, Engagiert sein, Standhalten bei Herausforderungen, Sich ausdrücken und mitteilen sowie An einer Lerngemeinschaft mitwirken.
Sind Lernprozesse bei passivem Lernverhalten beobachtbar?
Ja, durch offene Beobachtungsverfahren wie Lerngeschichten kann untersucht werden, inwiefern auch bei scheinbarer Arbeitsverweigerung Lernprozesse stattfinden, die durch herkömmliche Methoden oft übersehen werden.
Kann das Konzept der Lerngeschichten auf die Schule übertragen werden?
Die Arbeit erörtert die Adaptierbarkeit dieses frühpädagogischen Verfahrens für den Schulalltag, um insbesondere bei erschwerten Lernbedingungen bessere pädagogische Antworten zu finden.
- Arbeit zitieren
- Sina Engelbrecht (Autor:in), 2019, Lern- und Bildungsgeschichten als Beobachtungsinstrument von Lernprozessen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510072