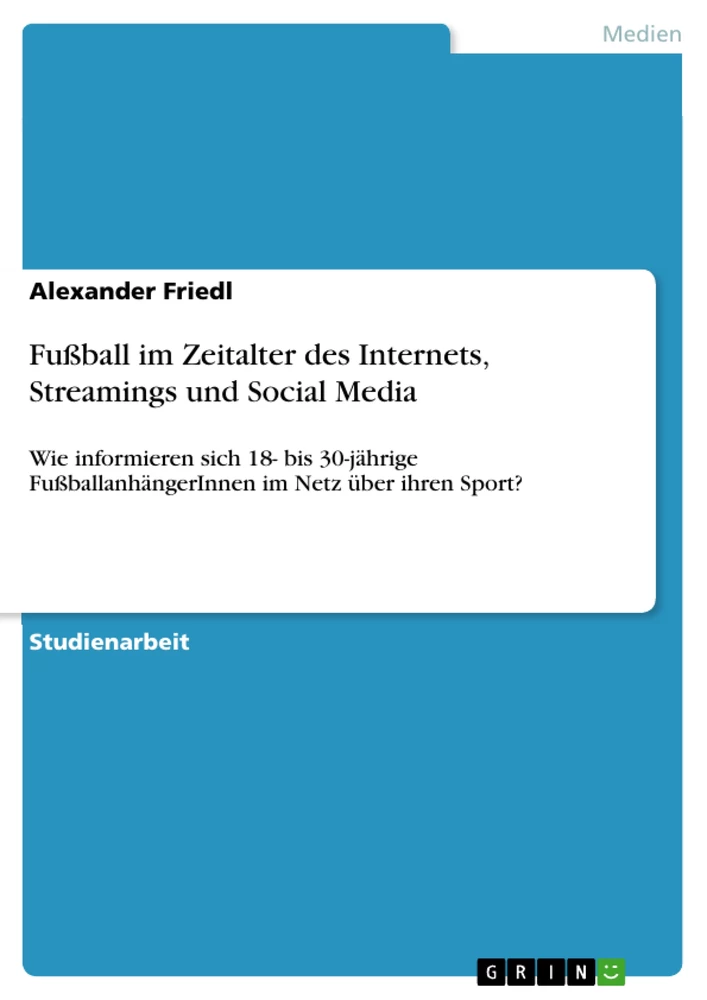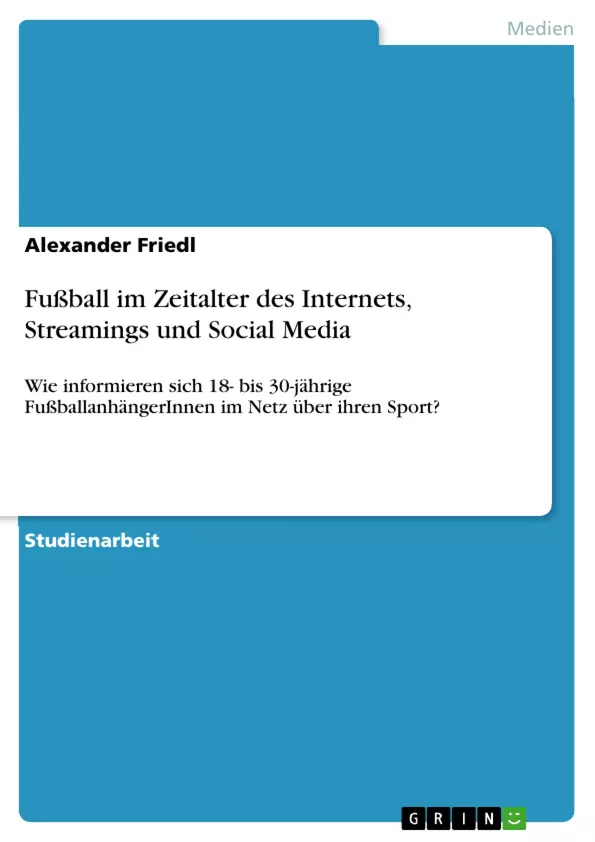Wie wichtig erscheinen einem Fußballfan das Internet und vor allem auch die sozialen Netzwerke in der Nachrichtenbeschaffung des Sports? Dieser Fragestellung soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden.
Fußball, die beliebteste Sportart des Planeten. Jeder kennt sie und sehr viele lieben sie. Es gibt keine andere Sportart, über die dermaßen viel gesprochen, berichtet oder live übertragen wird. Fußball löst Emotionen aus. Fußball bietet Millionen wenn nicht sogar Milliarden von Menschen eine Arbeit. Fußball gibt Perspektiven. Fußball hilft bei der Integration. Fußball verbindet Menschen. Fußball wird auf der ganzen Welt gespielt und verfolgt. Diese Sätze sind nur wenige Phrasen, die auf diesen einzigartigen Sport zutreffen.
Sowohl früher, als auch heute erfreut sich Fußball großer Beliebtheit. Doch über die Jahre hinweg hat sich der Fußball in seiner Spielweise und Vermarktung eklatant verändert und somit auch die damit verbundene Übertragung beziehungsweise Berichterstattung. Im heutigen 21. Jahrhundert gibt es unzählige verschiedene Angebote um die schönste Nebensache der Welt, den Fußball, zu konsumieren. In einer zunehmenden digitalisierten Welt, in der das Internet eine immer wichtiger werdende und große Rolle einnimmt, gibt es einen schier unendlichen Pool an Daten, Informationen und Nachrichten.
Während früher die klassische Tageszeitung und das Fernsehen die klare Nummer eins in der Fußball-Berichterstattung darstellte, hat sich mittlerweile einiges verändert. Mittlerweile bringen Fußball-Blogs, Fußballportale, Streamingdienste, Online-Aufritte von großen Medienunternehmen und soziale Netzwerke die Rangordnung unter den Informationsbeschaffungskanälen kräftig durcheinander.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Teil I: Hintergrundinfo zum Gegenstand und theoretischer Bezugsrahmen.
- 2.1. Begriffsdefinitionen
- 2.1.1. Online-Auftritt Printmedium
- 2.1.2. Fußballportal.
- 2.1.3. Streaming-Plattform
- 2.1.4. Fußball-Blog.
- 2.1.5. Social Media.
- 2.2. Moderne (Sport-)Berichterstattung
- 2.2.1. Onlinejournalismus..
- 2.2.2. Social Media im Sport und Sportjouralismus.
- 2.2.3. Streaming......
- 3. Teil II: Die empirische Untersuchung (Methodenkapitel 1).
- 3.1. Das Forschungsdesign
- 3.2. Arbeit im Feld...
- 3.3. Zeitraum und konkrete Stichprobenbeschreibung.
- 3.4. Auswertungsverfahren....
- 3.3.1. Offenes Kodieren
- 3.3.2. Axiales Kodieren.......
- 4. Teil III: Die empirische Untersuchung (Methodenkapitel 2).
- 4.1. Interviewdaten - Suchmaschinen
- 34.2. Interviewdaten - Online-Auftritt Printmedien
- 4.3. Interviewdaten - Fußballportale...
- 4.4. Interviewdaten – Streaming-Plattformen...
- 4.5. Interviewdaten - Fußball-Blogs
- 4.6. Interviewdaten - Social Media
- 4.7. Interviewdaten - Qualität
- 5. Teil IIII: Diskussion und Interpretation der Befunde.....
- 5.1. Neue Erkenntnisse in Bezugnahme auf Hintergrundinformationen …………………
- 5.1.1. Hoher Einfluss von Social Media ......
- 5.1.2. Streaming-Plattformen am zweitbeliebtesten ........
- 5.1.3. Fußball-Blogs werden kaum gelesen..........\li>
- 5.1.4. Suchmaschinen, Fußballportale und Online-Auftritte von Printmedien werden genutzt......
- 5.2. Kritische Reflexion.......
- 6. Fazit........
- 7. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit den Informationsgewohnheiten von 18- bis 30-jährigen Fußballfans im digitalen Zeitalter. Ziel ist es, zu untersuchen, welche Online-Plattformen und -Kanäle diese Zielgruppe zur Informationsbeschaffung über Fußball nutzt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Die Arbeit beleuchtet dabei folgende Themenschwerpunkte: * **Die Nutzung von Social Media im Fußballkontext**: Welche Rolle spielen soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instagram in der Informationsbeschaffung von Fußballfans? * **Die Bedeutung von Streaming-Plattformen**: Wie beeinflussen Streaming-Dienste wie DAZN und Sky Go die Art und Weise, wie junge Fußballfans ihren Sport konsumieren? * **Die Relevanz von traditionellen Medien im digitalen Zeitalter**: Welchen Stellenwert haben Online-Auftritte von Printmedien und Fußballportalen in der Informationslandschaft? * **Die Bedeutung von Fußballblogs und deren Einfluss**: Welche Rolle spielen Blogs, die sich speziell dem Fußball widmen, in der Informationskette von jungen Fans? * **Die Nutzung von Suchmaschinen**: Wie werden Suchmaschinen wie Google und Bing von Fußballfans zur Informationsbeschaffung genutzt?Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage einführt. Anschließend werden in Teil I wichtige Begriffe wie Online-Auftritt von Printmedien, Fußballportale, Streaming-Plattformen, Fußballblogs und Social Media definiert. Dieser Teil beleuchtet auch den bisherigen Forschungsstand im Bereich Onlinejournalismus, Social Media und Streaming im Sportkontext. Teil II widmet sich der empirischen Untersuchung, die auf einer qualitativen Methode basiert. Hier werden das Forschungsdesign, die Arbeit im Feld, der Zeitraum und die gewählten Auswertungsverfahren vorgestellt. Teil III präsentiert die Interviewdaten, die in sechs Kategorien eingeteilt werden: Suchmaschinen, Online-Auftritte von Printmedien, Fußballportale, Streaming-Plattformen, Fußballblogs und Social Media. Teil IIII diskutiert und interpretiert die Ergebnisse der Befragung. Hier wird der Einfluss von Social Media, die Popularität von Streaming-Plattformen und die geringe Nutzung von Fußballblogs beleuchtet. Weiterhin wird untersucht, inwieweit Suchmaschinen, Fußballportale und Online-Auftritte von Printmedien in der Informationsbeschaffung eine Rolle spielen.Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit Themen wie Online-Journalismus, Sportberichterstattung, Social Media, Streaming, Fußball, digitale Mediennutzung, Informationsverhalten, junge Zielgruppen und qualitative Forschung. Sie beleuchtet insbesondere die Rolle von sozialen Netzwerken, Streaming-Plattformen und traditionellen Medien in der Informationsbeschaffung von jungen Fußballfans.Häufig gestellte Fragen
Wie beschaffen sich junge Fußballfans heute ihre Informationen?
Junge Fans (18-30 Jahre) nutzen primär Social Media, Streaming-Dienste und Online-Portale anstelle klassischer Tageszeitungen.
Welche Rolle spielt Social Media im modernen Fußball?
Soziale Netzwerke haben einen sehr hohen Einfluss auf die Nachrichtenbeschaffung und die Interaktion mit dem Sport.
Wie beliebt sind Streaming-Plattformen bei Fußballfans?
Streaming-Plattformen wie DAZN oder Sky Go sind laut der Untersuchung die zweitbeliebteste Quelle für den Konsum von Fußballinhalten.
Werden Fußball-Blogs noch aktiv gelesen?
Die empirische Untersuchung zeigt, dass Fußball-Blogs im Vergleich zu anderen digitalen Kanälen heutzutage kaum noch genutzt werden.
Was ist der Unterschied zwischen Onlinejournalismus und Social Media im Sport?
Onlinejournalismus umfasst redaktionelle Angebote (z.B. Print-Online), während Social Media oft direkte, ungefilterte Informationen und Interaktion bietet.
- Citar trabajo
- Alexander Friedl (Autor), 2018, Fußball im Zeitalter des Internets, Streamings und Social Media, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510992