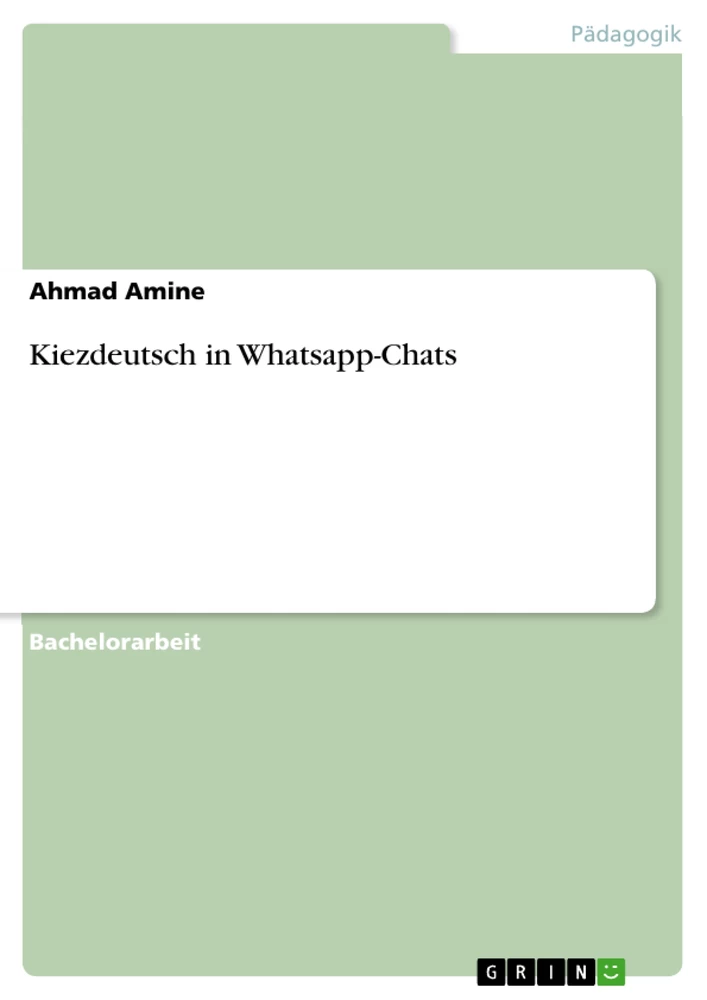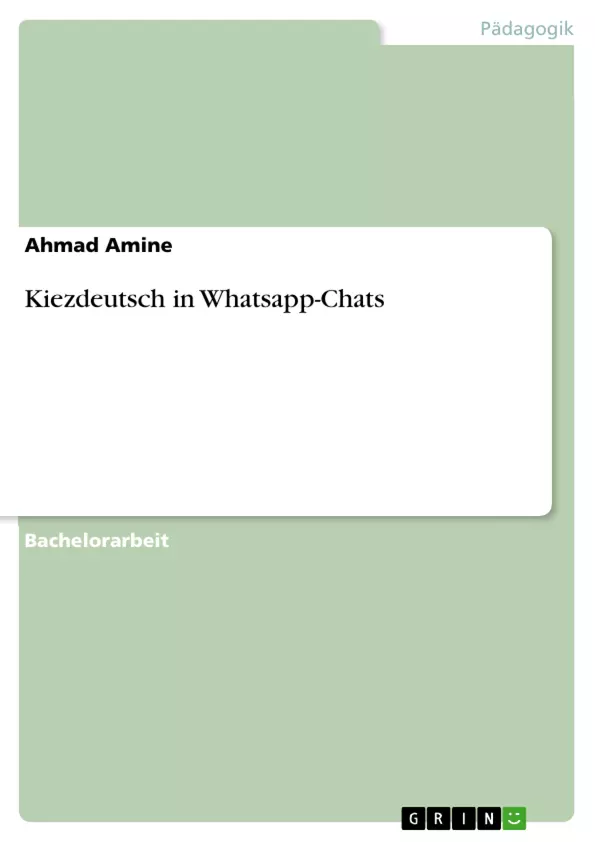A: "Shu was geht bei dir?"
B: "Lass Fifa, komm zu mir."
A: "Nein wallah, lass lieber shishabar und vielleicht danach Fifa."
Dies ist ein Ausschnitt aus einem WhatsApp-Gespräch zwischen zwei jungen Männern, die ihren Freitagabend online planen wollen. Dabei fällt sofort auf, dass sie zwar ihre Konversation in der deutschen Sprache verfasst haben, aber dennoch Wörter verwendet wurden, die womöglich aus anderen Herkunftssprachen stammen und in die deutschen Satzstrukturen integriert wurden. Des Weiteren findet die Unterhaltung in teilweise brüchigen Sätzen statt, was zunächst vermuten lassen könnte, dass es zur Normalität zählt, mit unvollständigen Sätzen miteinander zu schreiben. Es könnte jedoch auch auf den jeweiligen Sprachgebrauch der Akteure zurückführen.
Dieser Sprachgebrauch ist normalerweise aus der gesprochenen Sprache bekannt bzw. der Jugendsprache "Kiezdeutsch" zuzuordnen, die die beiden Männer aus ihrer Jugendzeit beibehielten. Nach Untersuchungen vieler Linguisten steht fest, dass Kiezdeutsch über ein eigenes grammatisches System verfügt und die Verwendung von Kiezdeutsch in den letzten Jahren bei den Jugendlichen in Deutschland zugenommen hat.
Da Kiezdeutsch auch im Regelfall ein Phänomen der gesprochenen Sprache ist, fokussiert sich die Sprachwissenschaft bzw. Jugendsprachforschung dementsprechend darauf. Weniger Aufmerksamkeit erhält jedoch im Gegenzug die Verschriftlichung dieser Sprache in digitalen Medien, zu denen der Messengerdienst WhatsApp. In diesem Bereich finden sich vergleichsweise wenige Untersuchungen darüber, inwieweit die Kiezdeutsch Spre-cher/innen ihren gesprochenen Sprachstil auch auf ihre digitalen Schreibweisen übertragen und das, obwohl in der heutigen Zeit ca. 89% der Jugendlichen angeben, WhatsApp für das Versenden und Empfangen von Textnachrichten zu nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Jugendsprache
- 2.1 Jugendabgrenzung
- 2.2 Historische Herkunft und Bedeutung von Jugendsprache
- 3 Kiezdeutsch
- 3.1 Definition
- 3.2 Grammatische Phänomene und Regelungen
- 3.2.1 Code-Switching
- 3.2.2 Lokalangaben
- 3.2.3 Verkürzungen/ Artikelvermeidung
- 3.2.4 Wortstellung
- 3.2.5 Grammatikalisierung von „so“
- 3.2.6 Funktionsverb
- 4 Einflussfaktoren auf Kiezdeutsch
- 4.1 Migrationseinfluss
- 4.2 Medieneinfluss
- 5 Gesellschaftliche Sicht auf Kiezdeutsch
- 6 Digitale Schriftlichkeit
- 7 Kiezdeutsch in WhatsApp-Chats
- 7.1 Datenerhebung
- 7.2 Auswertung
- 7.2.1 Code-Switching in Textnachrichten
- 7.2.2 Lokalangaben in Textnachrichten
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Verwendung von Kiezdeutsch in WhatsApp-Chats. Ziel ist es, die sprachlichen Besonderheiten von Kiezdeutsch in digitaler Schriftlichkeit zu analysieren und die gesellschaftliche Relevanz dieses Phänomens zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet die sprachlichen Strukturen von Kiezdeutsch, seine historischen Wurzeln in der Jugendsprache und den Einfluss von Migration und Medien. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Code-Switching, Lokalangaben und weiteren grammatischen Besonderheiten im Kontext digitaler Kommunikation.
- Sprachliche Merkmale von Kiezdeutsch in WhatsApp-Chats
- Der Einfluss von Migration und Medien auf die Entwicklung von Kiezdeutsch
- Kiezdeutsch als Ausdruck jugendlicher Identität und Abgrenzung
- Der Vergleich zwischen gesprochener und geschriebener Kiezdeutsch
- Gesellschaftliche Wahrnehmung und Bewertung von Kiezdeutsch
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert anhand eines WhatsApp-Gesprächs beispielhaft die Verwendung von Kiezdeutsch und leitet zur Forschungsfrage über, die sich mit der Verschriftlichung von Kiezdeutsch in digitalen Medien befasst. Sie stellt die Forschungslücke heraus – die vergleichsweise geringe wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema – und betont die Relevanz der Untersuchung angesichts der hohen Verbreitung von WhatsApp unter Jugendlichen.
2 Jugendsprache: Dieses Kapitel erörtert den soziologischen und sozialpsychologischen Aspekt von Jugend, beleuchtet die Abgrenzung von Jugend als Lebensphase und die Rolle von Jugendsprache in der Identitätsfindung. Es wird die Jugendsprache historisch eingeordnet, beginnend mit öffentlichen Diskussionen und Abwertungen in den 70er Jahren, bis hin zur heutigen sprachwissenschaftlichen Forschung. Der Fokus liegt auf der Funktion der Jugendsprache als Mittel der Gruppenbildung und Abgrenzung von Erwachsenen.
3 Kiezdeutsch: Das Kapitel definiert Kiezdeutsch und analysiert seine grammatischen Besonderheiten. Es werden zentrale grammatische Phänomene wie Code-Switching, Lokalangaben, Verkürzungen, Wortstellung und die Grammatikalisierung von „so“ detailliert untersucht. Der Abschnitt betont die Eigenständigkeit des grammatischen Systems von Kiezdeutsch und dessen zunehmende Verbreitung unter Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Kiezdeutsch, Jugendsprache, WhatsApp, digitale Schriftlichkeit, Code-Switching, Migration, Medien, Sprachwandel, Identität, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Kiezdeutsch in WhatsApp-Chats
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Verwendung von Kiezdeutsch in WhatsApp-Chats. Der Fokus liegt auf der Analyse der sprachlichen Besonderheiten von Kiezdeutsch in digitaler Schriftlichkeit und der Beleuchtung der gesellschaftlichen Relevanz dieses Phänomens.
Welche Aspekte von Kiezdeutsch werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die sprachlichen Strukturen von Kiezdeutsch, seine historischen Wurzeln in der Jugendsprache und den Einfluss von Migration und Medien. Im Mittelpunkt stehen die Untersuchung von Code-Switching, Lokalangaben und weiteren grammatischen Besonderheiten im Kontext digitaler Kommunikation.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Verschriftlichung von Kiezdeutsch in digitalen Medien. Sie untersucht sprachliche Merkmale von Kiezdeutsch in WhatsApp-Chats, den Einfluss von Migration und Medien auf dessen Entwicklung, Kiezdeutsch als Ausdruck jugendlicher Identität und Abgrenzung, den Vergleich zwischen gesprochener und geschriebener Kiezdeutsch sowie die gesellschaftliche Wahrnehmung und Bewertung von Kiezdeutsch.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Jugendsprache (inkl. historischer Einordnung und soziologischem Aspekt), Kiezdeutsch (inkl. Definition und grammatischer Analyse), Einflussfaktoren auf Kiezdeutsch (Migration und Medien), Gesellschaftliche Sicht auf Kiezdeutsch, Digitale Schriftlichkeit, Kiezdeutsch in WhatsApp-Chats (inkl. Datenerhebung und Auswertung) und Fazit.
Welche grammatischen Phänomene von Kiezdeutsch werden detailliert betrachtet?
Die Arbeit analysiert detailliert grammatische Phänomene wie Code-Switching, Lokalangaben, Verkürzungen/Artikelvermeidung, Wortstellung und die Grammatikalisierung von „so“ im Kontext von Kiezdeutsch.
Welche Rolle spielen Migration und Medien in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Migration und Medien auf die Entwicklung und Verbreitung von Kiezdeutsch.
Wie wird die gesellschaftliche Relevanz von Kiezdeutsch behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung und Bewertung von Kiezdeutsch und dessen Rolle als Ausdruck jugendlicher Identität und Abgrenzung.
Welche Methoden wurden zur Datenerhebung und -auswertung verwendet?
Das Kapitel "Kiezdeutsch in WhatsApp-Chats" beschreibt die Methoden der Datenerhebung und Auswertung, insbesondere die Analyse von Code-Switching und Lokalangaben in Textnachrichten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kiezdeutsch, Jugendsprache, WhatsApp, digitale Schriftlichkeit, Code-Switching, Migration, Medien, Sprachwandel, Identität, Soziolinguistik.
Welche Forschungslücke schließt diese Arbeit?
Die Arbeit adressiert die vergleichsweise geringe wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Verschriftlichung von Kiezdeutsch in digitalen Medien, insbesondere in WhatsApp-Chats.
- Arbeit zitieren
- Ahmad Amine (Autor:in), 2019, Kiezdeutsch in Whatsapp-Chats, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511278