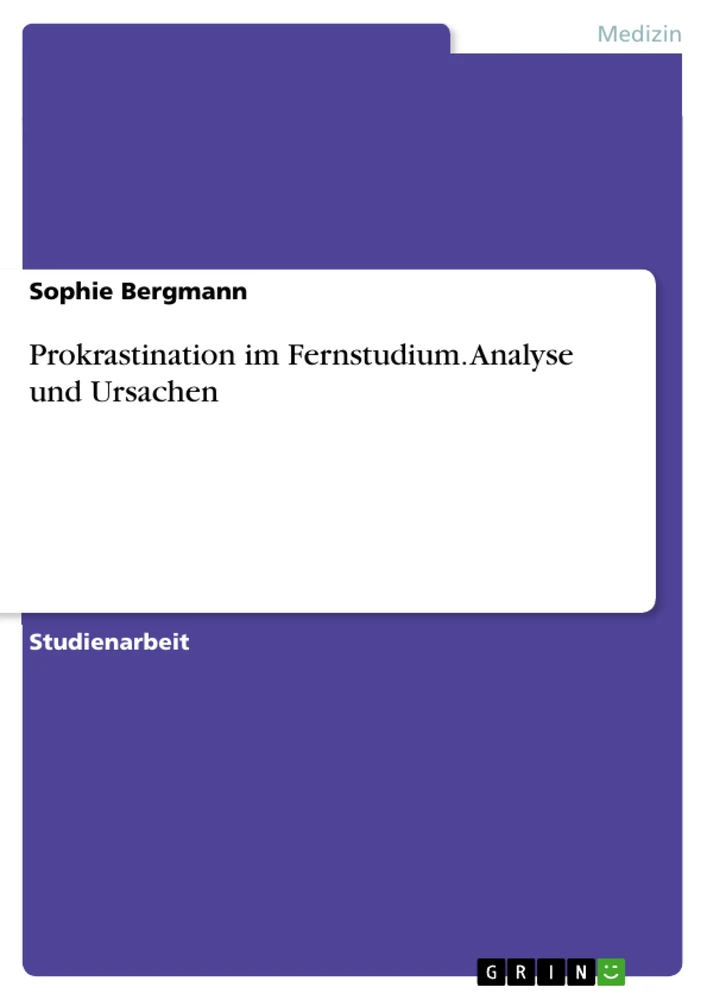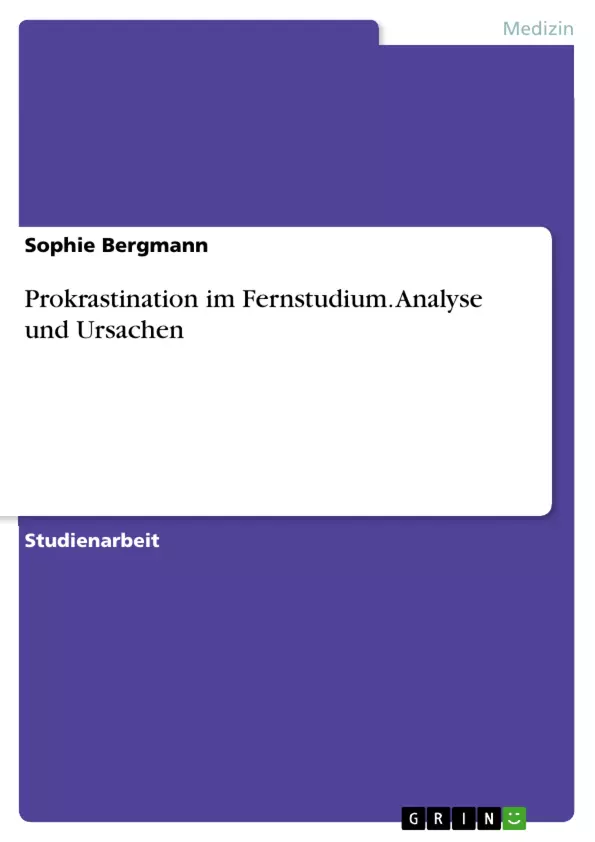Das übergeordnete Ziel des vorliegenden Projektes ist es, die Ursachen für die Prokrastination im Fernstudium bei einer Stichprobe von Studenten der SRH Fernhochschule Riedlingen zu benennen und zu analysieren, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Dazu wird im Theorieteil zunächst näher auf den Begriff, die Genese und die Einordnung der Prokrastination eingegangen. Zusätzlich erfolgt eine Abgrenzung von anderen psychischen Störungen und die Darstellung von bisherigen Forschungsergebnissen. Im Methodenteil werden die Rahmenbedingungen und das methodische Vorgehen erläutert. Im Anschluss werden die Ergebnisse mittels deskriptiver Statistik dargestellt, im anschließenden Diskussionsteil werden die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung interpretiert und es erfolgt eine Ableitung von Handlungsempfehlungen.
Zum Abschluss wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick bezüglich des Forschungsthemas erstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definition Prokrastination
- 2.1.1 Rahmenmodell der Volitionsforschung
- 2.1.2 Genese der Prokrastination
- 2.1.3 Abgrenzung von anderen psychischen Störungen
- 2.1.4 Akademische Prokrastination
- 2.2 Aktueller Forschungsstand
- 2.3 Zusammenfassung und Überleitung
- 3. Methode
- 3.1 Unternehmen und Stichprobe
- 3.2 Dimensionale Analyse
- 3.3 Entwicklung von Fragebogen und Skalen
- 3.4 Vorgehen bei der Befragung
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Darstellung der Ergebnisse
- 4.2 Beantwortung der Leitfragen
- 5. Diskussion
- 5.1 Gütekriterien und kritische Selbstreflexion
- 5.2 Diskussion der Ergebnisse
- 5.3 Handlungsempfehlungen für die Praxis
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen von Prokrastination im Fernstudium an der SRH Fernhochschule Riedlingen. Ziel ist die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Studierende. Die Studie basiert auf empirischen Daten und analysiert verschiedene Faktoren, die zur Prokrastination beitragen.
- Definition und Abgrenzung von Prokrastination
- Theoretische Modelle zur Erklärung von Prokrastination
- Empirische Untersuchung der Prokrastination im Fernstudium
- Analyse der Ergebnisse und deren Implikationen
- Entwicklung von praxisrelevanten Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Prokrastination im Kontext des Fernstudiums ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas hervorgehoben und die Forschungsfrage formuliert.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der theoretischen Grundlagen zum Thema Prokrastination. Es definiert den Begriff, stellt verschiedene Modelle zur Erklärung der Genese von Prokrastination vor (z.B. das Rubikonmodell der Volitionsforschung), grenzt Prokrastination von anderen psychischen Störungen ab und beleuchtet den Forschungsstand zum Thema akademische Prokrastination. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen und der verschiedenen Faktoren, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Prokrastination beitragen.
3. Methode: In diesem Kapitel wird die Methodik der empirischen Untersuchung detailliert beschrieben. Es wird die Stichprobe definiert, die eingesetzten Erhebungsinstrumente (Fragebögen und Skalen) vorgestellt und das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung erläutert. Die methodischen Entscheidungen werden begründet und die Gütekriterien der Studie werden thematisiert.
4. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Daten werden übersichtlich dargestellt und interpretiert. Hier werden die Antworten auf die Forschungsfragen des Projekts präsentiert und aufbereitet, einschließlich der statistischen Analysen und deren Ergebnisse.
5. Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie im Lichte der theoretischen Grundlagen. Es werden die Stärken und Schwächen der Methodik kritisch reflektiert, die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstands eingeordnet und mögliche Erklärungen für die gefundenen Zusammenhänge angeboten. Zusätzlich werden Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet.
Schlüsselwörter
Prokrastination, Fernstudium, Akademische Prokrastination, Volition, Selbstregulation, Handlungskontrolle, Empirische Untersuchung, Handlungsempfehlungen, Prävention, Gesundheitspsychologie, SRH Fernhochschule Riedlingen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Prokrastination im Fernstudium
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen von Prokrastination im Fernstudium an der SRH Fernhochschule Riedlingen und entwickelt daraus Handlungsempfehlungen für Studierende. Die Studie basiert auf empirischen Daten und analysiert verschiedene Faktoren, die zur Prokrastination beitragen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Prokrastination, theoretische Modelle zur Erklärung von Prokrastination (inkl. des Rubikonmodells der Volitionsforschung), empirische Untersuchung der Prokrastination im Fernstudium, Analyse der Ergebnisse und deren Implikationen sowie die Entwicklung praxisrelevanter Handlungsempfehlungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen (Definition Prokrastination, Rahmenmodell der Volitionsforschung, Genese der Prokrastination, Abgrenzung zu anderen Störungen, Akademische Prokrastination, aktueller Forschungsstand), Methode (Unternehmen und Stichprobe, dimensionale Analyse, Fragebogenentwicklung, Vorgehen bei der Befragung), Ergebnisse (Darstellung der Ergebnisse, Beantwortung der Leitfragen), Diskussion (Gütekriterien, kritische Selbstreflexion, Ergebnisdiskussion, Handlungsempfehlungen), und Fazit/Ausblick.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet eine empirische Methode. Es wird detailliert auf die Stichprobe, die verwendeten Fragebögen und Skalen sowie das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung eingegangen. Die methodischen Entscheidungen werden begründet und die Gütekriterien der Studie thematisiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung übersichtlich und interpretiert die Daten. Die Antworten auf die Forschungsfragen werden präsentiert und aufbereitet, inklusive der statistischen Analysen und deren Ergebnisse.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit leitet aus den Ergebnissen praxisrelevante Handlungsempfehlungen ab, die im Kapitel "Diskussion" präsentiert werden. Diese Handlungsempfehlungen zielen darauf ab, Studierenden zu helfen, Prokrastination zu vermeiden oder zu überwinden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prokrastination, Fernstudium, Akademische Prokrastination, Volition, Selbstregulation, Handlungskontrolle, Empirische Untersuchung, Handlungsempfehlungen, Prävention, Gesundheitspsychologie, SRH Fernhochschule Riedlingen.
Wo finde ich weitere Informationen zu den theoretischen Grundlagen?
Kapitel 2 ("Theoretische Grundlagen") bietet eine umfassende Darstellung der theoretischen Grundlagen zu Prokrastination, inklusive Definition, verschiedener Erklärungsmodelle (z.B. das Rubikonmodell), Abgrenzung von anderen psychischen Störungen und des Forschungsstandes zur akademischen Prokrastination.
Wie wird die Güte der Studie bewertet?
Die Gütekriterien der Studie werden im Kapitel "Diskussion" kritisch reflektiert und bewertet. Stärken und Schwächen der Methodik werden thematisiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Studierende zur Bewältigung von Prokrastination im Fernstudium. Die Arbeit möchte die Ursachen von Prokrastination im Fernstudium identifizieren und verstehen.
- Quote paper
- Sophie Bergmann (Author), 2019, Prokrastination im Fernstudium. Analyse und Ursachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511317