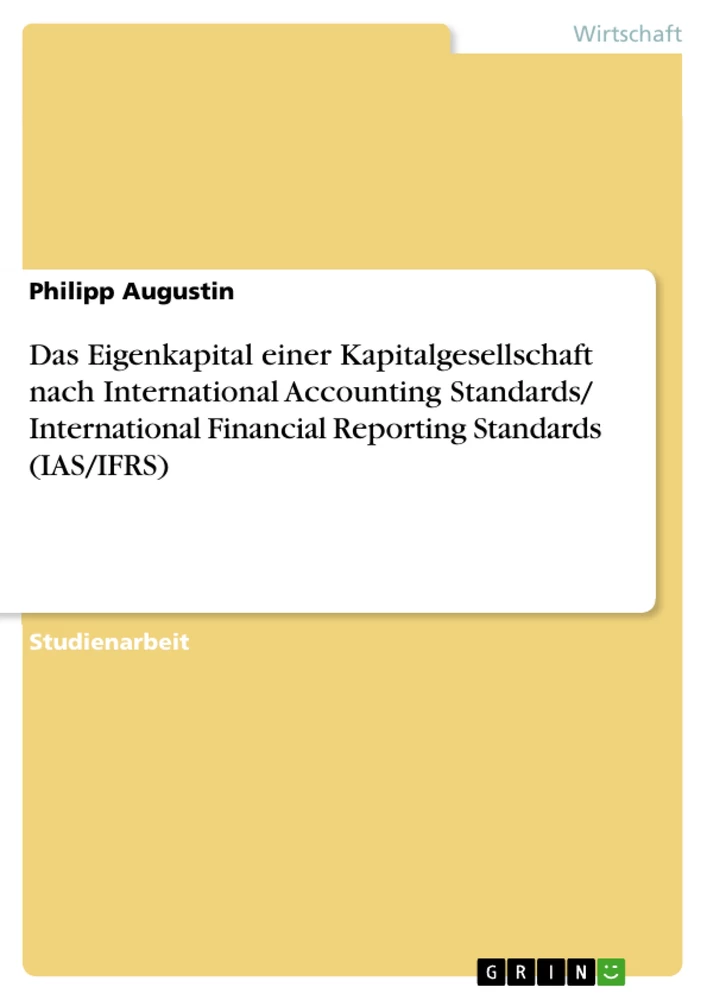Die Arbeit beschäftigt sich mit der Bilanzierung von Eigenkapital nach International Accounting Standards/ International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS). Hierbei wird das Eigenkapitals nach internationaler Rechnungslegung gewürdigt.Außerdem wird die Bilanzierung des Eigenkapitals nach IAS/IFRS von der Bilanzierung nach HGB abgegrenzt. Es folgt eine Erläuterung der ausgewiesen Bilanzpositionen, sowie der Besonderheiten innerhalb der Bilanzierung.
Die weltweiten Exporte im Warenhandel haben sich in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Diese Entwicklung lässt sich mit der voranschreitenden Globalisierung begründen. Auch am Kapitalmarkt ist zu erkennen, dass große Volumina von Direktinvestitionen ins Ausland flossen. Aufgrund dieser Faktoren ist eine einheitliche Berichtsform erforderlich, um Lieferantenrisiken, Forderungsausfallrisiken und den Risikogehalt einer Investition beurteilen zu können. Aufgrund dessen gewinnt der IFRS immer mehr an Bedeutung.
Da Eigenkapitalgeber im Falle einer Insolvenz eines Unternehmens immer erst Auszahlungen aus der Insolvenzmasse erhalten, nachdem sämtliche Lieferantenverbindlichkeiten, Kreditverbindlichkeiten und sonstiges Fremdkapital bedient wurden, ist für die Beurteilung der Risikotragfähigkeit eines Unternehmens eine einheitliche Beurteilung von Eigenkapital unabdingbar aus Sicht von Lieferanten und Kreditgebern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 3. Darstellung des Eigenkapitals einer Kapitalgesellschaft nach IAS/IFRS und HGB
- 3.1. Darstellung des Eigenkapitals einer Kapitalgesellschaft nach IAS/IFRS
- 3.2. Darstellung des Eigenkapitals einer Kapitalgesellschaft nach HGB
- 4. Posten des Eigenkapitals bei Kapitalgesellschaften inkl. Vorgänge und Besonderheiten bei der Bilanzierung
- 4.1. Eingezahltes Eigenkapital
- 4.1.1. Gezeichnetes Kapital
- 4.1.2. Kapitalrücklagen
- 4.2. Erwirtschaftetes Eigenkapital bzw. Rücklagen
- 4.2.1. Gewinnrücklagen
- 4.2.2. Sonstige Rücklagen
- 4.3. Besonderheiten bei der Bilanzierung von Eigenkapital
- 4.3.1. Bilanzierung von eigenen Anteilen
- 4.3.2. Ausstehende Einlagen
- 4.3.3. Kosten für Eigenkapitaltransaktionen
- 4.3.4. Nicht-beherrschende Anteile
- 4.1. Eingezahltes Eigenkapital
- 5. Die EK-Veränderungsrechnung
- 6. Fallbeispiele zu Veränderung des Eigenkapitals einer Kapitalgesellschaft anhand des Bauer Konzerns
- 6.1. Berichtsjahr 2016
- 6.2. Berichtsjahr 2017
- 6.3. Berichtsjahr 2018
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bilanzierung von Eigenkapital nach IAS/IFRS und beleuchtet die grundlegenden Prinzipien dieser Rechnungslegung. Die Arbeit stellt die Bilanzierung nach IAS/IFRS gegenüber der Bilanzierung nach HGB dar und erklärt die ausgewiesenen Bilanzpositionen sowie Besonderheiten innerhalb der Bilanzierung. Anhand von Fallbeispielen wird die Veränderung des Eigenkapitals einer Kapitalgesellschaft anhand des Bauer Konzerns illustriert.
- Darstellung des Eigenkapitals nach IAS/IFRS und HGB
- Posten des Eigenkapitals bei Kapitalgesellschaften
- Besonderheiten bei der Bilanzierung von Eigenkapital
- Die EK-Veränderungsrechnung
- Fallbeispiele zur Veränderung des Eigenkapitals
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung einer einheitlichen Berichtsform für Unternehmen im globalen Kontext und die Notwendigkeit der Beurteilung von Eigenkapital für Lieferanten und Kreditgeber. Das Kapitel "Grundlagen" wird in dieser Vorschau nicht berücksichtigt. Das Kapitel "Darstellung des Eigenkapitals einer Kapitalgesellschaft nach IAS/IFRS und HGB" stellt die Bilanzierung von Eigenkapital nach IAS/IFRS und HGB gegenüber. Die Besonderheiten bei der Bilanzierung von Eigenkapital, die Bilanzierung von eigenen Anteilen, ausstehenden Einlagen, Kosten für Eigenkapitaltransaktionen und nicht-beherrschenden Anteilen werden im Kapitel "Posten des Eigenkapitals bei Kapitalgesellschaften inkl. Vorgänge und Besonderheiten bei der Bilanzierung" erläutert. Das Kapitel "Die EK-Veränderungsrechnung" beschäftigt sich mit der Berechnung der Veränderungen im Eigenkapital. Anhand von Fallbeispielen des Bauer Konzerns illustriert das Kapitel "Fallbeispiele zu Veränderung des Eigenkapitals einer Kapitalgesellschaft anhand des Bauer Konzerns" die Entwicklung des Eigenkapitals über mehrere Jahre hinweg.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bilanzierung von Eigenkapital nach IAS/IFRS, insbesondere bei Kapitalgesellschaften. Schlüsselbegriffe sind dabei unter anderem Eigenkapital, International Financial Reporting Standards (IFRS), Bilanzierung, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen, eigene Anteile, Ausstehende Einlagen, Nicht-beherrschende Anteile, EK-Veränderungsrechnung und Fallbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen IAS/IFRS und HGB beim Eigenkapital?
Während das HGB stark vom Vorsichtsprinzip und Gläubigerschutz geprägt ist, zielen IAS/IFRS primär auf die Informationsvermittlung für Investoren (Decision Usefulness) ab, was zu unterschiedlichen Ausweisen von Rücklagen und Bewertungen führt.
Warum gewinnen internationale Rechnungslegungsstandards an Bedeutung?
Durch die Globalisierung und internationale Kapitalmärkte ist eine einheitliche Berichtsform notwendig, um Risiken von Investitionen und Forderungsausfällen weltweit vergleichbar zu machen.
Was sind nicht-beherrschende Anteile in der IFRS-Bilanz?
Dies sind Anteile am Eigenkapital eines Tochterunternehmens, die nicht dem Mutterkonzern gehören. Sie werden innerhalb des Eigenkapitals gesondert ausgewiesen.
Was beinhaltet die Eigenkapitalveränderungsrechnung?
Sie zeigt detailliert auf, wie sich die einzelnen Posten des Eigenkapitals (z.B. gezeichnetes Kapital, Rücklagen) zwischen zwei Bilanzstichtagen durch Gewinne, Ausschüttungen oder Kapitalerhöhungen verändert haben.
Wie werden eigene Anteile nach IFRS bilanziert?
Eigene Anteile werden nach IFRS offen vom Eigenkapital abgesetzt (als Minusposten), anstatt sie wie früher teilweise als Vermögenswert zu aktivieren.
- Quote paper
- Philipp Augustin (Author), 2019, Das Eigenkapital einer Kapitalgesellschaft nach International Accounting Standards/ International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511656