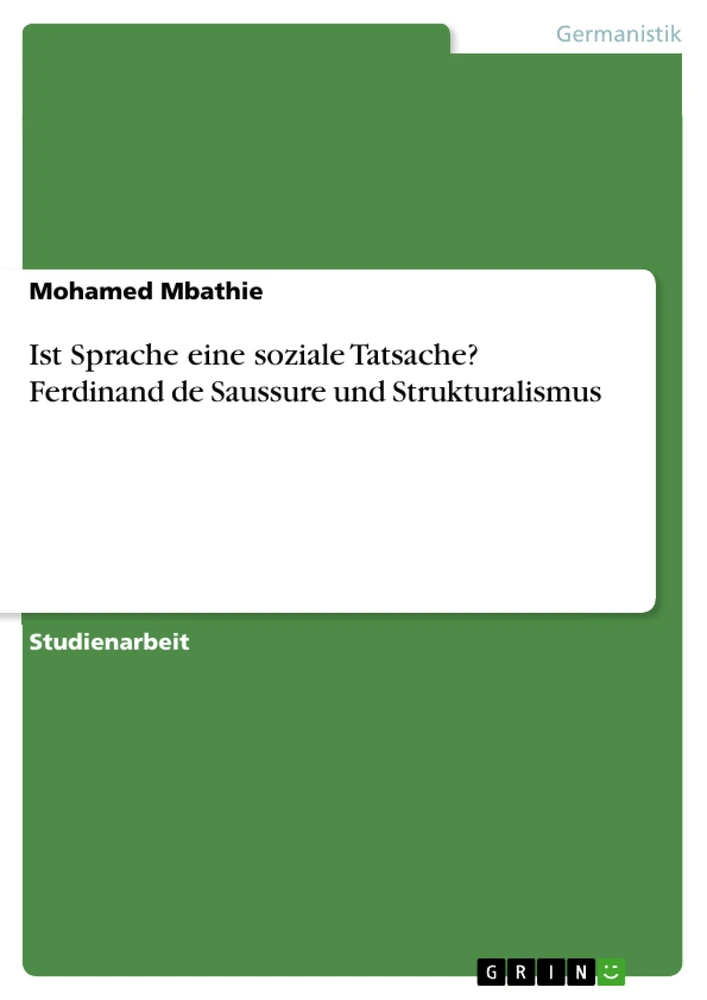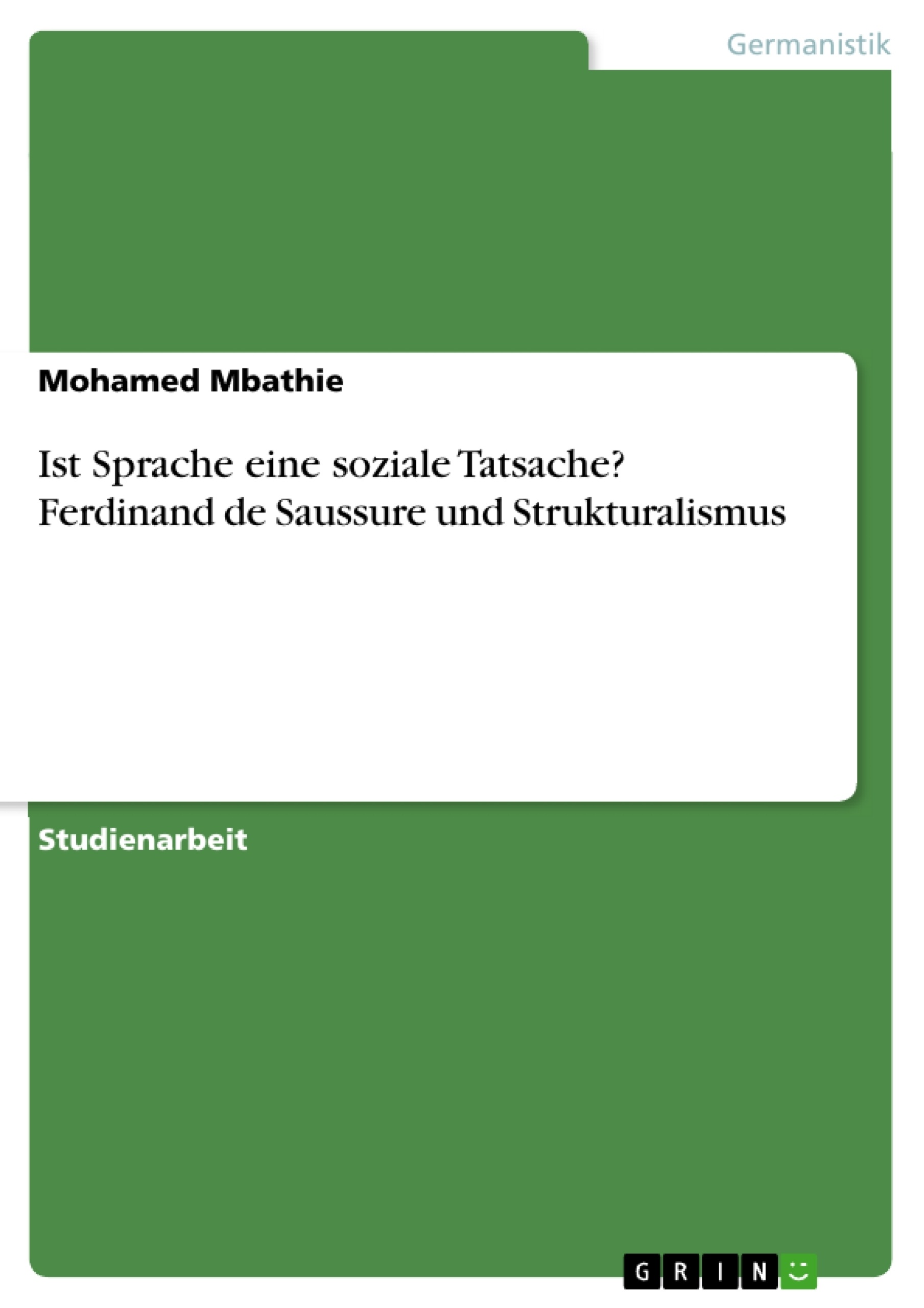Diese Arbeit geht, ausgehend von den Thesen von Ferdinand de Saussure, der Frage nach, ob Sprache als soziale Tatsache betrachtet werden kann.
Das Postum Cours de Linguistique Générale zählt als Grundlage, wodurch sich die Linguistik erst zu einer selbstständige Disziplin entwickelt hat. Die Cours de Linguistique Générale (in der nachfolgenden Arbeit mit C.L.G. abgekürzt) kann demzufolge auch als so genannte „Bibel der Linguist/innen“ bezeichnet werden und De Saussure als "Vater der Linguistik" betrachtet werden.
Im Kern seiner Arbeit geht es um die intensive Auseinandersetzung mit dem internen Charakter der Sprache bzw. die Sprache als ein sozialer Produkt der Fakultät der Sprachfähigkeit und als ein Ensemble von notwendige Bedingungen adoptiert von dem sozialen Korpus für das Ermöglichen der Ausübung dieser Fakultät bei dem Subjekt. In dem Kapitel drei der C.L.G, dem "Gegenstand der Sprachwissenschaft", unternimmt De Saussure einen Versuch die Sprache zu definieren, indem er "Langue", "Parole" und "Langage" (auf Deutsch: die "Sprache", die "Rede" und das "Sprachsystem") differenziert. Eines der wichtigsten Merkmale der Sprache ist jedoch, dass die Sprache sozial ist, denn die Sprache existiert nur im Kollektiven.
Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich daher dem Verstehen von De Saussure der "Langue"als ein "Fait social" (hier: soziale Realität). Im darauffolgenden Teil wird der Zeichenbegriff nach De Saussure genauer betrachtet, der sich auf den sozialen Aspekt der "Langue" konzentriert. In Kapitel 3 soll am Beispiel aus dem Phänomen "Kiezdeutsch"die sozialen Realität der Sprache, basierend auf der Forschung von De Saussure, analysiert werden, um zu verstehen, wie die Sprache als "fait social" (soziale Realität) zu verstehen ist. Ein zusammenfassendes Fazit schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Saussuresche Trichotomie: langage - langue - parole
- Die soziale Realität der Sprache
- Das sprachliche Zeichen nach Ferdinand De Saussure
- Eigenschaften der sprachlichen Zeichen
- Die Beliebigkeit des sprachlichen Zeichens
- Die Veränderlichkeit und Unveränderlichkeit des sprachlichen Zeichens
- Die lineare Charakter der sprachlichen Zeichen
- Analyse der sozialen Realität der Sprache am Beispiel vom Kiezdeutsch
- Kiezdeutsch und seine Partikularität
- Die Entstehung des Kiezdeutsches als eine soziale Tatsache
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Saussureschen Verständnis der Sprache als soziale Tatsache. Sie analysiert die Trichotomie "langage - langue - parole" und untersucht die Eigenschaften des sprachlichen Zeichens nach De Saussure. Am Beispiel des Kiezdeutsches wird die soziale Realität der Sprache veranschaulicht.
- Die Sprache als soziales Produkt der Sprachfähigkeit
- Die Bedeutung der "Langue" als "Fait social"
- Die Eigenschaften des sprachlichen Zeichens
- Die Analyse des Kiezdeutsches als Beispiel für soziale Sprachentwicklung
- Die Relevanz von De Saussures Werk für die Linguistik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz von De Saussures "Cours de Linguistique Générale" für die Linguistik heraus. Anschließend wird die Saussuresche Trichotomie "langage - langue - parole" erläutert und die "Langue" als soziale Realität definiert. Des Weiteren werden die Eigenschaften des sprachlichen Zeichens nach De Saussure beleuchtet, wobei die Beliebigkeit, Veränderlichkeit und Linearität des Zeichens besondere Aufmerksamkeit erhalten. Im dritten Kapitel wird das Kiezdeutsch als Beispiel für die soziale Realität der Sprache analysiert. Die Partikularität und die Entstehung des Kiezdeutsches als "soziale Tatsache" werden in diesem Kapitel ausführlich behandelt.
Schlüsselwörter
Ferdinand de Saussure, Sprachsystem, soziale Realität, langue, langage, parole, sprachliches Zeichen, Kiezdeutsch, soziale Sprachentwicklung, Linguistik, "Cours de Linguistique Générale", "Fait social".
Häufig gestellte Fragen
Ist Sprache eine „soziale Tatsache“?
Ja, nach Ferdinand de Saussure existiert die „Langue“ nur im Kollektiven und ist ein soziales Produkt der Sprachfähigkeit.
Was unterscheidet Langue, Parole und Langage?
Langage ist das Sprachvermögen, Langue das abstrakte Sprachsystem und Parole die individuelle Sprechhandlung.
Was sind die Merkmale des sprachlichen Zeichens?
Zentrale Merkmale sind die Beliebigkeit (Arbitrarität), die Linearität sowie die Veränderlichkeit bzw. Unveränderlichkeit.
Wie dient Kiezdeutsch als Beispiel für eine soziale Tatsache?
Kiezdeutsch zeigt, wie sich neue sprachliche Normen innerhalb einer sozialen Gruppe entwickeln und als Realität etabliert werden.
Wer gilt als „Vater der Linguistik“?
Ferdinand de Saussure, dessen Werk „Cours de Linguistique Générale“ die moderne Sprachwissenschaft begründete.
- Arbeit zitieren
- Mohamed Mbathie (Autor:in), 2019, Ist Sprache eine soziale Tatsache? Ferdinand de Saussure und Strukturalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511847