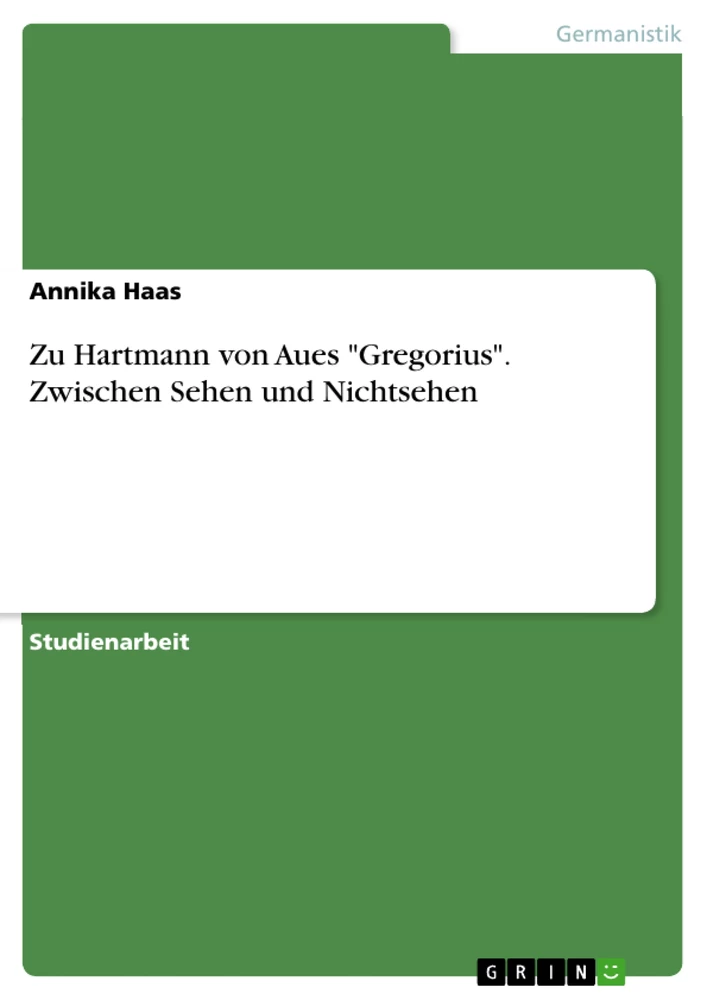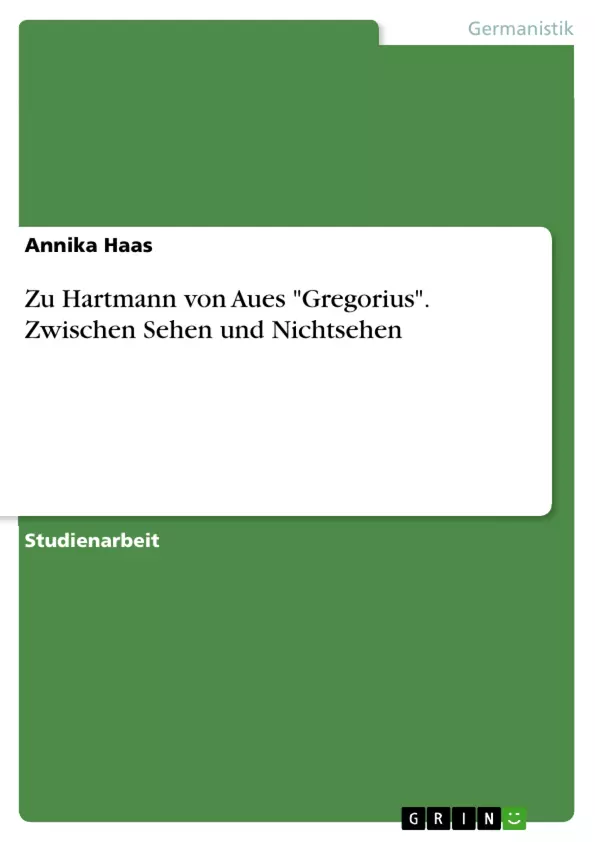Wir ‚sehen‘ zumeist ohne darüber nachzudenken, wie Sehen mit unserem Vorwissen zusammenhängt und in verschiedene Schubladen gepackt wird. Ob wir das ‚Wahre‘ und ‚Richtige‘ erkennen, ist niemandem bekannt, denn die Wahrnehmung ist letztlich bei jedem verschieden. So liegt es auch im Auge des Betrachters, was Schönheit ist, und die Liebe lässt bekanntlich jeden erblinden. Diese Vorstellungen sind zeit- und kontextspezifisch. Im religiösen Kontext findet sich im Markusevangelium ein treffendes Zitat, welches Gläubige beschreibt, die metaphorisch nicht sehen – wohl übertragen auf das Wort Gottes und die Erkenntnis des Glaubens an Gott – und Gott ihnen trotzdem diese Sünde vergibt.
„Auf daß sie es mit sehenden Augen sehen, und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören, und doch nicht verstehen, auf daß sie sich nicht dermaleinst bekehren und ihre Sünden ihnen vergeben werden.“
Sehen und Nicht-sehen ist im Allgemeinen für die mittelalterliche Gesellschaft in metaphorischer Weise über die biblischen Geschichten, oder andere schriftliche – doch zumeist mündliche – Erzählungen bekannt. Das Nicht-sehen und das darauffolgende Vergeben seiner Sünden ist auch für den Protagonisten Gregorius in der gleichnamigen höfischen Legende Hartmann von Aues das Handlungsmotiv. Dabei geht es um viel mehr, als um das bloße Nicht-sehen und Sehen auf religiöser Ebene.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Lesersicht - Rezipientenebene
- 2.1 Erzählperspektive
- 2.2 Kontrastreiche Bilder
- 2.3 Mittelalterliche Konvention
- 3 Sehen auf Figurenebene
- 3.1 Verheimlichung
- 3.2 Zufall
- 3.3 Widerspruch
- 3.5 Medienhistorik
- 4 Resümee unter Einbezug der Autorperspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept von „Sehen und Nicht-Sehen“ in Hartmann von Aues Gregorius. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte des Sehens in der Legende zu untersuchen und die Bedeutung dieses Themas für die Rezeption des Werkes zu beleuchten.
- Erzählperspektive und die Rolle des Lesers
- Kontrastreiche Bilder und deren Wirkung
- Mittelalterliche Konventionen im Kontext von Sehen und Nicht-Sehen
- Sehen und Verheimlichung auf der Figurenebene
- Die Bedeutung von historischen Aspekten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Thema "Sehen und Nicht-Sehen" ein und zeigt dessen Bedeutung für die mittelalterliche Gesellschaft und die Legende des Gregorius.
Kapitel 2 untersucht die Lesersicht, indem es die Erzählperspektive, die kontrastreichen Bilder und die mittelalterlichen Konventionen beleuchtet. Die Erzählperspektive im Prolog schafft Spannung und erzeugt einen Kontrast zwischen dem "Wie" und dem "Was" der Handlung. Die Beschreibung Gregorius's durch den Erzähler beinhaltet kontrastreiche Bilder, die die Hässlichkeit seiner Buße und seinen inneren Wert betonen.
Kapitel 3 fokussiert auf das Sehen auf der Figurenebene. Es werden Themen wie Verheimlichung, Zufall und Widerspruch sowie die Bedeutung der Medienhistorik betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Konzept des Sehens in Hartmann von Aues Gregorius, wobei die Analyse auf Themen wie Erzählperspektive, Kontrast, mittelalterliche Konventionen, Verheimlichung, Zufall und Widerspruch fokussiert. Darüber hinaus werden historische Aspekte der Legende und die Rolle der Medienhistorik beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Welches zentrale Motiv prägt Hartmann von Aues „Gregorius“?
Das Motiv des „Sehens und Nichtsehens“ ist zentral, sowohl im Sinne der physischen Wahrnehmung als auch als Metapher für religiöse Erkenntnis und Verblendung.
Warum erkennen sich Gregorius und seine Mutter nicht?
Das „Nichtsehen“ der Wahrheit (ihrer Verwandtschaft) führt zum unbeabsichtigten Inzest, was als göttliche Prüfung und Teil des sündhaften Schicksals interpretiert wird.
Welche Rolle spielt die Erzählperspektive im Werk?
Der Erzähler nutzt Kontraste und Vorausdeutungen, um beim Rezipienten ein Wissen zu erzeugen, das den Figuren im Werk fehlt, was die Spannung und moralische Tiefe erhöht.
Was bedeutet Schönheit im Kontext von Gregorius?
Schönheit wird oft als Zeichen innerer Güte gesehen, kann aber auch blenden. Gregorius' extreme Buße (Hässlichkeit) steht im Kontrast zu seiner inneren Heiligkeit.
Wie wird das Thema Vergebung im Werk behandelt?
Trotz der schweren Sünden (Inzest) zeigt die Legende, dass durch radikale Buße und die Gnade Gottes Vergebung möglich ist, wenn der Mensch zur wahren Erkenntnis „sieht“.
- Citar trabajo
- Annika Haas (Autor), 2017, Zu Hartmann von Aues "Gregorius". Zwischen Sehen und Nichtsehen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511852