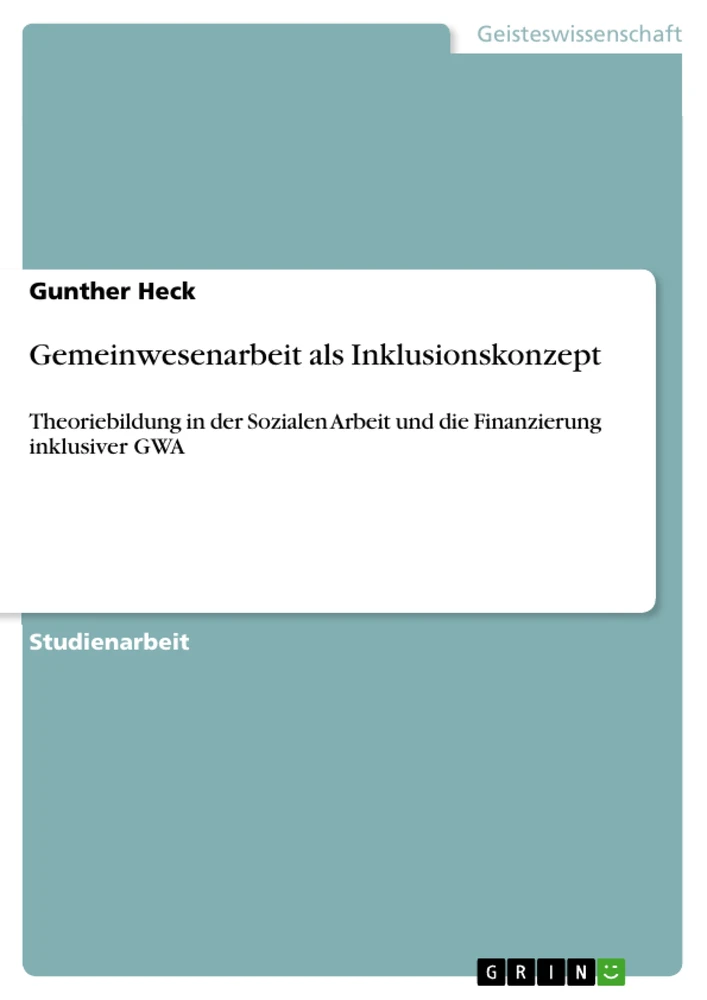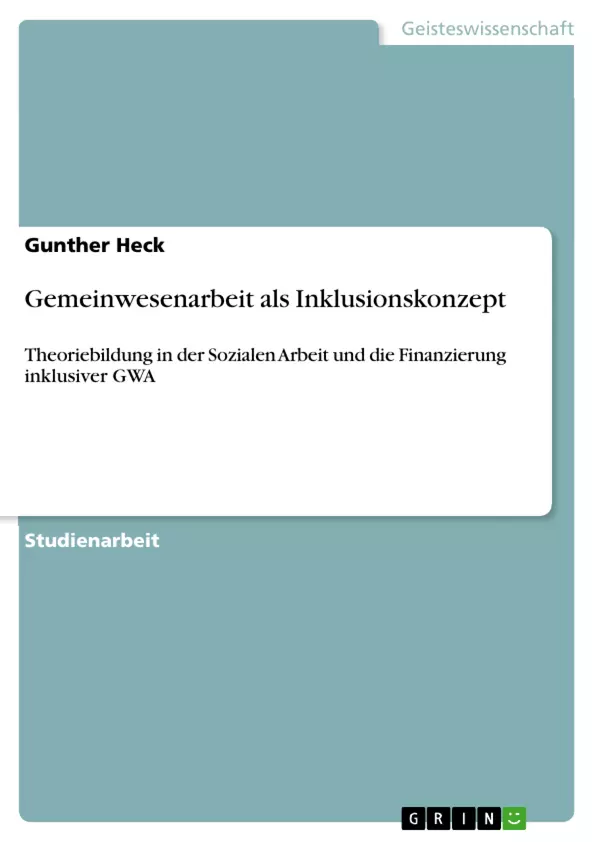Die Fragestellung und mein Erkenntnisinteresse dieser Hausarbeit ist es, ob eine Konzeption inklusiver GWA eine theoretische Grundlage für die Soziale Arbeit darstellt, die Partizipation ermöglicht, sowie den Kritik- wie Machtdiskurs führt. Dieses impliziert die andere Frage, ob eine inklusiv- und machtpartizipative GWA eine finanzielle Absicherung im Gemeinwesen - als Pflichtaufgabe von Bund, Länder und Gemeinden - erhalten muss.
Inklusion, Nachhaltigkeit und Partizipation haben einen immer hören Stellenwert in Deutschland, Europa und in einer globalisierten Welt. Die Hausarbeit beruht auf der Erkenntnis, dass Gemeinwesenarbeit (GWA) über den Horizont einer territorialen Stadtteilarbeit herausragt. Die politische und ökonomische Dimension kommt zu der räumlichen hinzu und beeinflussen sich wechselseitig. Die GWA ist sich dieser Wechselwirkung bewusst, die auf den Stadtteil und ihre Bewohnerinnen und Bewohner einwirkt.
Ungleiche Ressourcenverteilung der Weltbevölkerung, Naturausbeutung, Klimakatastrophen, Lebensraumzerstörung, sowie eine Zunahme von Armut beeinträchtigen das Überleben großer Teile der Menschheit. Die wahrnehmbare soziale Gleichgültigkeit und zunehmende Naturzerstörung sind der Grund dafür, dass immer mehr Menschen ein alternatives Wirtschaften, eine andere Vorstellung von Wohlfahrt und ein anderes Verständnis vom guten Leben entwickeln. Die Soziale Arbeit hat, hinsichtlich ihrer Erfahrungen bzgl. von sozialwissenschaftlicher Aktionsforschung, im Zusammenhang mit Community Development, die Ressourcen um partizipative, emanzipative und inklusive Gemeinwesenarbeit theoretisch und praktisch weiterzuentwickeln. Aus der Transformation der Entwicklung - von der vorhandenen Methodenvielfalt - im Community Work würde Soziale Arbeit wieder die vergangene Entwicklung der scheinbaren therapeutischen und managementorientierten Grundrichtung korrigieren, die sie in der Mitte der 1990er Jahren eingeschlagen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung - Inklusionskonzept und Macht in der GWA
- Gemeinwesenarbeit als Inklusionskonzept
- Grundlagen für eine inklusive Soziale Arbeit im Gemeinwesen
- „Behinderung“ und be-hindernde Gesellschafts- und Organisationsstrukturen
- Inklusion und Exklusion
- Der semantische Ursprung des Wortes „Inklusion“
- Inklusionsbegriff nach der UN-BRK und die Stellung von Wohnen und Gemeinde
- Exklusion: Inkludierte und nicht integrierte Menschen
- Diskus über Teilhabe
- Teilhabe durch Arbeit
- Teilhabe und Partizipation
- Empowerment
- Integration als ganzheitlich system-ökologische Grundvoraussetzung von Inklusion
- Zur Theoriebildung der GWA als Inklusionskonzept in der Sozialen Arbeit
- Soziale Identität -Demokratiebildung, Adressierung und Inklusion in der GWA
- Reflexion und Professionalisierung Sozialer Arbeit in der GWA
- Rolle Professioneller in der Sozialen Arbeit
- Inklusion und Teilhabeplanung - Daseinsvorsorge mit Menschen im Gemeinwesen
- Legitimation Sozialer Arbeit in der GWA im Kontext unterschiedlicher Perspektiven
- Risiken in der GWA im Rahmen öffentlicher und privater Finanzierung
- Rechtliche Voraussetzungen und Pflichten der Finanzierung
- Kommunale Daseinsfürsorge, Sozialinvestitionen, Ehrenamt und Aktivierung
- Sicherstellung der Finanzierung inklusiver Gemeinwesenarbeit und Evaluation
- Kostenneutralität der Inklusion
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob eine Konzeption inklusiver Gemeinwesenarbeit (GWA) eine theoretische Grundlage für die Soziale Arbeit darstellt, die Partizipation ermöglicht und gleichzeitig den Kritik- und Machtdiskurs führt. Dabei wird auch untersucht, ob eine inklusiv- und machtpartizipative GWA eine finanzielle Absicherung im Gemeinwesen als Pflichtaufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden erhalten muss.
- Inklusionskonzepte in der Gemeinwesenarbeit
- Theoriebildung der Gemeinwesenarbeit als Inklusionskonzept
- Partizipation und Empowerment in der Sozialen Arbeit
- Finanzierung inklusiver Gemeinwesenarbeit
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Pflichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einführung, die die Bedeutung von Inklusion, Nachhaltigkeit und Partizipation in einer globalisierten Welt betont. Sie stellt die GWA als ein Konzept vor, das über die territoriale Stadtteilarbeit hinausgeht und die politische und ökonomische Dimension mit einbezieht.
Im ersten Kapitel wird die GWA als Inklusionskonzept näher beleuchtet. Dabei werden die Grundlagen für eine inklusive Soziale Arbeit im Gemeinwesen, die Bedeutung der UN-BRK, sowie die Herausforderungen von „Behinderung“ und be-hindernden Gesellschaftsstrukturen diskutiert.
Das zweite Kapitel widmet sich der Theoriebildung der GWA als Inklusionskonzept in der Sozialen Arbeit. Es werden die Themen Soziale Identität, Demokratiebildung, Adressierung und Inklusion, sowie die Reflexion und Professionalisierung Sozialer Arbeit in der GWA beleuchtet. Hierbei werden die Rollen von Professionellen, die Bedeutung von Inklusion und Teilhabeplanung sowie die Legitimation Sozialer Arbeit in der GWA im Kontext unterschiedlicher Perspektiven diskutiert.
Schlüsselwörter
Gemeinwesenarbeit, Inklusion, Partizipation, Empowerment, Theoriebildung, Soziale Arbeit, UN-BRK, Behinderung, Finanzierung, Rechtliche Rahmenbedingungen, Macht, Kritik, Sozialpolitik, Daseinsvorsorge.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Gemeinwesenarbeit (GWA) als Inklusionskonzept verstanden?
GWA geht über Stadtteilarbeit hinaus und nutzt politische sowie ökonomische Dimensionen, um echte Partizipation und Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen.
Welche Bedeutung hat die UN-BRK für die GWA?
Die UN-Behindertenrechtskonvention liefert die rechtliche Basis für Inklusion und fordert die Gestaltung von Lebensräumen, in denen niemand exkludiert wird.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Während Integration oft die Anpassung des Einzelnen an das System meint, fordert Inklusion, dass sich die Strukturen (Gemeinwesen) ändern, um Vielfalt zu ermöglichen.
Muss inklusive GWA staatlich finanziert werden?
Die Arbeit argumentiert, dass inklusive Gemeinwesenarbeit eine Pflichtaufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge sein muss, um nachhaltig wirken zu können.
Was bedeutet Empowerment in der Sozialen Arbeit?
Empowerment zielt darauf ab, Menschen zu befähigen, ihre Interessen selbst zu vertreten und Macht über ihre eigenen Lebensumstände zurückzugewinnen.
- Arbeit zitieren
- Gunther Heck (Autor:in), 2019, Gemeinwesenarbeit als Inklusionskonzept, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511899