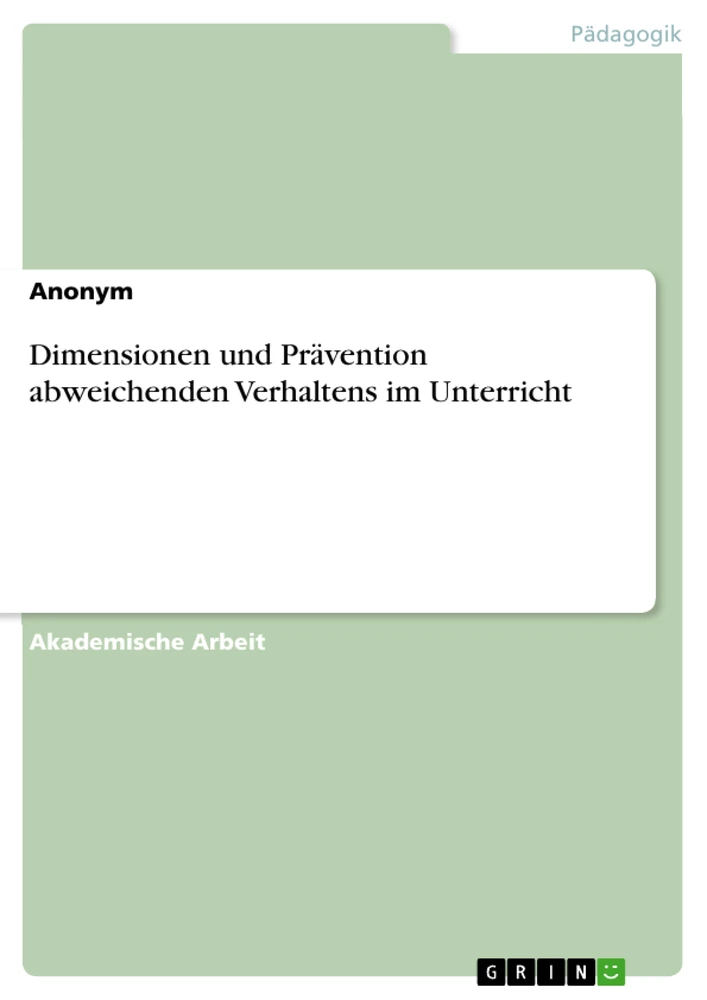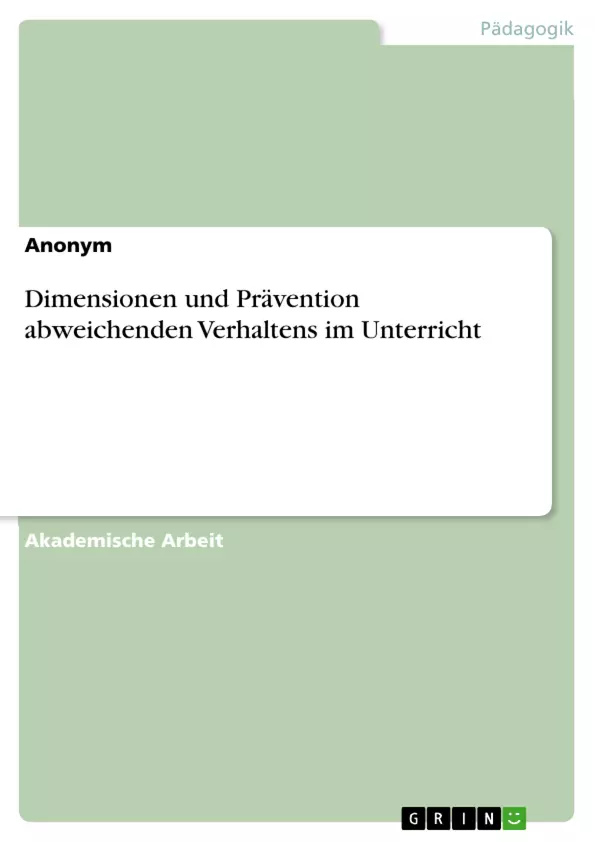Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine analytische Auseinandersetzung von Verhaltensweisen von Lehrpersonen zu vollziehen, die die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Störungen reduzieren. Ziel ist es, der Frage nachzugehen, warum sich der Unterricht bestimmter Lehrkräfte störungsärmer gestaltet als der Unterricht anderer Lehrpersonen.
Die strategische Bewältigung von Unterrichtsstörungen stellt einen wesentlichen Bestandteil des Lehrerberufs und des Lehreralltags dar. Ohne ein ausreichendes Maß an Disziplin im Klassenzimmer kann weder die Lehrkraft seine Unterrichtsziele erreichen, noch können die Schüler/innen ihre Lernprozesse erfolgreich gestalten. Nicht weniger zu beachten ist der Verlust aktiver Lernzeit, der durch das gehäufte Auftreten von Störungen, die eine Unterbrechung des Unterrichtsflusses zur Folge haben, zustande kommt.
In Lehrerbelastungsstudien wurde nachgewiesen, dass nicht nur die Wirksamkeit des Unterrichts, sondern auch die seelische Gesundheit der Lehrperson in erheblichem Maße durch permanente Unterrichtsstörungen beeinträchtigt werden kann. So werden Unterrichtsstörungen von Lehrkräften als wesentlicher Belastungsfaktor beim Unterrichten eingeschätzt.
In Anbetracht dieser Konsequenzen für die Gesundheit der Lehrperson und für die Unterrichtswirksamkeit, ist das Ausbildungsdefizit diesbezüglich Anlass zur Verwunderung, denn der Ausbildungsschwerpunkt angehender Lehrkräfte findet sich im Bereich der Methodik, Didaktik und der Fachkompetenz. Die Gründe für diese Schwerpunktsetzung sind vor dem Hintergrund der vielschichtigen Anforderungen des Lehrerberufs nachvollziehbar, dennoch ist die Signifikanz des "Disziplinmanagements" als wesentlicher Bestandteil der Professionalität des Lehrers nicht zu vernachlässigen.
Basierend auf den genannten Tatsachen und auf eigene Erfahrungen mit dem Phänomen im Rahmen des Praxissemesters soll eine lehrerzentrierte und praxisorientierte Auseinandersetzung mit Unterrichtsstörungen Kerngegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Die in der Fachliteratur vorzufindenden Handlungsstrategien sind unterteilt in Interventionsstrategien, die Reaktionen auf bereits eingetretene Störungen darstellen, und präventive Strategien, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Störungen minimieren. Letztere spielen eine signifikantere Rolle, weil diese das Kernanliegen der täglichen Klassenführung sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Dimensionen abweichendem Verhaltens im Unterricht
- 2.1 Unterrichtsstörung: eine Definition
- 2.2 Erscheinungsformen
- 2.3 Ursachen
- 3. Kounins Dimensionen des Lehrerverhaltens
- 3.1 Allgegenwärtigkeit
- 3.2 Reibungslosigkeit
- 3.3 Aufrechterhaltung des Gruppenfokus
- 3.4 Programmierte Überdrussvermeidung
- 4. Analyse präventiver lehrerzentrierter Strategien
- 4.1 Prävention durch breite Aktivierung
- 4.1.1 Motivation
- 4.1.2 Impulsgebung
- 4.1.3 Breite Kontrolle
- 4.1.4 Positive Kommentar-Impulse
- 4.1.5 Binnendifferenzierung zur Förderung der breiten Aktivierung im Fremdsprachenunterricht
- 4.2 Prävention durch Unterrichtsfluss
- 4.3 Prävention durch Präsenz- und Stoppsignale
- 4.4 Prävention durch Regeln
- 5. Fazit und Ausblick auf eine möglichst störungsarme Praxis
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen von Unterrichtsstörungen und analysiert die Rolle des Lehrerverhaltens in der präventiven Vermeidung solcher Störungen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Ursachen und Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen zu entwickeln und die Effektivität von lehrerzentrierten Strategien zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens zu untersuchen. Die Arbeit geht der Frage nach, warum der Unterricht bestimmter Lehrkräfte von Grund auf störungsarmer gestaltet ist als der Unterricht anderer Lehrkräfte.
- Definition und Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen
- Ursachen für Unterrichtsstörungen auf Schüler- und Lehrerebene
- Kounins Dimensionen des Lehrerverhaltens und deren Einfluss auf Unterrichtsstörungen
- Analyse präventiver lehrerzentrierter Strategien zur Minimierung von Unterrichtsstörungen
- Zusammenhang zwischen Lehrerverhalten und einer möglichst störungsarmen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Unterrichtsstörungen für den Lernerfolg der Schüler und die seelische Gesundheit der Lehrkraft. Sie stellt das Ausbildungsdefizit in diesem Bereich dar und definiert das Ziel der vorliegenden Arbeit als eine praxisorientierte Auseinandersetzung mit Unterrichtsstörungen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Dimensionen abweichenden Verhaltens im Unterricht. Es definiert den Begriff der Unterrichtsstörung, untersucht die vielfältigen Erscheinungsformen und analysiert die Ursachen auf Schülerseite.
Das dritte Kapitel stellt die Dimensionen des Lehrerverhaltens nach Kounin vor. Es beleuchtet die Bedeutung von Allgegenwärtigkeit, Reibungslosigkeit, Aufrechterhaltung des Gruppenfokus und programmierter Überdrussvermeidung für eine störungsarme Unterrichtsgestaltung.
Kapitel vier analysiert verschiedene präventive lehrerzentrierte Strategien, die dazu beitragen können, die Wahrscheinlichkeit von Unterrichtsstörungen zu minimieren. Es werden Strategien zur breiten Aktivierung, zur Gestaltung des Unterrichtsflusses, zum Einsatz von Präsenz- und Stoppsignalen und zur Etablierung von Regeln vorgestellt.
Schlüsselwörter
Unterrichtsstörungen, Lehrerverhalten, Präventive Strategien, Klassenführung, Unterrichtsfluss, Aktivierung, Motivation, Disziplinmanagement, Kounins Dimensionen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für Unterrichtsstörungen?
Ursachen liegen oft in der mangelnden Motivation der Schüler, aber auch in Defiziten der Klassenführung oder unklaren Regeln seitens der Lehrkraft.
Was versteht Kounin unter "Allgegenwärtigkeit"?
Es ist die Fähigkeit der Lehrkraft, den Schülern zu vermitteln, dass sie jederzeit über alles im Bilde ist, was im Klassenzimmer geschieht ("Augen im Hinterkopf").
Wie kann man Störungen präventiv vermeiden?
Durch einen reibungslosen Unterrichtsfluss, breite Aktivierung aller Schüler, klare Regeln und den Einsatz nonverbaler Präsenz- und Stoppsignale.
Warum ist "Disziplinmanagement" für Lehrer gesundheitsrelevant?
Permanente Störungen sind ein massiver Belastungsfaktor, der zu Burnout und psychischen Erkrankungen führen kann. Ein störungsarmer Unterricht schützt die Gesundheit der Lehrkraft.
Was bedeutet "Aufrechterhaltung des Gruppenfokus"?
Die Lehrkraft stellt sicher, dass während des Unterrichts möglichst alle Schüler gleichzeitig kognitiv aktiviert und in das Geschehen einbezogen bleiben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Dimensionen und Prävention abweichenden Verhaltens im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511919