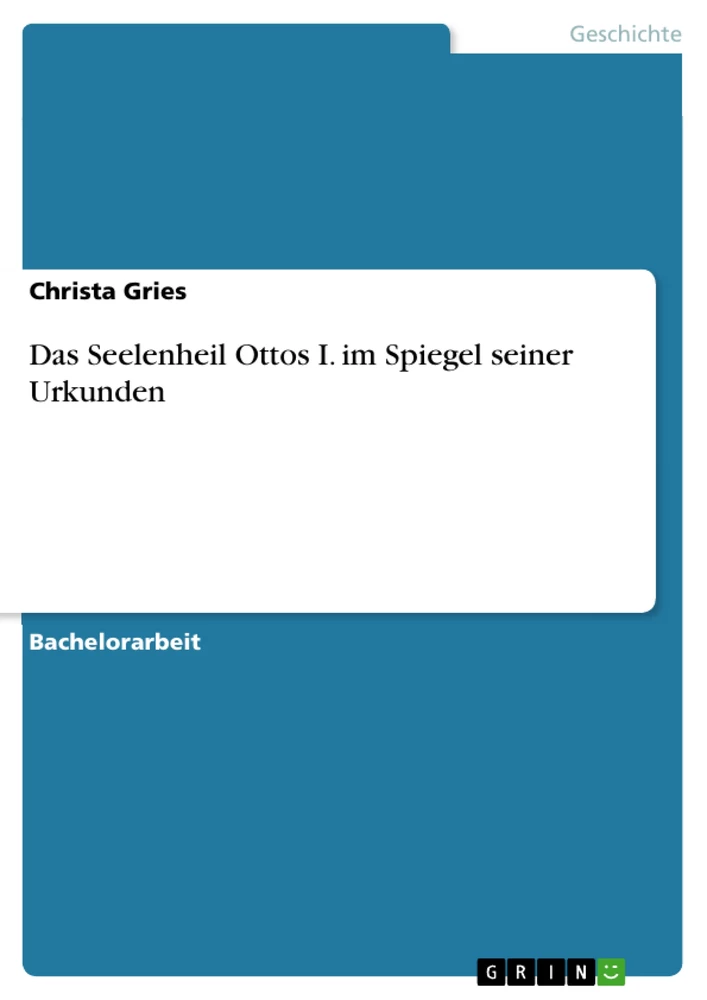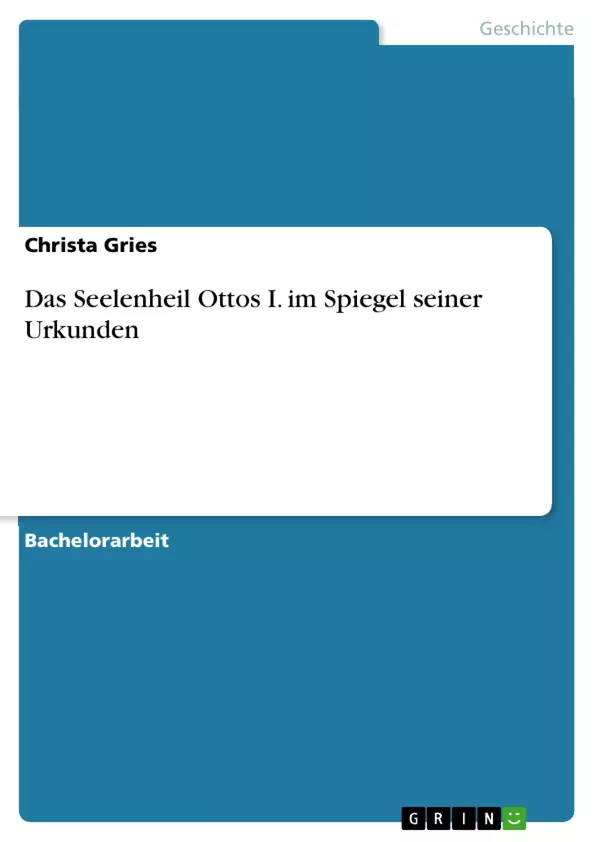Auswertung der 466 Urkunden Ottos des Großen auf Informationen zu seiner Seelenheilsvorsorge. In der heutigen Geschichtsforschung gilt Otto als König von großer pietas, dessen Jenseitsängste unbegründet scheinen. Im späteren Mittelalter dagegen zeichneten Dichter das Bild eines jähzornigen und grausamen Kaisers. Konrad von Würzburg zum Beispiel ließ im Versepos "Heinrich von Kempten", das auf einer Episode im Pantheon Gottfrieds von Viterbo aus dem 12. Jahrhundert beruhte, einen "bösen König Otte" auftreten, der unklare Rechtsfälle auch am heiligen Ostersonntag aus ungezügeltem Zorn mit dem Tod bestrafte. Demnach hätte der Kaiser sogar gute Gründe gehabt, sich um sein Seelenheil zu sorgen und Gott ein so herausragendes Geschenk wie das Magdeburger Erzbistum anzubieten. Lässt sich die Sorge um das Seelenheil im Spiegel der Urkunden Ottos I. nachvollziehen?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. QUELLEN, METHODIK UND FORSCHUNGSÜBERBLICK
- 1.1 ZU DEN QUELLEN
- 1.2 METHODIK
- 1.3 KURZER ABRISS ZUR FORSCHUNGSLITERATUR
- 2. JENSEITSVORSTELLUNG UND BUẞPRAXIS IM FRÜHEN MITTELALTER
- 3. DIE BESONDERE GEFÄHRDUNG DES SEELENHEILS OTTOS I
- 3.1 HERAUSFORDERUNG UND CHANCE: KÖNIGTUM UND KAISERWÜRDE
- 3.2 DIE GEFAHR DER SÜNDE BEI DER HERRSCHAFTSAUSÜBUNG
- 3.2.1 Aufgabe: Frieden und Gerechtigkeit
- 3.2.2 Aufgabe: Schutz der Kirche
- 3.2.3 Ottos Schwäche: Ira statt Clementia
- 4. DIE SORGE OTTOS I. FÜR SEIN SEELENHEIL
- 4.1 HERRSCHERLICHE VERSUS SEELENSHEILSORIENTIERTE MOTIVATION
- 4.2 OTTOS I. MAẞNAHMEN FÜR SEIN SEELENHEIL
- 4.2.1 Klostergründungen zur Familienmemoria
- 4.2.2 Zuschenkungen an kirchliche Institutionen
- 4.2.3 Förderung der Mönche
- 4.2.4 Heilige und Reliquien
- 4.2.5 Das Grab im Dom
- 5. DIE SORGE OTTOS I. IM SPIEGEL SEINER URKUNDEN
- 5.1 DIE URKUNDENDATEI
- 5.2 DAS SEELENHEILSMOTIV IN DER HERRSCHAFTSFÜHRUNG
- 5.2.1 Privilegierung der geistlichen Institutionen
- 5.2.2 Bevorzugung der Reformklöster
- 5.2.3 Förderung Magdeburgs und des hl. Mauritius
- 5.3 DIE SORGE UM DAS SEELENHEIL IN DEN URKUNDENFORMELN
- 5.3.1 Das Seelenheil in den Arengen
- 5.3.2 Schenkungen mit Gebetsklauseln: ut pro nobis exorarent
- 5.3.3 Schenkungen für das Seelenheil: pro remedio animae nostrae
- 6. DIE MEMORIA OTTOS I
- 6.1 OTTO I. IM GEDÄCHTNIS DER REICHSKIRCHE
- 6.2 DIE OTTONISCHE TOTENMEMORIA
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Sorge Ottos I. um sein Seelenheil im Spiegel seiner Urkunden. Ziel ist es, aufzuzeigen, inwieweit sich Ottos Bemühungen um sein Seelenheil in seinen Urkunden widerspiegeln. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, ob die Sorge um das Seelenheil ein entscheidender Faktor für seine politische Handlungsweise war.
- Die Rolle des Seelenheils in der ottonischen Herrschaftsauffassung
- Die Herausforderungen und Chancen des Seelenheils im Kontext der Königswürde
- Die Bedeutung von Schenkungen und Privilegien für das Seelenheil
- Die Bedeutung der Memoria und des Gedenkens für den Herrscher
- Die Rolle der geistlichen Institutionen in Ottos Bemühungen um sein Seelenheil
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Rolle der Sorge um das Seelenheil im Spiegel der Urkunden Ottos I. vor. Das erste Kapitel behandelt die Quellen, die Methodik und den Forschungsüberblick. Es werden die wichtigsten Quellen für die Untersuchung, wie z. B. die Urkunden des Kaisers und zeitnahe historiographische Texte, vorgestellt. Des Weiteren werden die Methodik der Arbeit und die relevante Forschungsliteratur zusammengefasst.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Jenseitsvorstellung und Bußpraxis im frühen Mittelalter. Es wird der Kontext der Zeit und die Bedeutung des Seelenheils für die Menschen im frühen Mittelalter erläutert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der besonderen Gefährdung des Seelenheils Ottos I. im Kontext seiner Herrschaftsrolle. Es wird aufgezeigt, welche Herausforderungen und Chancen das Seelenheil im Kontext des Königtums und der Kaiserwürde mit sich brachte.
Das vierte Kapitel fokussiert auf Ottos Sorge um sein Seelenheil. Es werden seine Maßnahmen zur Sicherung seines Seelenheils wie Klostergründungen, Schenkungen an die Kirche, Förderung der Mönche und die Gestaltung seiner Grablege vorgestellt. Das fünfte Kapitel untersucht Ottos Sorge um sein Seelenheil im Spiegel seiner Urkunden. Es wird die Urkunden-Datei analysiert und die verschiedenen Formulierungen und Motive, die auf eine Sorge um das Seelenheil hindeuten, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themenbereiche Seelenheil, ottonische Herrschaftsauffassung, Urkundenforschung, mittelalterliche Jenseitsvorstellung, Memoria, Schenkungen, Privilegien, geistliche Institutionen, Otto I., Magdeburg.
Häufig gestellte Fragen
Wie sorgte Otto der Große für sein Seelenheil vor?
Otto I. nutzte Klostergründungen (z.B. Magdeburg), Schenkungen an die Kirche, die Förderung von Mönchen und das Sammeln von Reliquien, um göttlichen Beistand für sein Jenseits zu sichern.
Was verraten Ottos Urkunden über seine Frömmigkeit?
Die Urkunden enthalten spezifische Formeln wie „pro remedio animae nostrae“ (zum Heil unserer Seele) und Gebetsklauseln, die belegen, dass religiöse Motive fest in seinem Herrschaftshandeln verankert waren.
Warum war das Seelenheil für einen mittelalterlichen König besonders gefährdet?
Die Herrschaftsausübung erforderte oft harte Entscheidungen, Kriegführung und das Ausüben von Zorn (Ira), was im Widerspruch zu christlichen Tugenden wie Milde (Clementia) stand und Bußbedarf erzeugte.
Welche Bedeutung hatte Magdeburg für Otto I.?
Magdeburg war Ottos Lieblingsstiftung. Die Errichtung des Erzbistums und sein dortiges Grab dienten als zentrales Monument seiner persönlichen Memoria und Seelenheilsvorsorge.
Wie wandelte sich das Bild Ottos I. in der späteren Geschichtsschreibung?
Während die moderne Forschung oft seine Pietas betont, zeichneten Dichter des späteren Mittelalters ihn teils als jähzornigen Herrscher, was seine massiven Investitionen in das Seelenheil plausibel erscheinen lässt.
- Citar trabajo
- Christa Gries (Autor), 2019, Das Seelenheil Ottos I. im Spiegel seiner Urkunden, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512232