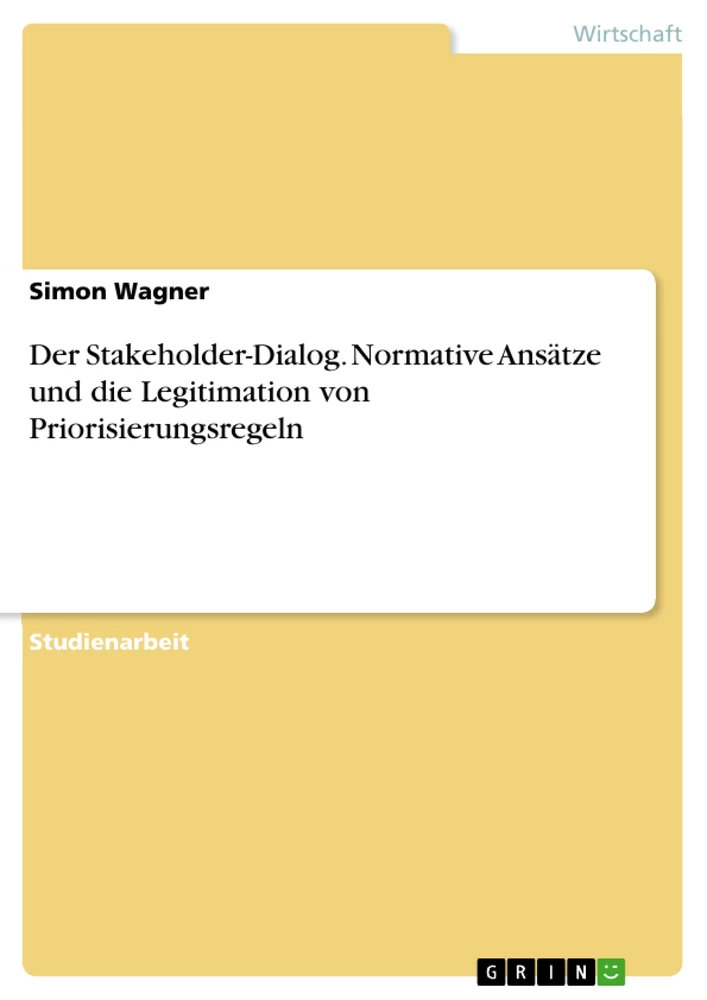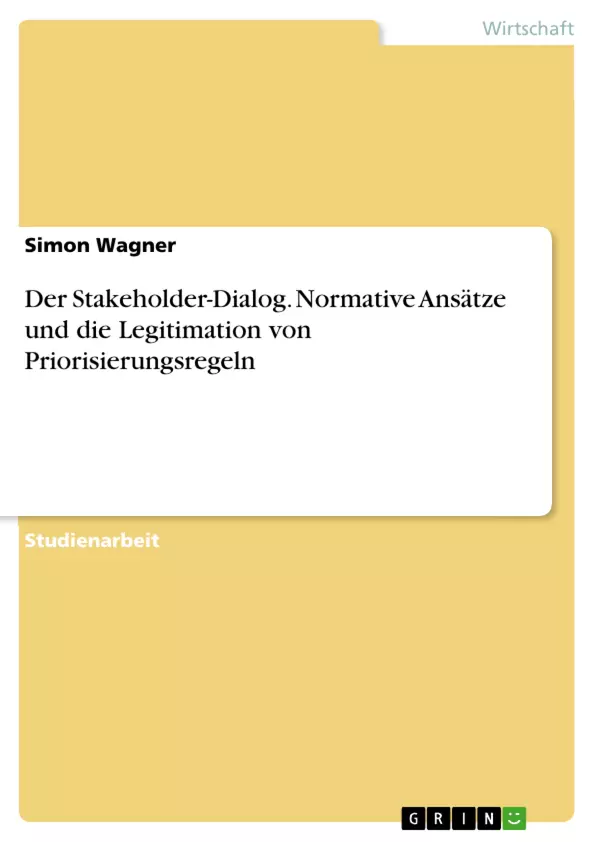Zunächst sollen in dieser Seminararbeit der Begriff Stakeholder und die damit verbundenen Eigenschaften und Theorien näher betrachtet werden. Dadurch entstehen automatisch Verbindungen zu normativen Ansätzen. Unter diesem Punkt werden Aussagen verschiedener Philosophen erläutert und eine Verbindung von normativen Fragen zum Stakeholdermanagement geschlossen. Da ein Unternehmen nicht jede Interessengruppe gleich behandeln kann, ja sogar manche bevorzugen muss, wird abschließend die Möglichkeit einer Priorisierung behandelt. In diesem Zuge wird außerdem ein Beispiel einer Rangliste der Stakeholder erstellt.
In Zeiten des Klimawandels und sonstigen gesellschaftlich relevanten Themen muss sich nicht nur die Politik auf eine veränderte Strategie und Kommunikation einstellen. Unternehmen bieten durch die Multi-Media-Kommunikation eine breite Angriffsfläche für alle möglichen Interessengruppen. Der Schwerpunkt liegt nicht nur auf immer weiterwachsenden Umsätzen und Gewinnen, sondern auch auf der unternehmerischen Sozialverantwortung. Eine nachhaltige Entwicklung im Hinblick auf Umweltaspekte, die Kommunikation und der Austausch mit Mitarbeitern sowie verschiedenen Interessengruppen gewinnen an Bedeutung. In Dialogen mit Interessengruppen werden subjektive Meinungen besprochen. Edward Freeman legte den Grundstein für die Rücksichtnahme auf Stakeholder. Dabei entstehen moralische Fragen und der ethische Konflikt, welche Interessengruppe wie und mit welcher Priorisierung behandelt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Definition von Stakeholdern
- 2.1 Die Stakeholder-Theorie nach Freeman
- 2.2 Der Stakeholder-Dialog
- 3 Normative Ansätze als Rational-Choice Theorie
- 3.1 Aussagen von Philosophen
- 3.1.1 Erklärung von Jürgen Habermas
- 3.1.2 Erklärung von David Hume
- 3.2 Übertragung auf das Stakeholdermanagement
- 3.3 Corporate Social Responsibility
- 4 Die Legitimation von Priorisierungsregeln
- 4.1 Identifizierung von Stakeholdern
- 4.1.1 Stakeholder Issues Management
- 4.1.2 Stakeholder Typologie Power-Legitimacy-Urgency
- 4.2 Möglichkeiten der Priorisierung
- 4.3 Nennung und Rangfolge der Stakeholder
- 4.4 Beispiel aus der Praxis – Axel Springer SE
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Stakeholder-Dialog und die Legitimation von Priorisierungsregeln im Kontext von Unternehmensethik. Sie beleuchtet die Definition von Stakeholdern und deren Bedeutung für das Management. Die Arbeit analysiert normative Ansätze und deren Anwendung im Stakeholdermanagement, unter Berücksichtigung philosophischer Perspektiven. Schließlich befasst sie sich mit der Frage der Legitimation von Priorisierungsregeln für Stakeholder und illustriert dies anhand eines Praxisbeispiels.
- Definition und Theorie der Stakeholder
- Normative Ansätze im Stakeholdermanagement
- Legitimation von Priorisierungsregeln für Stakeholder
- Anwendung philosophischer Konzepte auf das Stakeholdermanagement
- Praxisbeispiel zur Stakeholder-Priorisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext von Unternehmensethik im Zeitalter des Klimawandels und der Multi-Media-Kommunikation. Sie betont die zunehmende Bedeutung von unternehmerischer Sozialverantwortung und Stakeholder-Dialogen. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Stakeholder-Definition, normativer Ansätze und der Legitimation von Priorisierungsregeln an.
2 Die Definition von Stakeholdern: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Stakeholder“ und untersucht verschiedene Theorien, insbesondere die Stakeholder-Theorie nach Freeman. Es werden die Eigenschaften von Stakeholdern beleuchtet und die Implikationen für das unternehmerische Handeln erörtert. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Beziehung zwischen Unternehmen und verschiedenen Interessengruppen.
3 Normative Ansätze als Rational-Choice Theorie: Dieses Kapitel untersucht normative Ansätze im Stakeholdermanagement, indem es die Aussagen verschiedener Philosophen, wie Jürgen Habermas und David Hume, analysiert. Es wird die Verbindung zwischen normativen Fragen und dem Stakeholdermanagement hergestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der ethischen Dimension des Umgangs mit unterschiedlichen Stakeholder-Interessen.
4 Die Legitimation von Priorisierungsregeln: Dieses Kapitel behandelt die Frage, wie Unternehmen die Priorisierung von Stakeholder-Interessen rechtfertigen können. Es werden verschiedene Methoden der Stakeholder-Identifizierung und -Priorisierung vorgestellt, inklusive des Stakeholder Issues Managements und der Power-Legitimacy-Urgency-Typologie. Ein Praxisbeispiel von Axel Springer SE verdeutlicht die Anwendung dieser Methoden.
Schlüsselwörter
Stakeholder, Stakeholder-Dialog, Stakeholder-Theorie, Freeman, normative Ansätze, Rational-Choice Theorie, Habermas, Hume, Corporate Social Responsibility (CSR), Priorisierungsregeln, Stakeholdermanagement, Unternehmensethik, Legitimation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Stakeholder-Dialog und Legitimation von Priorisierungsregeln
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Stakeholder-Dialog und die Legitimation von Priorisierungsregeln im Kontext der Unternehmensethik. Sie analysiert die Definition von Stakeholdern, normative Ansätze im Stakeholdermanagement unter Einbezug philosophischer Perspektiven (Habermas, Hume) und legt den Fokus auf die Rechtfertigung von Priorisierungsregeln anhand eines Praxisbeispiels (Axel Springer SE).
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Theorie der Stakeholder (inkl. Freeman's Stakeholder-Theorie), normative Ansätze im Stakeholdermanagement, Legitimation von Priorisierungsregeln für Stakeholder, Anwendung philosophischer Konzepte auf das Stakeholdermanagement und ein Praxisbeispiel zur Stakeholder-Priorisierung.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definition von Stakeholdern (inkl. Stakeholder-Dialog), Normative Ansätze als Rational-Choice Theorie (inkl. philosophischer Erläuterungen von Habermas und Hume und CSR), Legitimation von Priorisierungsregeln (inkl. Stakeholder Issues Management und Power-Legitimacy-Urgency-Typologie sowie Praxisbeispiel Axel Springer SE) und Fazit.
Welche Philosophen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf die philosophischen Ansätze von Jürgen Habermas und David Hume im Kontext normativer Ansätze und deren Anwendung auf das Stakeholdermanagement.
Welche Methoden der Stakeholder-Identifizierung und -Priorisierung werden vorgestellt?
Die Seminararbeit beschreibt das Stakeholder Issues Management und die Power-Legitimacy-Urgency-Typologie als Methoden zur Identifizierung und Priorisierung von Stakeholdern.
Welches Praxisbeispiel wird in der Arbeit verwendet?
Als Praxisbeispiel dient die Axel Springer SE, um die Anwendung der vorgestellten Methoden zur Stakeholder-Priorisierung zu illustrieren.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Stakeholder, Stakeholder-Dialog, Stakeholder-Theorie, Freeman, normative Ansätze, Rational-Choice Theorie, Habermas, Hume, Corporate Social Responsibility (CSR), Priorisierungsregeln, Stakeholdermanagement, Unternehmensethik und Legitimation.
Was ist das Fazit der Seminararbeit?
(Das Fazit selbst ist nicht explizit in den FAQs enthalten, da es im HTML-Code nur Kapitelzusammenfassungen gibt. Um das Fazit zu erfahren, müsste man die vollständige Seminararbeit lesen.)
Wofür ist diese Zusammenfassung gedacht?
Diese Zusammenfassung dient als Überblick und soll den Inhalt der Seminararbeit für Leser schnell und prägnant zugänglich machen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, den Stakeholder-Dialog und die Legitimation von Priorisierungsregeln im Kontext der Unternehmensethik zu untersuchen und zu analysieren.
- Quote paper
- Simon Wagner (Author), 2019, Der Stakeholder-Dialog. Normative Ansätze und die Legitimation von Priorisierungsregeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512234