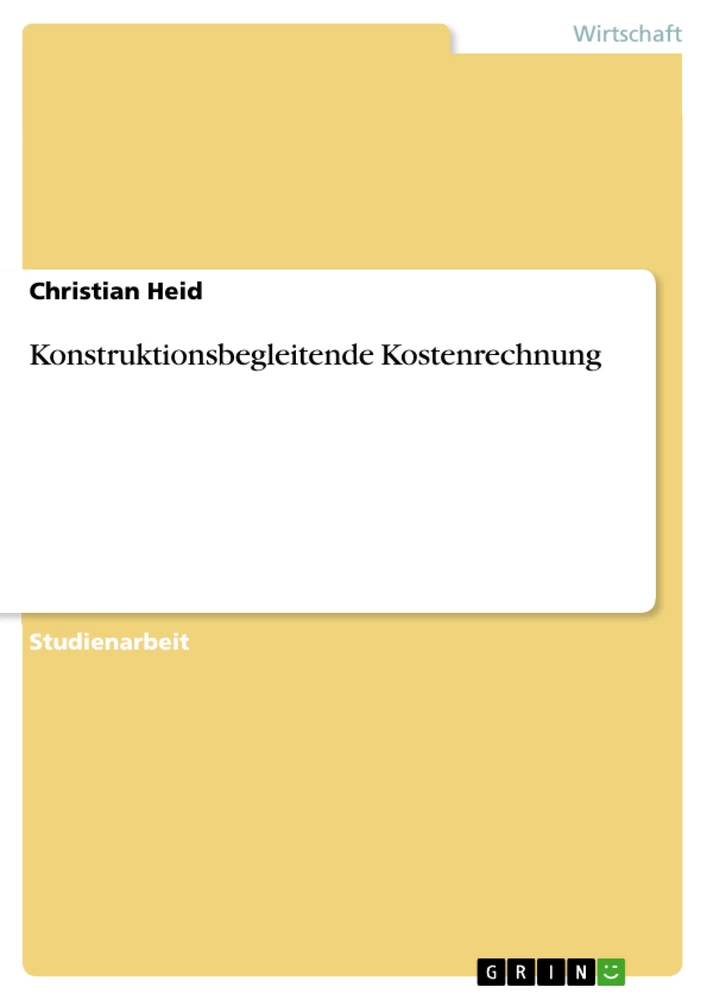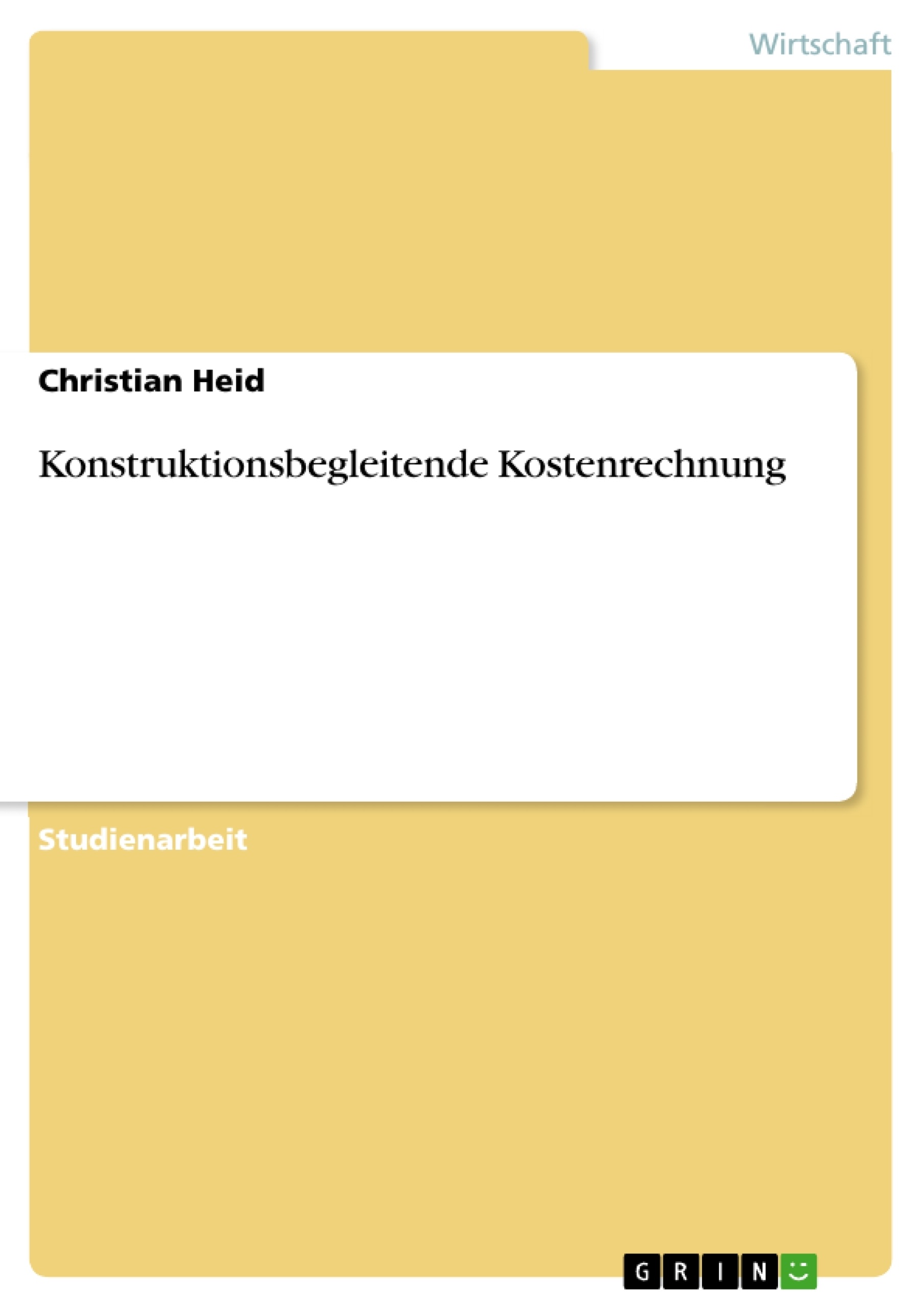Problemstellung, Wertschöpfungsdefizit und Kostenproblematik
Der Erfolg und das Bestehen von Unternehmen im marktwirtschaftlichen Umfeld werden entscheidend durch den Absatzmarkt geprägt. Von dieser Gegebenheit ausgehend ist es notwendig, Signale, Bedürfnisse und weiterführende absatzmarktorientierte Anforderungen frühzeitig zu erkennen und zu berücksichtigen. Dies gilt in erster Linie für die Entwicklung und Konstruktion von Produkten in den Unternehmen. Die Integration europäischer Märke, die fortschreitende Globalisierung, die steigende Innovationsgeschwindigkeit sowie der härter werdende Wettbewerb, stellen für den Spagat zwischen marktgerechter Konstruktion und Ausführung sowie einer kostenminimalen aber qualitativ hochwertigen Herstellung eine große Herausforderung dar. Es genügt nicht, den „alten Hut“ ein wenig aufzubügeln, vielmehr muss die „neue Kopfbedeckung“ entdeckt und auch realisiert werden. Ein Prinzip wie „das haben wir schon immer so gemacht“ oder „schwer machbar und risikobehaftet“ lässt die Grauzone rund um die Entwicklung und Konstruktion nur unnötig weiter wachsen.1
Bereits 1998 bestand im Vergleich zu 1978 in Deutschland ein Wertschöpfungsdefizit von umgerechnet 500 Mrd. Euro. Dieses Defizit hätte nur durch neue, innovative Produkte, die an den Märkten eine überdurchschnittliche Akzeptanz erhalten, kompensiert werden können. Bei vielen Produkten deutscher Hersteller stellte sich jedoch die Situation von zu hohen Kosten und somit zu hoher Marktpreise ein. Mit dieser Gegebenheit lässt sich aber kein Wertschöpfungsdefizit aufholen.2 Von 1998 bis 2004 wurden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland von 44,7 Mrd. auf 54,3 Mrd. Euro um ca. 21 % gesteigert.3 Da die zusätzlich entstehenden Kosten in dem Rahmen der Produkterstellung nicht 1:1 auf den späteren Marktpreis umgelegt werden können, gilt es Methoden der Kostenkontrolle und -senkung bei der Herstellung von Produkten einzusetzen. Für die Kostenplanung und -erfassung sowie für die damit verbundenen Prozesse gilt daher eine penible Durchgängigkeit und Transparenz, um ein erfolgreiches und wirtschaftliches Kostenmanagement zu erreichen.4
---
1 Vgl. Verein Deutscher Ingenieure, von Diekhöner, G. W. (1993), S.19.
2 Vgl. Scholl, K. (1998), S. 1.
3 Vgl. BMBF (2005) – Bundesbericht Forschung 2004 (URL: http://www.bmbf.de/de/2303.php).
4 Vgl. Ehrlenspiel, K. et al. (2005), S. 449; vgl. Götze, U. (2004), S. 236.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Problemstellung, Wertschöpfungsdefizit und Kostenproblematik
- Einflussgrößen auf die Kostenrechnung und deren Auswirkungen
- Bottom-Up Simultaneous Engineering und Top-Down Target Costing
- Anwendung der konstruktionsbegleitenden Kostenrechnung
- Problemlösungszyklus, Synthese- und Bewertungsverfahren
- Analyse-, Kalkulations- und Prognoseverfahren
- Kostenschätzung
- Mitlaufende Kalkulation
- Kurzkalkulation
- Detaillierte Kostenprognose und deren Modelle
- Schlussbetrachtung und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der konstruktionsbegleitenden Kostenrechnung und untersucht deren Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit von Produktentwicklungsprozessen. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen frühen Kostenschätzungen und der finalen Produktgestaltung aufzuzeigen sowie die Herausforderungen und Chancen dieser Methode darzustellen.
- Bedeutung der Kostenrechnung in der Produktentwicklung
- Einfluss von Simultaneous Engineering und Target Costing auf die Kostenkontrolle
- Analyse verschiedener Kostenschätzungsmethoden und deren Anwendung
- Kostenmanagement und -beeinflussung während des Produktentstehungsprozesses
- Wirtschaftliche Aspekte der konstruktionsbegleitenden Kostenrechnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problemstellung, das Wertschöpfungsdefizit und die Kostenproblematik im Kontext der Produktentwicklung. Es werden die Herausforderungen der Integration europäischer Märkte, der fortschreitenden Globalisierung und des härter werdenden Wettbewerbs thematisiert, die eine Kostenminimierung bei gleichzeitiger qualitativ hochwertiger Herstellung erfordern.
Im zweiten Kapitel werden die Einflussgrößen auf die Kostenrechnung und deren Auswirkungen auf die Produktentwicklung beleuchtet. Die Methoden des Bottom-Up Simultaneous Engineering und des Top-Down Target Costing werden vorgestellt und in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Kostenkontrolle diskutiert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Anwendung der konstruktionsbegleitenden Kostenrechnung. Es werden verschiedene Kostenschätzungsmethoden wie Kostenschätzung, Mitlaufende Kalkulation, Kurzkalkulation und detaillierte Kostenprognose erläutert und deren Einsatz im Entwicklungsprozess analysiert.
Schlüsselwörter
Konstruktionsbegleitende Kostenrechnung, Simultaneous Engineering, Target Costing, Kostenschätzung, Mitlaufende Kalkulation, Kurzkalkulation, Detaillierte Kostenprognose, Kostenmanagement, Wertschöpfungsdefizit, Produktentwicklung, Wirtschaftlichkeit.
- Citation du texte
- Christian Heid (Auteur), 2005, Konstruktionsbegleitende Kostenrechnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51228