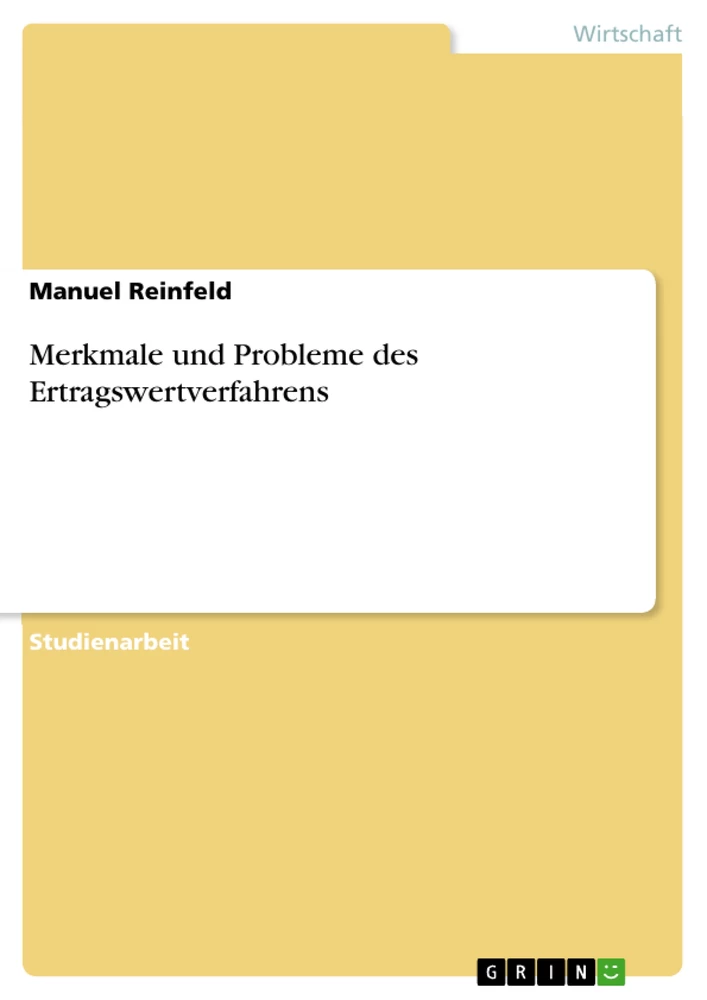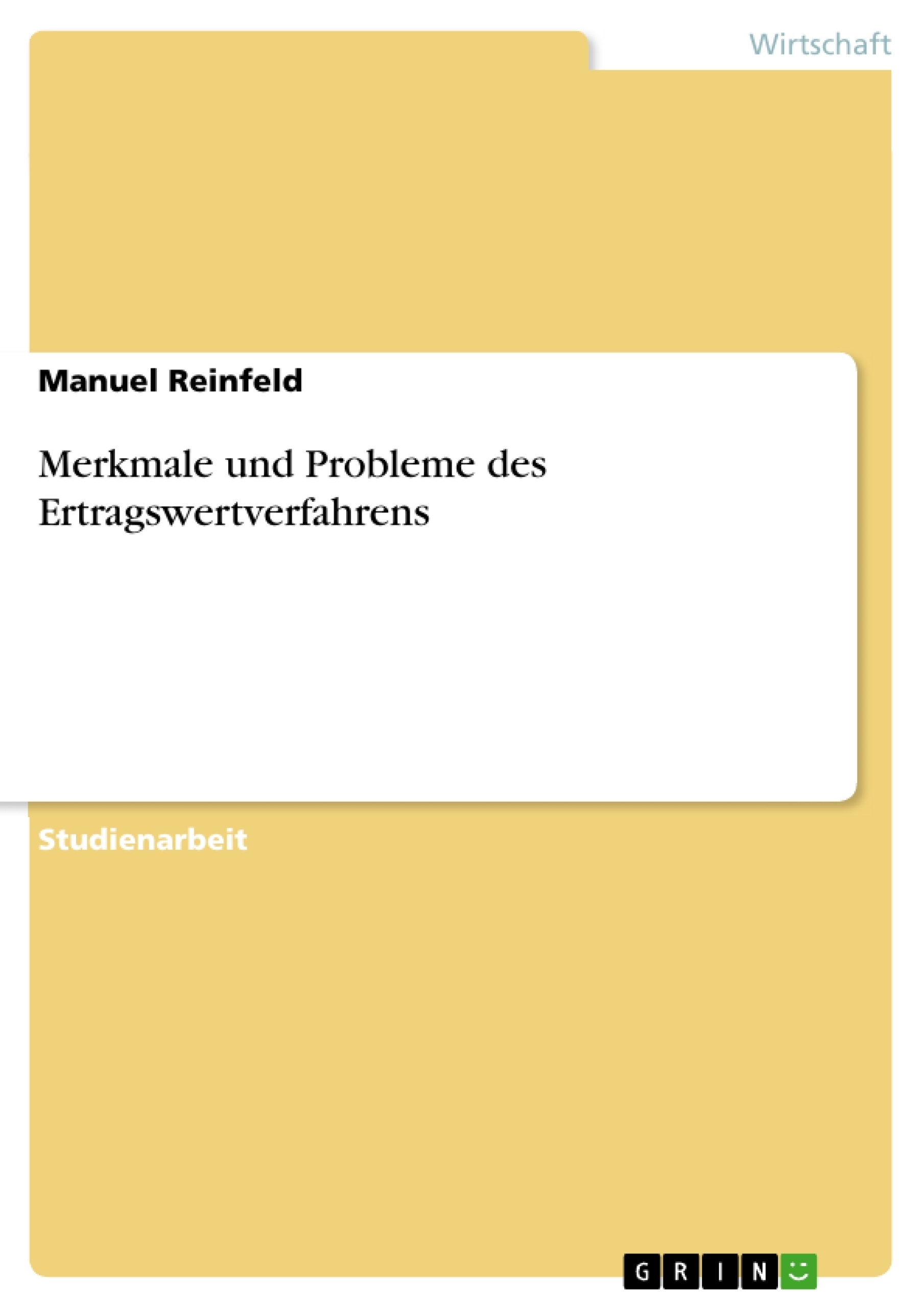Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Verfahren des Ertragswertes. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen und die Anwendungsgebiete erläutert. Anschließend wird auf die Vor- und Nachteile dieser Theorie eingegangen. Ziel dieser Arbeit ist es zunächst, geeignete Bewertungsanlässe für eine Unternehmensbewertung vorzustellen und anschließend die spezifischen Probleme und Merkmale des Ertragswertverfahrens aufzuführen und eine Prognose für zukünftige Anwendungsgebiete zu geben.
Die Wirtschaftswissenschaften befassen sich bereits seit mehreren Jahrzehnten mit dem Thema der Unternehmensbewertung. Es wird stetig daran gearbeitet, die bestehenden Verfahren weiter zu entwickeln und zu optimieren, um möglichst genaue Unternehmenswerte darstellen zu können. Theoretiker sowie Praktiker treiben durch immer wieder neu auftretende Diskussionen diese Thematik an. Unternehmensbewertungen werden zu unterschiedlichen Zwecken durchgeführt, um den Wert eines Unternehmens darzustellen. Sie werden unter anderem für die Wertermittlung bei Fusionen von Unternehmen, bei Berechnungen von Ausschüttungsbeträgen (zum Beispiel von Minderheitsaktionären für einen Squeeze-out), beim Abschluss von Abführungsverträgen, Erbschaften oder auch legitimer Unternehmenskäufe durchgeführt.
Da nur geringe Fehleinschätzungen von den zu bewertenden Objekten bereits erhebliche Preisunterschiede verursachen können, ist es von höchster Bedeutung, dass der ermittelte Wert fehlerfrei dargestellt wird. Aus der daraus resultierenden Unverzichtbarkeit von tatsachengetreuen Bewertungen von Unternehmen haben sich zahlreiche Verfahren gebildet. Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) hat aus diesem Anlass bereits 1983 Rahmenbedingungen für die Bewertungen von Unternehmen definiert. Diese wurden in den "Grundsätzen zur Durchführung von Unternehmensbewertungen" zusammengefasst. Diese Standards, auch IDW S1 genannt, dienen als Leitfaden für die Bewertung von Unternehmen. Sie werden stetig weiterentwickelt und an die aktuelle Gesetzgebung angepasst.
Inhaltsverzeichnis
- Das Ertragswertverfahren
- I ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- II ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG
- 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 2.1 BEWERTUNGSANLÄSSE
- 2.1.1 Dominierte Bewertungsanlässe
- 2.1.2 Nicht dominierte Bewertungsanlässe
- 2.3 BESCHREIBUNG DES ERTRAGSWERTVERFAHRENS
- 2.3.1 Das Ertragswertverfahren bei Immobilien und Grundstücken
- 2.4 ERMITTLUNG VON ERTRAGSÜBERSCHÜSSEN
- 2.5 KAPITALISIERUNGSZINSFUẞ
- 2.5.1 Basiszinssatz
- 2.5.2 Risikozuschlag
- 2.5.2.1 Bernoulli-Theorie
- 2.5.2.2 CAPM-Theorie
- 2.5.3 Ertragsteuerbelastung
- 2.5.4 Wachstumsabschlag
- 2.5.5 DER ERTRAGSWERT
- 3 ANWENDUNG
- 3.2 BERECHNUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES CAPM
- 4 WÜRDIGUNG DES ERTRAGSWERTVERFAHRENS
- 4.1 VORTEILE DES ERTRAGSWERTVERFAHRENS
- 4.2 NACHTEILE DES ERTRAGSWERTVERFAHRENS
- 5 FAZIT
- 5.2 ZUSAMMENFASSUNG
- 5.3 ZUKUNFTSPROGNOSE
- III LITERATURVERZEICHNIS
- Theoretische Grundlagen des Ertragswertverfahrens
- Bewertungsanlässe für Unternehmensbewertungen
- Ermittlung von Ertragsüberschüssen
- Der Kapitalisierungszinssatz
- Anwendungsgebiete und Problemfelder des Ertragswertverfahrens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Verfahren des Ertragswertes und untersucht dessen spezifische Merkmale und Probleme. Sie zielt darauf ab, die Anwendbarkeit des Ertragswertverfahrens im Kontext des stetigen Wandels in der Wirtschaft zu bewerten und eine Prognose für dessen zukünftige Einsatzgebiete abzugeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund und die Relevanz von Unternehmensbewertungen beleuchtet. Sie führt in die verschiedenen Verfahren ein und hebt die Bedeutung des Ertragswertverfahrens hervor. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Ertragswertverfahrens erläutert, einschließlich der verschiedenen Bewertungsanlässe. Dabei wird zwischen dominierten und nicht dominierten Bewertungsanlässen unterschieden, die jeweils mit unterschiedlichen Zielsetzungen verbunden sind. Kapitel 2 beleuchtet zudem die Berechnung von Ertragsüberschüssen sowie den Kapitalisierungszinssatz, der eine zentrale Rolle im Ertragswertverfahren spielt. Im dritten Kapitel wird die praktische Anwendung des Ertragswertverfahrens dargestellt, insbesondere im Kontext des CAPM-Modells. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Würdigung des Ertragswertverfahrens, indem es Vor- und Nachteile dieses Verfahrens analysiert. Abschließend wird im fünften Kapitel eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie eine Zukunftsprognose für das Ertragswertverfahren gegeben.
Schlüsselwörter
Unternehmensbewertung, Ertragswertverfahren, Bewertungsanlässe, Ertragsüberschüsse, Kapitalisierungszinssatz, CAPM, Vor- und Nachteile, Zukunftsprognose.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ertragswertverfahren?
Es ist ein Verfahren zur Unternehmensbewertung, bei dem der Wert des Unternehmens aus den zukünftig zu erwartenden Ertragsüberschüssen abgeleitet wird.
Wann wird eine Unternehmensbewertung notwendig?
Anlässe sind unter anderem Fusionen, Unternehmenskäufe, Erbschaften, Abfindungen von Minderheitsaktionären (Squeeze-out) oder der Abschluss von Abführungsverträgen.
Was bedeutet IDW S1?
IDW S1 bezeichnet die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland definierten Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen.
Welche Rolle spielt der Kapitalisierungszinssatz?
Der Kapitalisierungszinssatz dient dazu, die zukünftigen Erträge auf den heutigen Barwert abzuzinsen. Er setzt sich meist aus einem Basiszinssatz und einem Risikozuschlag zusammen.
Was ist der Unterschied zwischen dominierten und nicht dominierten Bewertungsanlässen?
Dominierte Anlässe liegen vor, wenn eine Partei aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen den Wert vorgeben kann, während nicht dominierte Anlässe auf freiwilligen Verhandlungen basieren.
Was sind die Nachteile des Ertragswertverfahrens?
Ein Hauptproblem liegt in der Prognoseunsicherheit zukünftiger Erträge und der subjektiven Festlegung von Risikozuschlägen im Zinssatz.
- Arbeit zitieren
- Manuel Reinfeld (Autor:in), 2019, Merkmale und Probleme des Ertragswertverfahrens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512424