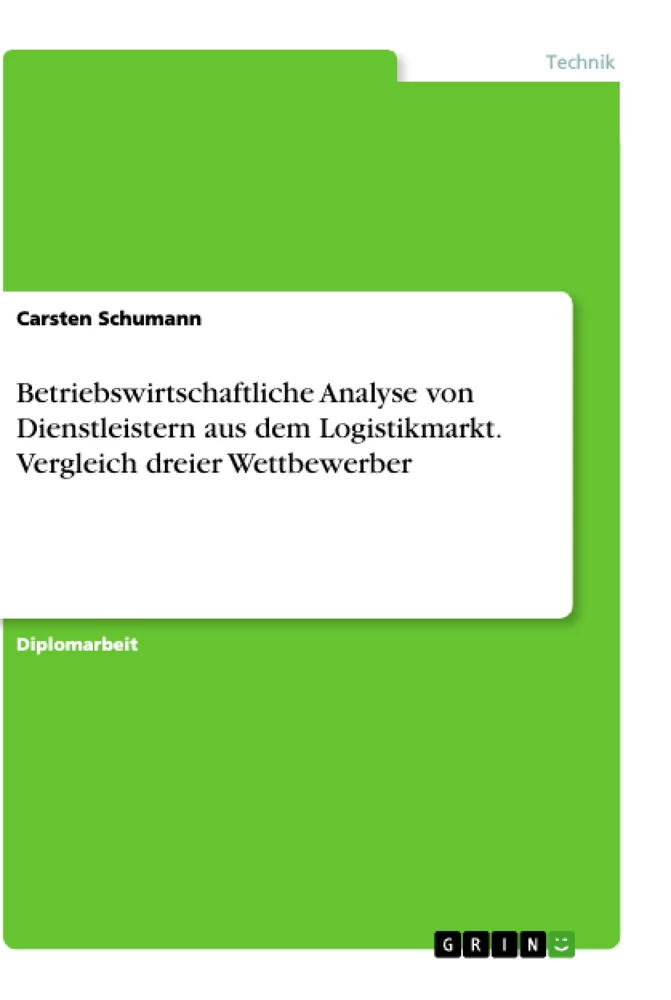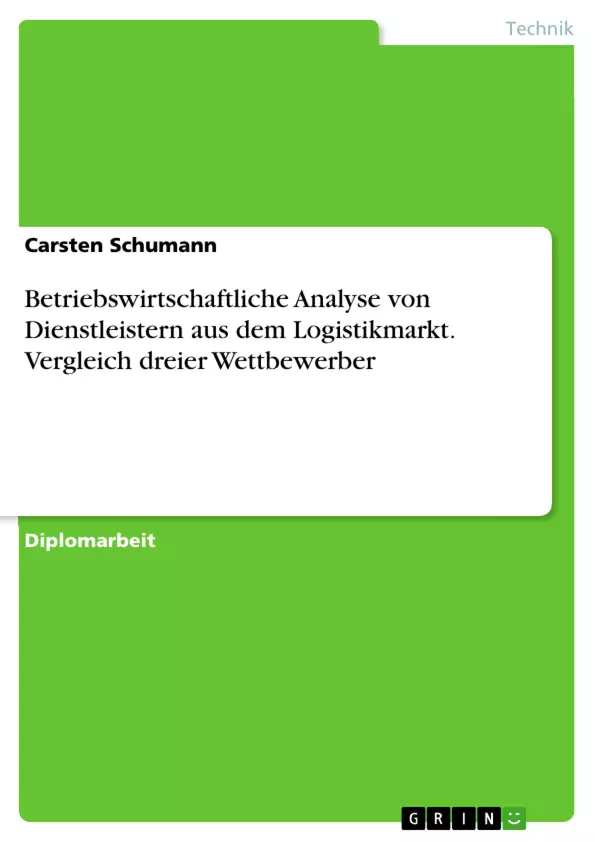Diese Diplomarbeit beinhaltet eine betriebswirtschaftliche Analyse von Dienstleistern aus dem Logistikmarkt. Dabei stehen drei Unternehmen des Logistikmarktes in der Rechtsform der Aktiengesellschaft im Mittelpunkt der Analyse.
Nach der Vorstellung der drei Firmen werden allgemeine Betrachtungen zum Jahresabschlussbericht vorgenommen. Es werden Inhalt und Funktion der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Lageberichtes erklärt. In der weiteren Darstellung werden die Bilanzierungsrichtlinien US-GAAP mit den Richtlinien nach HGB verglichen. Außerdem sind die Aufgabenstellungen und Grenzen der Jahresabschlussanalyse näher erläutert. Nach der Erläuterung der Kennzahlen erfolgt die Analyse der Firmen mit Hilfe dieser Kennzahlen. Hierbei sind verschiedene Feststellungen getroffen worden, indem die Werte mit Sollwerten aus der Industrie verglichen wurden. Die Bewertung der drei Unternehmen erfolgt durch Gegenüberstellung mit ausgesuchten und vorgestellten Kennzahlen, die Auswertung wird mit einer Notenskala vorgenommen.
Abschluss dieser Arbeit ist eine Betrachtung der konjunkturellen Entwicklung des letzten Jahres (2002); es wird auf Chancen und Risiken des Logistikmarktes eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorstellung der Unternehmen
- 2.1. Vorstellung der D. Logistics AG
- 2.2. Vorstellung der Thiel Logistik AG
- 2.3. Vorstellung der Müller – die lila Logistik AG
- 3. Jahresabschluss als Quelle der betriebswirtschaftlichen Untersuchung
- 3.1. Die Bilanz
- 3.2. Die Gewinn- und Verlustrechnung
- 3.3. Der Lagebericht und Anhang
- 4. Bilanzierungsrichtlinien nach HGB und US-GAAP
- 4.1. Bilanzierungsrichtlinien nach HGB
- 4.1.1. Das Anlagevermögen
- 4.1.2. Das Umlaufvermögen
- 4.1.3. Die Passivseite der Bilanz
- 4.1.4. Die Gewinn- und Verlustrechnung
- 4.2. Bilanzierungsrichtlinien nach US-GAAP
- 4.3. Unterschiede zwischen HGB und US-GAAP
- 4.1. Bilanzierungsrichtlinien nach HGB
- 5. Aufgabenstellung und Grenzen der Jahresabschlussanalyse
- 6. Erläuterung und Definition der Kennzahlen
- 6.1. Finanzierungskennzahlen
- 6.2. Liquiditätskennzahlen
- 6.3. Rentabilitätskennzahlen
- 6.4. Erfolgskennzahlen
- 7. Bewertung der Unternehmen anhand der Kennzahlen
- 7.1. Bewertung der D. Logistics AG mit den Kennzahlen
- 7.2. Bewertung der Thiel Logistik AG mit den Kennzahlen
- 7.3. Bewertung der Müller - die lila Logistik AG mit den Kennzahlen
- 8. Vergleich der drei Unternehmen anhand ausgesuchter Kennzahlen
- 9. Rückblick und Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung
- 10. Chancen und Risiken für den Logistikmarkt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert betriebswirtschaftlich drei börsennotierte Unternehmen aus dem Logistiksektor. Ziel ist es, die Unternehmen anhand von Kennzahlen zu bewerten und zu vergleichen, um ihre finanzielle Gesundheit und Performance zu beurteilen. Die Arbeit beleuchtet dabei auch die Unterschiede zwischen den Bilanzierungsrichtlinien HGB und US-GAAP.
- Betriebswirtschaftliche Analyse von Logistikdienstleistern
- Vergleichende Kennzahlenanalyse
- Anwendung von HGB und US-GAAP
- Bewertung der finanziellen Performance
- Konjunkturelle Entwicklung des Logistikmarktes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der betriebswirtschaftlichen Analyse von Logistikdienstleistern ein und skizziert den Aufbau und die Methodik der Arbeit. Sie begründet die Relevanz des gewählten Themas und beschreibt den Umfang der Untersuchung.
2. Vorstellung der Unternehmen: Dieses Kapitel stellt die drei analysierten Logistik-Unternehmen (D. Logistics AG, Thiel Logistik AG und Müller – die lila Logistik AG) detailliert vor. Es bietet einen Überblick über ihre Geschichte, Geschäftsmodelle, Marktposition und relevante Unternehmensdaten. Die Darstellung dient als Grundlage für die anschließende betriebswirtschaftliche Analyse.
3. Jahresabschluss als Quelle der betriebswirtschaftlichen Untersuchung: Dieses Kapitel erläutert den Jahresabschluss als zentrale Informationsquelle für die betriebswirtschaftliche Analyse. Es beschreibt den Aufbau und die Funktionen von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang. Die Erklärungen legen die Grundlage für das Verständnis der im weiteren Verlauf verwendeten Kennzahlen.
4. Bilanzierungsrichtlinien nach HGB und US-GAAP: In diesem Kapitel werden die deutschen (HGB) und die US-amerikanischen (US-GAAP) Bilanzierungsrichtlinien verglichen. Es werden die wichtigsten Unterschiede in der Bilanzierung von Vermögenswerten, Schulden und Erträgen herausgestellt. Dieser Vergleich ist wichtig, um die Vergleichbarkeit der analysierten Unternehmen zu beurteilen, da sie möglicherweise unter unterschiedlichen Richtlinien bilanzieren.
5. Aufgabenstellung und Grenzen der Jahresabschlussanalyse: Das Kapitel definiert die Ziele und den Umfang der Jahresabschlussanalyse und benennt gleichzeitig die Grenzen und Einschränkungen der verwendeten Methode. Es werden potentielle Fehlerquellen und die interpretativen Herausforderungen bei der Analyse von Jahresabschlüssen beleuchtet.
6. Erläuterung und Definition der Kennzahlen: Dieses Kapitel definiert und erläutert die für die Analyse verwendeten Kennzahlen. Es werden Finanzierungs-, Liquiditäts-, Rentabilitäts- und Erfolgskennzahlen beschrieben und ihre Bedeutung für die Beurteilung der Unternehmen erklärt. Die Auswahl der Kennzahlen basiert auf ihrer Relevanz für die Untersuchung des Logistiksektors.
7. Bewertung der Unternehmen anhand der Kennzahlen: In diesem Kapitel werden die drei Unternehmen anhand der zuvor definierten Kennzahlen einzeln bewertet. Für jedes Unternehmen werden die wichtigsten Kennzahlen analysiert und interpretiert, um Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Dieser Abschnitt bildet die zentrale empirische Analyse der Arbeit.
8. Vergleich der drei Unternehmen anhand ausgesuchter Kennzahlen: Dieses Kapitel vergleicht die drei Unternehmen auf Basis ausgewählter Kennzahlen miteinander. Es werden die Ergebnisse der Einzelanalysen zusammengefasst und die jeweiligen Stärken und Schwächen im Vergleich herausgearbeitet. Dieser Vergleich ermöglicht ein differenziertes Urteil über die relative Performance der Unternehmen.
9. Rückblick und Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung: Dieses Kapitel bietet einen Rückblick auf die konjunkturelle Entwicklung des Logistikmarktes im vergangenen Jahr und gibt einen Ausblick auf zukünftige Chancen und Risiken. Die Analyse berücksichtigt branchenspezifische Faktoren und deren Einfluss auf die untersuchten Unternehmen.
10. Chancen und Risiken für den Logistikmarkt: Dieses Kapitel diskutiert die Chancen und Risiken, denen der Logistikmarkt in der Zukunft ausgesetzt sein wird. Die Diskussion berücksichtigt sowohl makroökonomische als auch branchenspezifische Faktoren.
Schlüsselwörter
Logistikdienstleister, Jahresabschlussanalyse, Kennzahlen, HGB, US-GAAP, Finanzierungskennzahlen, Liquiditätskennzahlen, Rentabilitätskennzahlen, Erfolgskennzahlen, Konjunktur, Branchenvergleich, Unternehmensbewertung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Betriebswirtschaftliche Analyse von Logistikdienstleistern
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit führt eine betriebswirtschaftliche Analyse von drei börsennotierten Logistik-Unternehmen durch. Der Fokus liegt auf der Bewertung und dem Vergleich der Unternehmen anhand von Kennzahlen, um deren finanzielle Gesundheit und Performance zu beurteilen. Zusätzlich werden die Unterschiede zwischen den Bilanzierungsrichtlinien HGB und US-GAAP beleuchtet.
Welche Unternehmen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die D. Logistics AG, die Thiel Logistik AG und die Müller – die lila Logistik AG. Die Unternehmen werden detailliert vorgestellt, inklusive ihrer Geschichte, Geschäftsmodelle und Marktposition.
Welche Daten werden für die Analyse verwendet?
Die Hauptdatenquelle ist der Jahresabschluss der drei Unternehmen. Die Arbeit erläutert den Aufbau und die Bedeutung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang. Aus diesen Daten werden verschiedene Kennzahlen abgeleitet und analysiert.
Welche Kennzahlen werden verwendet?
Die Analyse verwendet Finanzierungs-, Liquiditäts-, Rentabilitäts- und Erfolgskennzahlen. Die Auswahl der Kennzahlen wird begründet und deren Bedeutung für die Beurteilung der Unternehmen im Logistiksektor erklärt.
Wie werden die Unternehmen bewertet?
Die Unternehmen werden zunächst einzeln anhand der ausgewählten Kennzahlen bewertet, um Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Anschließend erfolgt ein Vergleich der drei Unternehmen auf Basis ausgesuchter Kennzahlen, um die relative Performance zu beurteilen.
Welche Bilanzierungsrichtlinien werden berücksichtigt?
Die Arbeit vergleicht die deutschen (HGB) und die US-amerikanischen (US-GAAP) Bilanzierungsrichtlinien. Die wichtigsten Unterschiede in der Bilanzierung werden herausgestellt, um die Vergleichbarkeit der Unternehmen zu gewährleisten.
Welche konjunkturellen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit enthält einen Rückblick auf die konjunkturelle Entwicklung des Logistikmarktes und einen Ausblick auf zukünftige Chancen und Risiken. Branchenspezifische Faktoren und deren Einfluss auf die untersuchten Unternehmen werden berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel: Einleitung, Vorstellung der Unternehmen, Jahresabschluss als Quelle der Untersuchung, Bilanzierungsrichtlinien (HGB und US-GAAP), Aufgabenstellung und Grenzen der Analyse, Definition der Kennzahlen, Einzelbewertung der Unternehmen, Vergleich der Unternehmen, Rückblick und Ausblick auf die Konjunktur, sowie Chancen und Risiken für den Logistikmarkt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Logistikdienstleister, Jahresabschlussanalyse, Kennzahlen, HGB, US-GAAP, Finanzierungskennzahlen, Liquiditätskennzahlen, Rentabilitätskennzahlen, Erfolgskennzahlen, Konjunktur, Branchenvergleich, Unternehmensbewertung.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis befindet sich am Anfang des Dokuments und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf.
- Quote paper
- Carsten Schumann (Author), 2004, Betriebswirtschaftliche Analyse von Dienstleistern aus dem Logistikmarkt. Vergleich dreier Wettbewerber, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512477