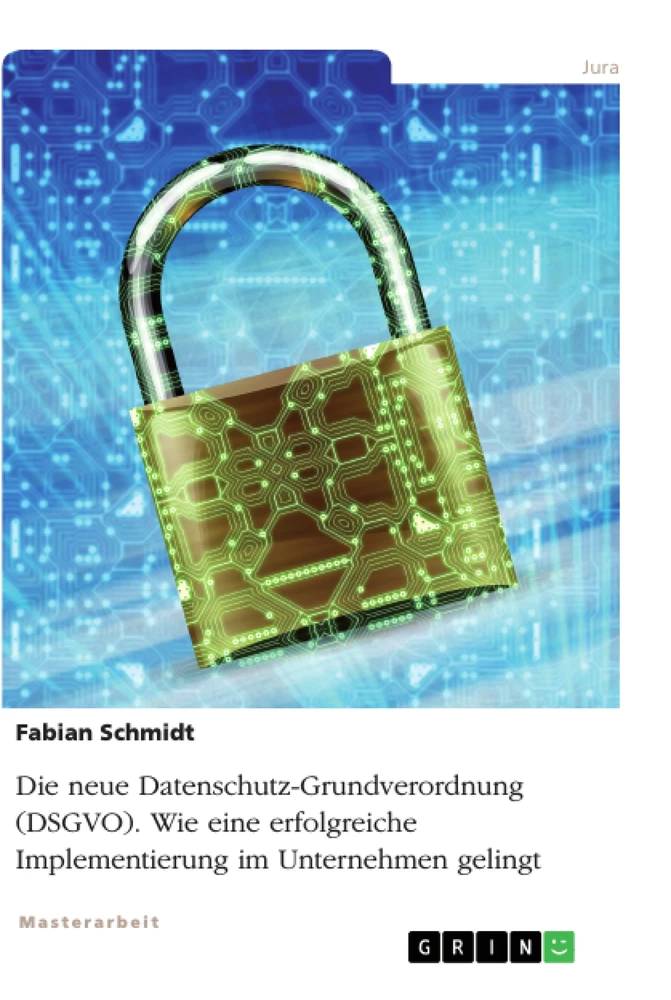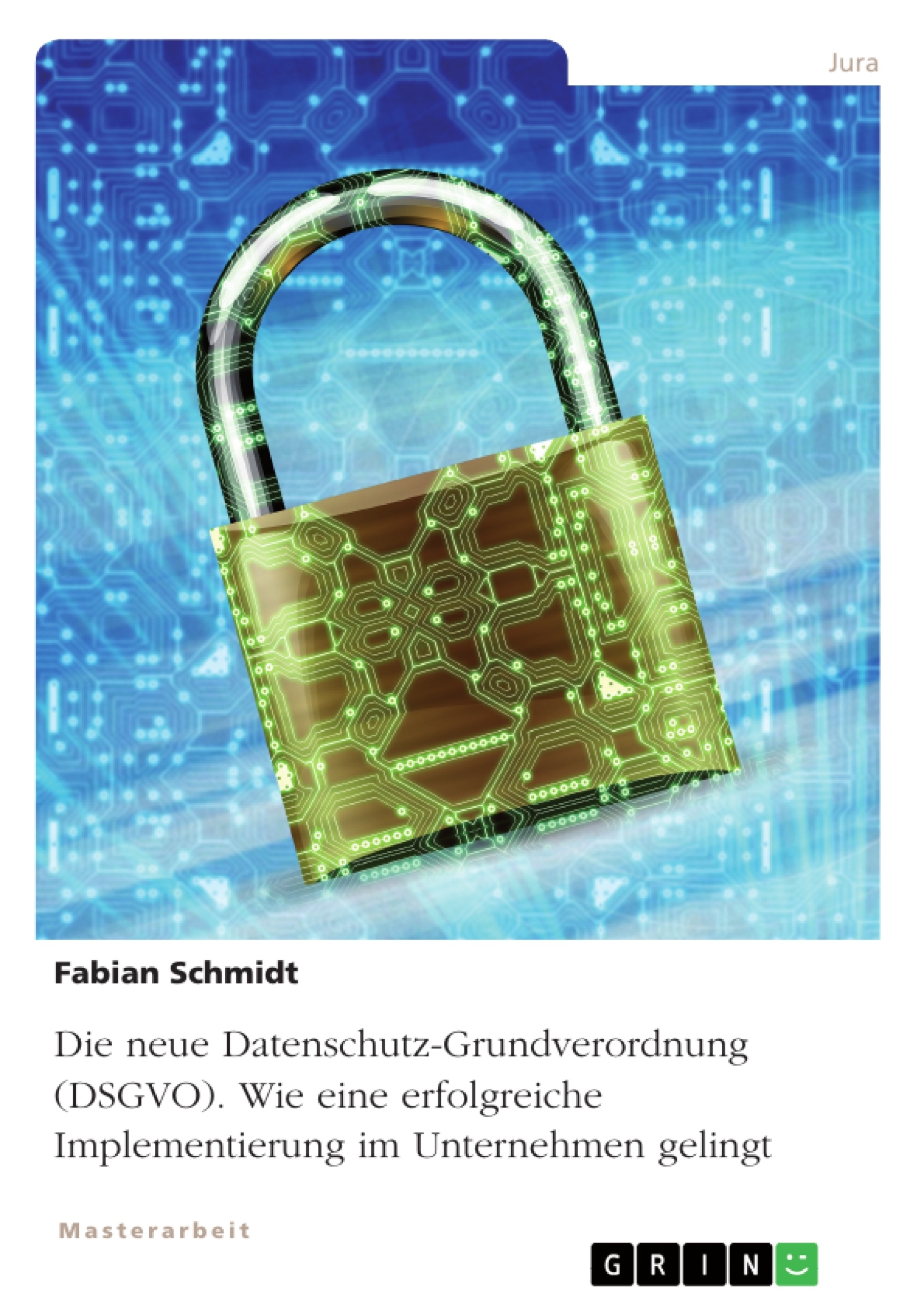Gegenstand dieser Arbeit ist es, die neue Gesetzeslage infolge der DSGVO näher zu beleuchten und Möglichkeiten zur Implementierung im Unternehmen aufzuzeigen. Die Arbeit soll lediglich als hinreichenden aber keinesfalls vollständigen Leitfaden für den Praxistransfer gelten, da der Umfang dieser Arbeit dies keinesfalls gewährleisten könnte.
Die Arbeit richtet sich vor allem an Arbeitgeber, die mit der Erfüllung der DSGVO-Anforderungen in ihren Unternehmen vor eine große Aufgabe gestellt sind, und soll ihnen einen ersten Einblick und leichteren Zugang zu den wichtigsten Bestandteilen der DSGVO und deren Umsetzung liefern. Somit kann sich der Verantwortliche eines Unternehmens einen ersten Überblick verschaffen, welche Maßnahmen konkret durch die DSGVO gefordert werden. Er kann daraufhin im Rahmen einer internen Projektplanung im Unternehmen einen Maßnahmenkatalog zur Implementierung entwickeln und ist im Austausch mit Datenschutzbeauftragten besser vorbereitet.
Von den Prüfern wird die Thesis als ein sehr geeignetes Handbuch für die Praxis gelobt. Daher resultiert mein Entschluss sie zum Verkauf anzubieten. Die Thesis eignet sich also gut für Unternehmen, die sich einen ersten Überblick über die Vorschriften der DSGVO verschaffen möchten und zeigt praktische Anleitungen für den Arbeitsalltag auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziele
- 1.3 Aufbau
- 1.4 Methodik/theoretischer Ansatz
- 1.5 Motivation
- 2. Historische Entwicklung
- 2.1 Von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis 2012
- 2.2 Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- 2.2.1 Entstehung der DSGVO
- 2.2.2 Inkrafttreten der DSGVO
- 2.2.3 Ziele der DSGVO
- 2.3 Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
- 2.4 Stellungnahme
- 3. Implementierung im Unternehmen
- 3.1 Bedeutung der DSGVO
- 3.2 Anwendungsbereich der DSGVO
- 3.2.1 Sachlicher Anwendungsbereich
- 3.2.2 Räumlicher Anwendungsbereich
- 3.3 Wichtige Vorschriften der DSGVO
- 3.3.1 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
- 3.3.2 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten
- 3.3.3 Auftragsverarbeitung
- 3.3.4 Sicherheit der Verarbeitung
- 3.3.5 Datenschutzbeauftragter
- 3.3.6 Rechte von betroffenen Personen (Betroffenenrechte)
- 3.3.7 Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
- 3.3.8 Sanktionen und Haftung
- 3.3.9 Anforderungen an eigene Unternehmensstruktur
- 3.3.10 Umgang mit der Aufsichtsbehörde
- 3.3.11 Umgang mit Fotos im Internet
- 3.3.12 „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“
- 3.3.13 Stellungnahme
- 4. Anwendungsbeispiele zur Umsetzung der DSGVO
- 4.1 Projektplanung und Checkliste zur Implementierung im Unternehmen
- 4.2 Fallbeispiele
- 4.2.1 Praktische Anleitungen zur Umsetzung
- 4.2.2 Häufige formelle Fehler
- 4.2.3 Materielle Fehler
- 4.3 Stellungnahme
- 5. Kritik und Würdigung der DSGVO
- 5.1 Kritische Beleuchtung der Datenschutz-Grundverordnung
- 5.2 Vorteile der neuen Gesetzgebung
- 5.2.1 Harmonisierung des Datenschutzniveaus
- 5.2.2 Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt
- 5.2.3 Pflicht zur Bestellung des Datenschutzbeauftragten
- 5.2.4 Konzernprivileg
- 5.2.5 Erleichterte Meldung an die Datenschutzaufsichtsbehörde
- 5.2.6 Kohärenzverfahren
- 5.2.7 „Recht auf Vergessenwerden“
- 5.2.8 Höhere Bußgelder
- 5.3 Stellungnahme
- 6. Aktuelle Rechtsprechung
- 6.1 Rechtsprechung des EuGH
- 6.2 Rechtsprechung des BVerfG
- 6.3 Rechtsprechung des BGH
- 6.4 Fallbeispiele aus der Rechtsprechung
- 6.5 Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Master-Thesis untersucht die erfolgreiche Implementierung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Unternehmen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die DSGVO, ihren Anwendungsbereich und die notwendigen Schritte für eine erfolgreiche Umsetzung zu geben. Die Arbeit analysiert sowohl die rechtlichen Anforderungen als auch praktische Aspekte der Implementierung.
- Die rechtlichen Grundlagen der DSGVO
- Der praktische Anwendungsbereich der DSGVO in Unternehmen
- Wichtige Vorschriften der DSGVO und deren Umsetzung
- Anwendungsbeispiele und Fallstudien
- Kritische Würdigung der DSGVO
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung stellt die Problemstellung der DSGVO-Implementierung dar, definiert die Ziele der Arbeit und beschreibt den Aufbau sowie die Methodik. Die Motivation des Autors für die Wahl dieses Themas wird ebenfalls erläutert. Der Fokus liegt auf der Herausstellung der Bedeutung einer effektiven DSGVO-Umsetzung für Unternehmen und der Notwendigkeit einer fundierten wissenschaftlichen Untersuchung.
2. Historische Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Datenschutzes, beginnend mit der Mitte des 20. Jahrhunderts bis hin zur Einführung der DSGVO. Es wird der Weg von frühen Datenschutzbestimmungen zum umfassenden Regelwerk der DSGVO nachgezeichnet, wobei die Rolle des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hervorgehoben wird. Die Entstehungsgeschichte der DSGVO und deren Inkrafttreten werden detailliert beschrieben, um den Kontext der aktuellen Rechtslage zu verdeutlichen.
3. Implementierung im Unternehmen: Dieses zentrale Kapitel behandelt die Bedeutung der DSGVO für Unternehmen und ihren umfassenden Anwendungsbereich. Es analysiert wichtige Vorschriften der DSGVO im Detail, einschließlich des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, der Grundsätze der Datenverarbeitung, der Auftragsverarbeitung, der Datensicherheit, der Rechte der betroffenen Personen, des Umgangs mit Datenverletzungen, Sanktionen, der Anforderungen an die Unternehmensstruktur, des Umgangs mit der Aufsichtsbehörde sowie des Umgangs mit Fotos im Internet. „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ werden ebenfalls erörtert. Das Kapitel betont die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Implementierung.
4. Anwendungsbeispiele zur Umsetzung der DSGVO: Dieses Kapitel bietet praktische Hilfestellungen zur Umsetzung der DSGVO. Es präsentiert eine Projektplanung und Checkliste, um Unternehmen bei der Implementierung zu unterstützen. Es werden Fallbeispiele vorgestellt, welche sowohl erfolgreiche als auch fehlerhafte Umsetzungen der DSGVO verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der Vermittlung praktischen Wissens und der Vermeidung von Fehlern.
5. Kritik und Würdigung der DSGVO: In diesem Kapitel werden sowohl kritische Aspekte der DSGVO als auch ihre Vorteile diskutiert. Die kritische Beleuchtung umfasst potenzielle Nachteile und Herausforderungen der Umsetzung. Die positiven Aspekte umfassen die Harmonisierung des Datenschutzniveaus, die Stärkung der Betroffenenrechte, die Erhöhung der Bußgelder und die verbesserte Rechtsklarheit. Eine ausgewogene Betrachtung der Vor- und Nachteile steht im Vordergrund.
Schlüsselwörter
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Datenschutz, Implementierung, Unternehmen, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), personenbezogene Daten, Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzbeauftragter, Betroffenenrechte, Rechtsprechung, Sanktionen, Compliance, Privacy by Design, Privacy by Default.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Implementierung der DSGVO in Unternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit befasst sich mit der erfolgreichen Implementierung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Unternehmen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die DSGVO, ihren Anwendungsbereich und die notwendigen Schritte für eine erfolgreiche Umsetzung, wobei sowohl rechtliche Anforderungen als auch praktische Aspekte der Implementierung analysiert werden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der DSGVO, den praktischen Anwendungsbereich in Unternehmen, wichtige Vorschriften und deren Umsetzung, Anwendungsbeispiele und Fallstudien sowie eine kritische Würdigung der DSGVO. Die historische Entwicklung des Datenschutzes bis hin zur DSGVO wird ebenso beleuchtet wie aktuelle Rechtsprechung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Ziele, Methodik), Historische Entwicklung (von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis zur DSGVO), Implementierung im Unternehmen (Bedeutung, Anwendungsbereich, wichtige Vorschriften), Anwendungsbeispiele (Projektplanung, Checkliste, Fallbeispiele), Kritik und Würdigung der DSGVO (Vorteile und Nachteile) und Aktuelle Rechtsprechung (EuGH, BVerfG, BGH, Fallbeispiele).
Welche konkreten Aspekte der DSGVO-Implementierung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert wichtige Vorschriften der DSGVO, wie das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Grundsätze der Datenverarbeitung, Auftragsverarbeitung, Datensicherheit, Betroffenenrechte, Umgang mit Datenverletzungen, Sanktionen, Anforderungen an die Unternehmensstruktur, Umgang mit der Aufsichtsbehörde und Umgang mit Fotos im Internet. „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ werden ebenfalls erörtert.
Welche praktischen Hilfestellungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet eine Projektplanung und Checkliste zur Implementierung der DSGVO in Unternehmen. Sie präsentiert Fallbeispiele, die sowohl erfolgreiche als auch fehlerhafte Umsetzungen verdeutlichen und praktische Anleitungen zur Vermeidung von Fehlern geben.
Wie wird die DSGVO in der Arbeit kritisch gewürdigt?
Die Arbeit diskutiert sowohl kritische Aspekte der DSGVO als auch ihre Vorteile. Die kritische Beleuchtung umfasst potenzielle Nachteile und Herausforderungen der Umsetzung. Die positiven Aspekte umfassen die Harmonisierung des Datenschutzniveaus, die Stärkung der Betroffenenrechte, die Erhöhung der Bußgelder und die verbesserte Rechtsklarheit.
Welche Rechtsprechungsquellen werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Rechtsprechung des EuGH, des BVerfG und des BGH. Sie enthält außerdem Fallbeispiele aus der Rechtsprechung zur Veranschaulichung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Datenschutz, Implementierung, Unternehmen, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), personenbezogene Daten, Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzbeauftragter, Betroffenenrechte, Rechtsprechung, Sanktionen, Compliance, Privacy by Design, Privacy by Default.
- Arbeit zitieren
- Fabian Schmidt (Autor:in), 2019, Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Wie eine erfolgreiche Implementierung im Unternehmen gelingt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512490