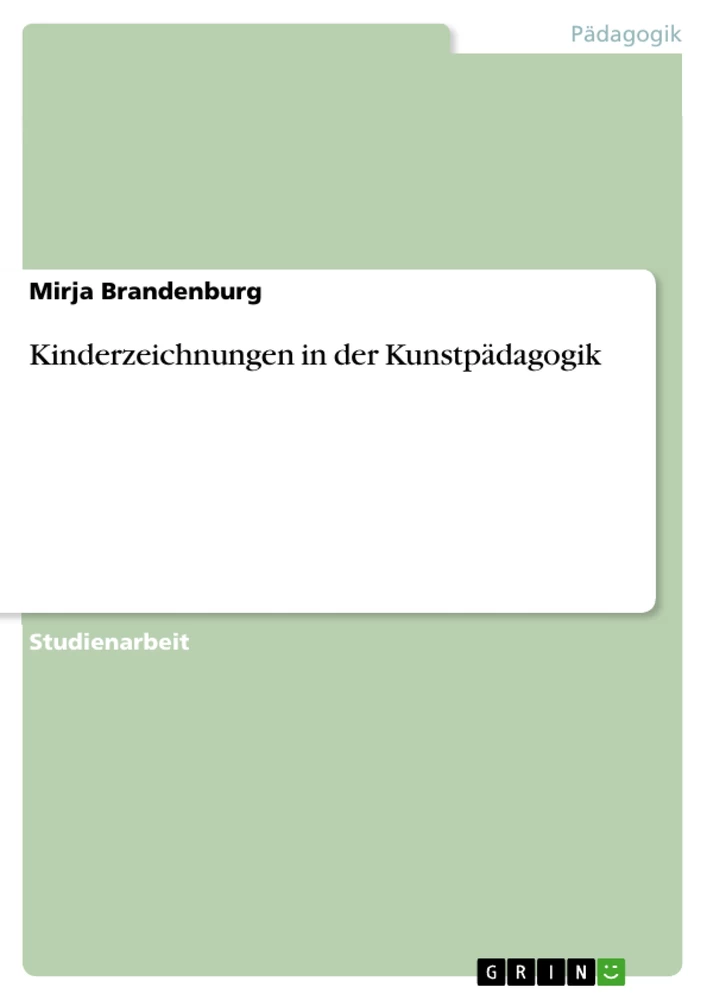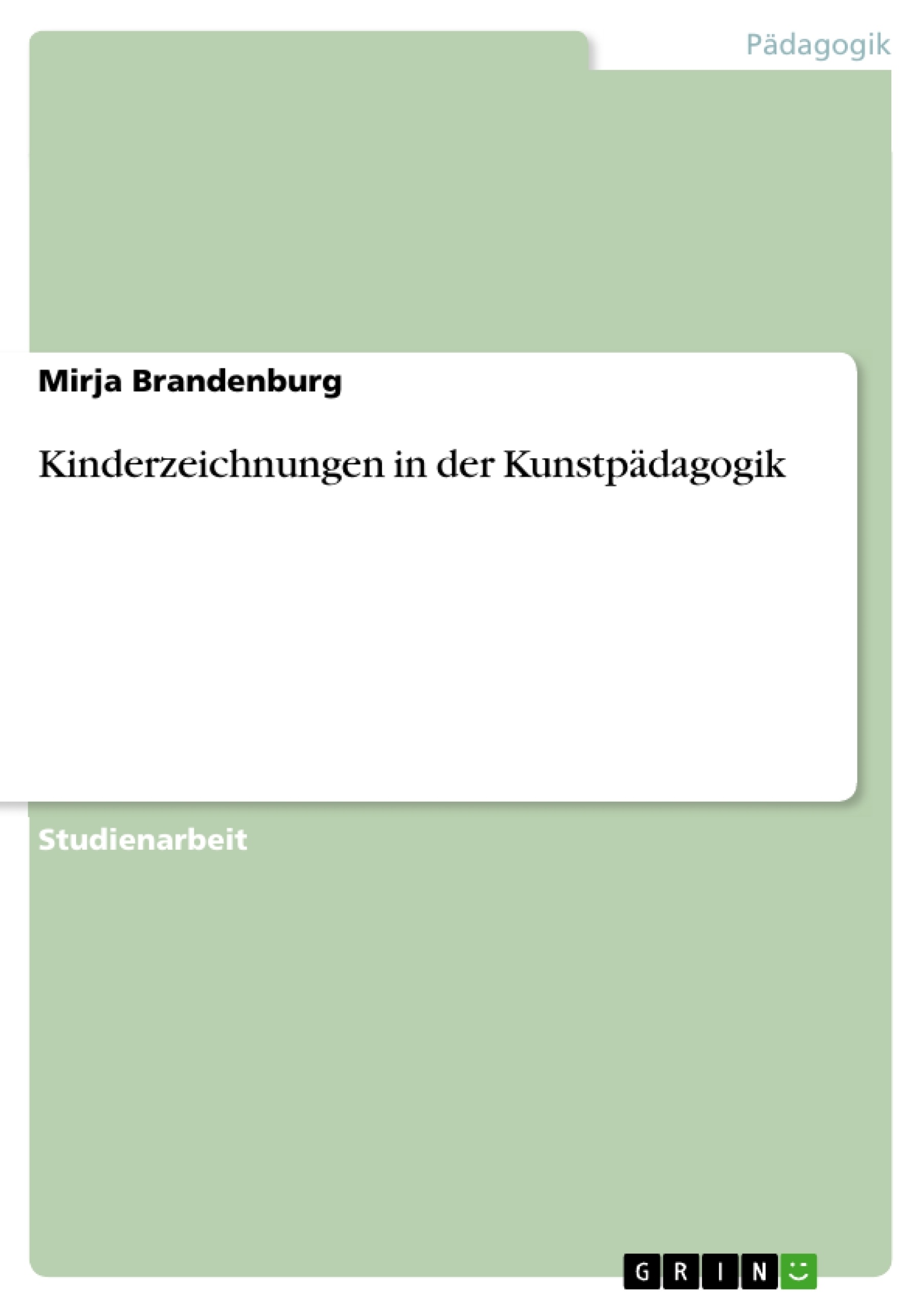Kinderzeichnungen entsprechen nicht unserer Vorstellung von Kunst. Ein Kinderbild basiert nicht auf einem frei intendierten Schaffen, sondern auf einer biologischen Entwicklung, die dem kindlichen Schöpfer keine ästhetische Freiheit gewährt. Das Kind versucht mit seinen Zeichnungen die Wirklichkeit zu erfassen. Gemeint ist damit die subjektive Realität, die sich im Geist des Kindes entwickelt und die während seines Reifens ständigen Veränderungen unterliegt. Die gemeinsame Basis von Künstlern und Kindern ist jedoch das Verlangen nach Aussage, Ausdruck und schöpferischer Tätigkeit, auch der Drang nach Anerkennung spielt eine Rolle. Der Übergang von der „Kinderkunst“ zur Kunst des Erwachsenen ist fliessend und beginnt, wenn das Kind sich der Verbindung von seiner Innen- und Aussenwelt bewusst wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Kinderzeichnungen und Kunst
- 2. Ornamentik in der Kinderzeichnung
- 3. Betrachtung von Kinderzeichnungen unter verschiedenen Aspekten
- 4. Umgang mit Kinderzeichnungen
- 5. Entwicklungsphasen der Kinderzeichnung
- 5.1 Die Schmier- und Sudelphase
- 5.2 Die Kritzelphase
- 5.3 Die Entdeckung der Farbe
- 5.4 Die Schemaphase
- 5.5 Die metrische Phase
- 6. Beidhändiges Zeichnen
- 7. Ethnische Besonderheiten von Kinderzeichnungen
- 8. Optik, Haptik und Motorik
- 9. Bildgebrauch
- 10. Selbstreflexion der Kinderzeichnung als autobiographische Erinnerungsarbeit
- 10.1 Auswertung des Fragenkataloges
- 11. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Kinderzeichnungen aus verschiedenen Perspektiven, von der Entwicklungspsychologie bis zur ästhetischen Wertschätzung. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Bedeutung von Kinderzeichnungen im Kontext der kindlichen Entwicklung und des künstlerischen Ausdrucks zu vermitteln.
- Entwicklungsphasen der Kinderzeichnung
- Bedeutung der Ornamentik in Kinderzeichnungen
- Interpretation von Kinderzeichnungen aus verschiedenen Blickwinkeln (psychologisch, pädagogisch, ästhetisch)
- Der richtige Umgang mit Kinderzeichnungen durch Erwachsene
- Kinderzeichnungen als Ausdruck der kindlichen Realität und Phantasie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Kinderzeichnungen und Kunst: Das Kapitel hinterfragt die gängige Unterscheidung zwischen "Kinderkunst" und "Kunst" im Erwachsenenverständnis. Es argumentiert, dass Kinderzeichnungen Ausdruck der subjektiven kindlichen Realität sind, die sich im Laufe der Entwicklung verändert. Trotz des Mangels an ästhetischer Freiheit im Sinne erwachsener Kunst, teilen Kinder und Künstler das Bedürfnis nach Ausdruck, schöpferischer Tätigkeit und Anerkennung. Der Übergang von der "Kinderkunst" zur Erwachsenenkunst ist fließend und beginnt mit dem Bewusstsein des Kindes für die Verbindung von Innen- und Außenwelt. Grözingers Aussage, dass das Ziel der kindlichen "künstlerischen" Entwicklung nicht die Kunst, sondern die Wirklichkeit ist, bildet den zentralen Punkt.
2. Ornamentik in der Kinderzeichnung: Dieses Kapitel untersucht die elementare Ornamentik (Reihung, Kreuzung, Wechsel, Streuung) in frühen Kinderzeichnungen und verortet ihre Wurzeln in der menschlichen Motorik und Haptik. Es wird der Zusammenhang zwischen der Entdeckung der abstrakten Kunst im 20. Jahrhundert und der Bedeutung von Kinderzeichnungen hergestellt. Der Text betont, dass Kinder die Ordnung der Formen in ihrer Entwicklung durchlaufen, jedoch nicht die Entwicklungsstufen menschlicher Stile wiederholen. Die Ornamentik wird als Ausdruck des Menschseins, Atmens, der Bewegung und des Rhythmus interpretiert, mit dem Beispiel der Zickzacklinie und ihrer Beziehung zu Rhythmus und Zeit (Grözingers "Zickzack ist ja im Raum dasselbe wie Tick-Tack in der Zeit").
3. Betrachtung von Kinderzeichnungen unter verschiedenen Aspekten: Dieses Kapitel beleuchtet die vielfältigen Aspekte, unter denen Kinderzeichnungen betrachtet werden können. Es betont ihre Bedeutung als Indikatoren für die kindliche Entwicklung, insbesondere die Feinmotorik und die Auge-Hand-Koordination, und ihre Relevanz für die Einschätzung der Schulreife. Weiterhin werden die psychologischen Aspekte von Kinderzeichnungen hervorgehoben – als Ausdruck von Gefühlen, Wünschen und Ängsten und ihr Einsatz in psychologischen Tests. Der Text diskutiert auch die präventive und psychohygienische Wirkung des Malens und Zeichnens für Kinder, die damit ihre Erfahrungen verarbeiten und ihren gedanklichen Horizont stabilisieren. Schließlich wird die ästhetische Wirkung des Malens und Zeichnens im Kontext der kindlichen Entwicklung betrachtet.
4. Umgang mit Kinderzeichnungen: Der Umgang mit Kinderzeichnungen durch Erwachsene steht im Mittelpunkt dieses Kapitels. Es warnt sowohl vor Über- als auch vor Unterschätzung der Kinderkunst. Der Text betont die Bedeutung der Wertschätzung der Kinderzeichnung als entwicklungsförderndes Produkt, ohne sie zu überhöhen. Die Notwendigkeit einer Verbindung zwischen dem Bildermachen und der lebensweltlichen Wirklichkeit im Unterricht wird hervorgehoben. Gefahren wie Kanonisierung von Themen, formalisierter Unterricht, kommerzielle Ausbeutung und die Deklarierung von Kinderzeichnungen als Kunst ohne Rücksicht auf die Bildpragmatik werden angesprochen. Die Bereitschaft der Kinder, ihre Bilder zu verschenken, wird als wichtiger Aspekt im Kontext des Umgangs mit den Zeichnungen der Kinder durch die Erwachsenen diskutiert.
Schlüsselwörter
Kinderzeichnungen, Entwicklungspsychologie, Ornamentik, Kunst, Ästhetik, Pädagogik, Psychologie, Feinmotorik, Schulreife, Ausdrucksformen, Realität, Phantasie, Umgang mit Kunstwerken, Kindliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zu "Kinderzeichnungen und Kunst"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Kinderzeichnungen aus verschiedenen Perspektiven: entwicklungspsychologisch, ästhetisch und pädagogisch. Ziel ist ein umfassendes Verständnis der Bedeutung von Kinderzeichnungen für die kindliche Entwicklung und den künstlerischen Ausdruck.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Entwicklungsphasen der Kinderzeichnung, die Bedeutung der Ornamentik, die Interpretation von Kinderzeichnungen aus verschiedenen Blickwinkeln (psychologisch, pädagogisch, ästhetisch), den richtigen Umgang mit Kinderzeichnungen durch Erwachsene und Kinderzeichnungen als Ausdruck von kindlicher Realität und Phantasie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in elf Kapitel: Kapitel 1 hinterfragt die Unterscheidung zwischen "Kinderkunst" und "Kunst". Kapitel 2 untersucht die Ornamentik in frühen Kinderzeichnungen. Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Betrachtungsweisen von Kinderzeichnungen (entwicklungspsychologisch, psychologisch, ästhetisch). Kapitel 4 behandelt den Umgang mit Kinderzeichnungen durch Erwachsene. Kapitel 5 beschreibt die Entwicklungsphasen der Kinderzeichnung im Detail (Schmier-, Kritzel-, Farb-, Schema- und metrische Phase). Kapitel 6 widmet sich dem beidhändigen Zeichnen. Kapitel 7 betrachtet ethnische Besonderheiten. Kapitel 8 befasst sich mit Optik, Haptik und Motorik. Kapitel 9 behandelt den Bildgebrauch. Kapitel 10 untersucht die Selbstreflexion der Kinderzeichnung als autobiografische Erinnerungsarbeit. Kapitel 11 fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird die Ornamentik in Kinderzeichnungen interpretiert?
Die Ornamentik (Reihung, Kreuzung, Wechsel, Streuung) wird als Ausdruck von Motorik, Haptik, Bewegung und Rhythmus interpretiert. Der Zusammenhang zur abstrakten Kunst des 20. Jahrhunderts wird hergestellt. Es wird betont, dass Kinder die Ordnung der Formen durchlaufen, aber keine Entwicklungsstufen menschlicher Stile wiederholen.
Welche Bedeutung haben Kinderzeichnungen für die kindliche Entwicklung?
Kinderzeichnungen sind Indikatoren für die kindliche Entwicklung, insbesondere die Feinmotorik und Auge-Hand-Koordination. Sie sind relevant für die Einschätzung der Schulreife und drücken Gefühle, Wünsche und Ängste aus. Malen und Zeichnen wirken präventiv und psychohygienisch.
Wie sollte man als Erwachsener mit Kinderzeichnungen umgehen?
Der Umgang mit Kinderzeichnungen sollte weder über- noch unterschätzend sein. Wertschätzung als entwicklungsförderndes Produkt ist wichtig, ohne Überhöhung. Eine Verbindung zwischen Bildermachen und Lebenswelt im Unterricht ist notwendig. Gefahren wie Kanonisierung, formalisierter Unterricht, kommerzielle Ausbeutung und die Deklarierung als Kunst ohne Rücksicht auf die Bildpragmatik werden angesprochen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderzeichnungen, Entwicklungspsychologie, Ornamentik, Kunst, Ästhetik, Pädagogik, Psychologie, Feinmotorik, Schulreife, Ausdrucksformen, Realität, Phantasie, Umgang mit Kunstwerken, Kindliche Entwicklung.
Welche Entwicklungsphasen der Kinderzeichnung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Schmier- und Sudelphase, die Kritzelphase, die Entdeckung der Farbe, die Schemaphase und die metrische Phase.
- Quote paper
- Mirja Brandenburg (Author), 2004, Kinderzeichnungen in der Kunstpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51250