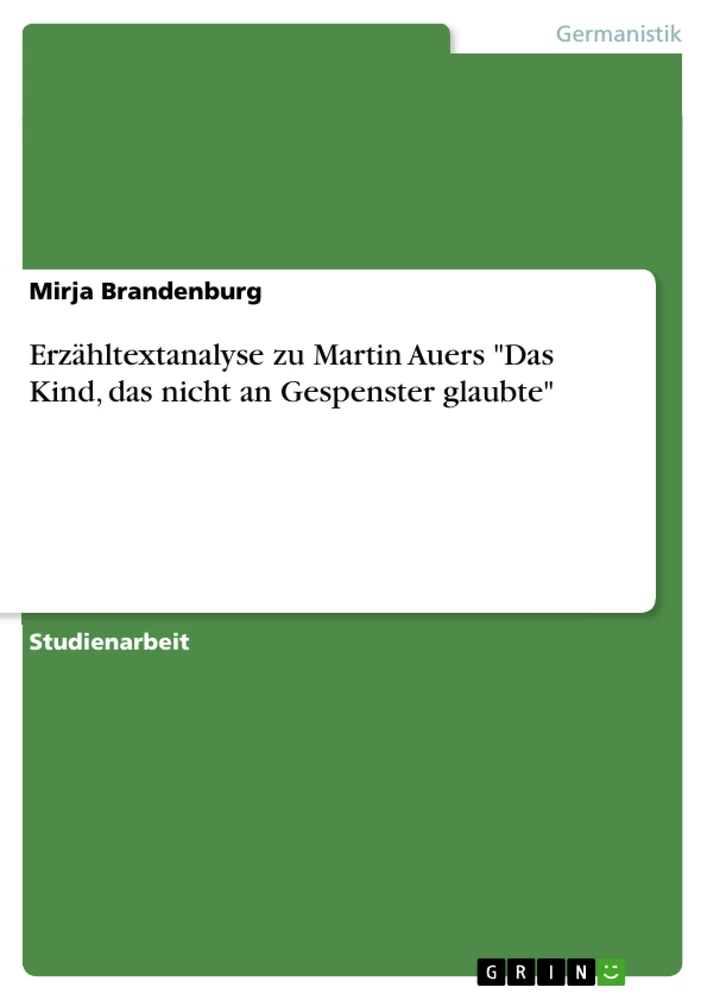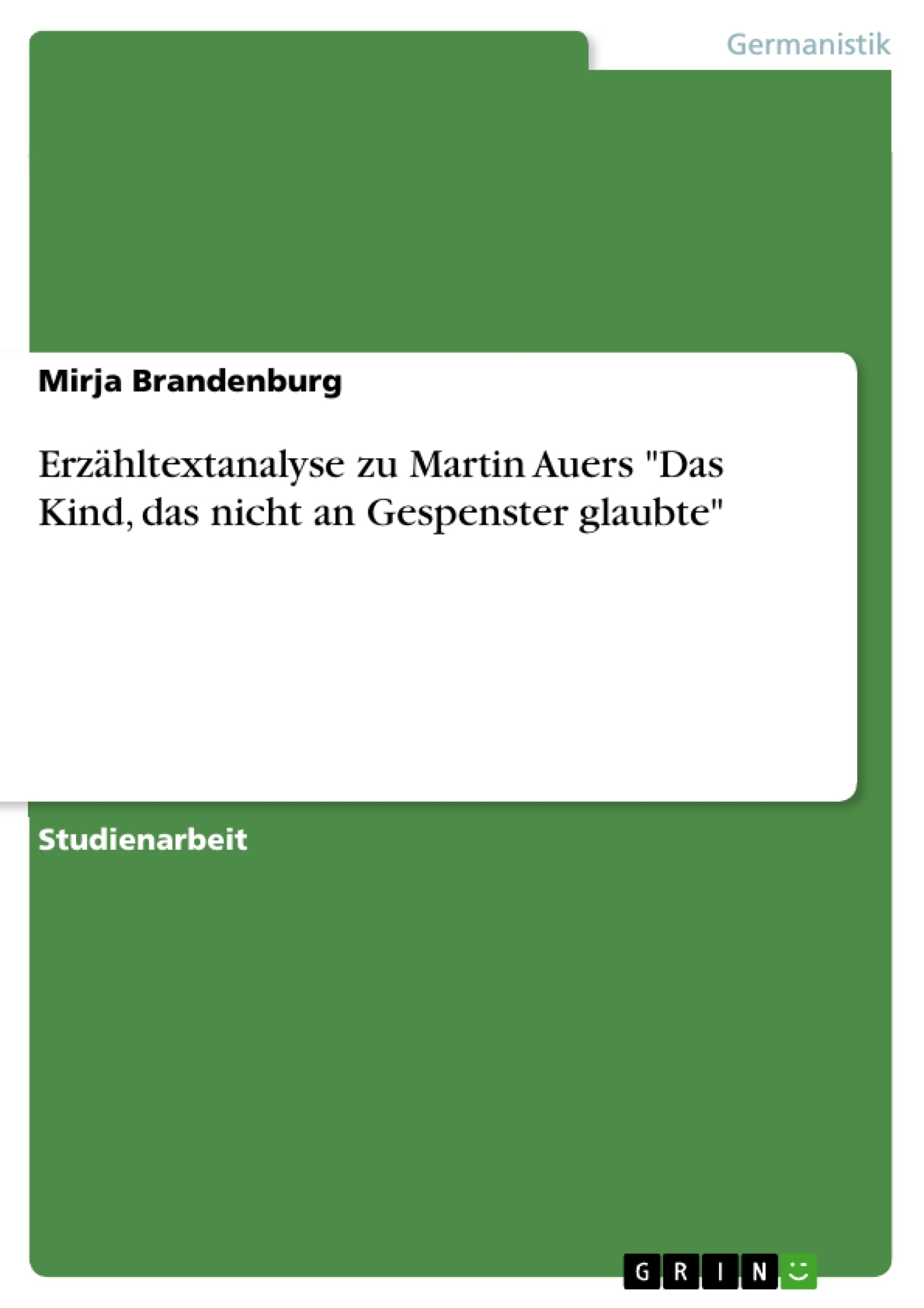Die Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse des Erzähltextes >Das Kind, das nicht an Gespenster glaubte< von Martin Auer. Nach dem ersten Lesen des Textes fiel mir zunächst die offene Auflösung auf, die ich für eine Kindergeschichte ganz untypisch fand. Nachdem ich jedoch Recherchen zur Person Martin Auers angestellt habe, bin ich auf Hinweise gestoßen, mit denen ich mir ein solch ungewöhnliches Ende besser erklären konnte. Martin Auer ist ausgebildeter Schauspieler und hält häufig Lesungen vor Kindern, während dieser Lesungen spielt er Episoden seiner Geschichten vor, begleitet sie mit Zauberkunststücken oder Gitarrenspiel. Wesentlich ist hierbei, dass Auer im Nachhinein mit den Kindern diskutiert, philosophiert und phantasiert. Das offene Ende des Untersuchungstextes, dass geradezu auf dem Höhepunkt des Konflikts stattfindet, eignet sich somit optimal, um Kinder zum Nachdenken und Diskutieren anzuregen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die allgemeine Charakterisierung des Erzähltextes
- 2.1 Die Inhaltshypothese
- 3. Die Analyse und Interpretation des Erzähltextes
- 3.1 Die Ereignisanalyse
- 3.2 Die Analyse der Figuren
- 3.3 Die Analyse des Menschen- und Weltbildes
- 3.4 Die Analyse der symbolischen Bedeutung
- 3.5 Die Analyse der Gestaltungs- und Erzählweise
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Martin Auers Kurzgeschichte „Das Kind, das nicht an Gespenster glaubte“. Ziel ist es, den Erzähltext zu interpretieren und die zentralen Themen herauszuarbeiten. Die offene Auflösung der Geschichte und die mögliche psychologische Bedeutung des kindlichen Verhaltens stehen im Mittelpunkt der Analyse.
- Die Auseinandersetzung mit dem Glauben und Unglauben an das Übernatürliche
- Die Analyse der Hauptfigur und deren Konflikt mit dem Irrationalen
- Die Untersuchung der Erzähltechnik und ihrer Wirkung auf den Leser
- Der Vergleich zwischen rationalem und ästhetischem Denken im Kontext der Geschichte
- Die Bedeutung des offenen Endes und seine didaktische Funktion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in die Analyse der Kurzgeschichte „Das Kind, das nicht an Gespenster glaubte“ von Martin Auer ein. Die Autorin beschreibt ihre anfängliche Reaktion auf das offene Ende der Geschichte und ihre darauf folgenden Recherchen zum Autor Martin Auer, dessen interaktive Lesungen mit Kindern den ungewöhnlichen Schluss kontextualisieren. Sie stellt eine Hypothese auf, die das Verhalten des Kindes psychologisch erklärt, basierend auf der Annahme einer kognitiven Dissonanz und der daraus resultierenden Aggression. Weiterhin diskutiert sie den Einfluss von Gunter Ottos Didaktik auf ihre Interpretation und die Bedeutung der Pluralität von Erkenntniswegen, wobei sie den Konflikt zwischen rationalem und ästhetischem Denken betont.
2. Die allgemeine Charakterisierung des Erzähltextes: Dieses Kapitel charakterisiert den Erzähltext. Es wird die Herkunft des Textes aus einem unbekannten Sammelband erwähnt und der Autor Martin Auer kurz vorgestellt, unter Angabe seiner ersten Veröffentlichung und seiner Auszeichnungen. Die Kurzgeschichte wird der Gattung Epik zugeordnet und ihr Erzählstil, der sich zwar an Kinder richtet, aber auch ein breiteres Publikum anspricht, beschrieben. Der Stil wird als typisch für Kindergeschichten beschrieben, obwohl die Geschichte nicht ausschließlich für Kinder geschrieben zu sein scheint.
2.1 Die Inhaltshypothese: Dieser Abschnitt beschreibt den Prozess der Formulierung einer Inhaltshypothese, die die zentralen Probleme der Geschichte benennt. Die Autorin diskutiert zwei Möglichkeiten der Zusammenfassung von Erzähltexten und entscheidet sich, das "Thema" des Textes zu analysieren, um die Geschichte besser zu verstehen. Sie formuliert ihre Arbeitshypothese: "Martin Auers Kurzgeschichte handelt von den Problemen, die es bereiten kann, wenn man sich weigert an Dinge zu glauben, obgleich diese offensichtlich sind." Diese Hypothese wird im weiteren Verlauf der Arbeit überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Schlüsselwörter
Martin Auer, Kindergeschichte, Erzähltextanalyse, offenes Ende, Glaube, Unglaube, Irrationalität, kognitive Dissonanz, Aggression, ästhetisches Denken, wissenschaftliche Rationalität, Pluralität von Erkenntniswegen, Gunter Otto.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse von Martin Auers "Das Kind, das nicht an Gespenster glaubte"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert die Kurzgeschichte "Das Kind, das nicht an Gespenster glaubte" von Martin Auer. Der Fokus liegt auf der Interpretation des Erzähltextes und der Herausarbeitung zentraler Themen, insbesondere der offenen Auflösung und der psychologischen Bedeutung des kindlichen Verhaltens.
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse befasst sich mit der Auseinandersetzung mit Glauben und Unglauben an das Übernatürliche, der Analyse der Hauptfigur und deren Konflikt mit dem Irrationalen, der Untersuchung der Erzähltechnik und ihrer Wirkung, dem Vergleich zwischen rationalem und ästhetischem Denken und der Bedeutung des offenen Endes sowie dessen didaktischer Funktion.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, die allgemeine Charakterisierung des Erzähltextes (inkl. Inhaltshypothese), die Analyse und Interpretation des Erzähltextes (Ereignisanalyse, Figuren-, Weltbild-, Symbol-, und Erzählweisenanalyse) und ein Fazit. Es werden Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche Hypothese wird aufgestellt und untersucht?
Die Arbeitshypothese lautet: "Martin Auers Kurzgeschichte handelt von den Problemen, die es bereiten kann, wenn man sich weigert an Dinge zu glauben, obgleich diese offensichtlich sind." Diese Hypothese wird im Laufe der Arbeit überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Welche Rolle spielt die Didaktik von Gunter Otto?
Der Einfluss der Didaktik von Gunter Otto auf die Interpretation der Geschichte wird diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung der Pluralität von Erkenntniswegen und den Konflikt zwischen rationalem und ästhetischem Denken.
Wie wird das offene Ende der Geschichte interpretiert?
Das offene Ende der Geschichte und seine mögliche didaktische Funktion stehen im Mittelpunkt der Analyse. Die Autorin verbindet das offene Ende mit der Annahme einer kognitiven Dissonanz und der daraus resultierenden Aggression des Kindes.
Wer ist Martin Auer?
Die Arbeit stellt Martin Auer kurz vor, erwähnt seine erste Veröffentlichung und Auszeichnungen, und kontextualisiert die Kurzgeschichte im Hinblick auf Auers interaktive Lesungen mit Kindern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Martin Auer, Kindergeschichte, Erzähltextanalyse, offenes Ende, Glaube, Unglaube, Irrationalität, kognitive Dissonanz, Aggression, ästhetisches Denken, wissenschaftliche Rationalität, Pluralität von Erkenntniswegen, Gunter Otto.
- Quote paper
- Mirja Brandenburg (Author), 2004, Erzähltextanalyse zu Martin Auers "Das Kind, das nicht an Gespenster glaubte", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51252