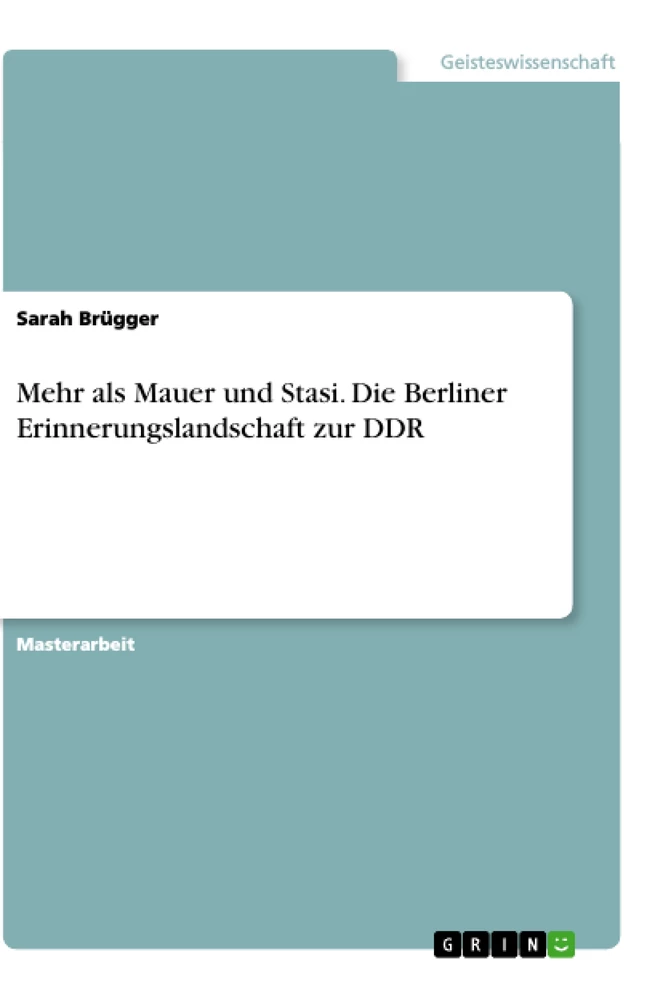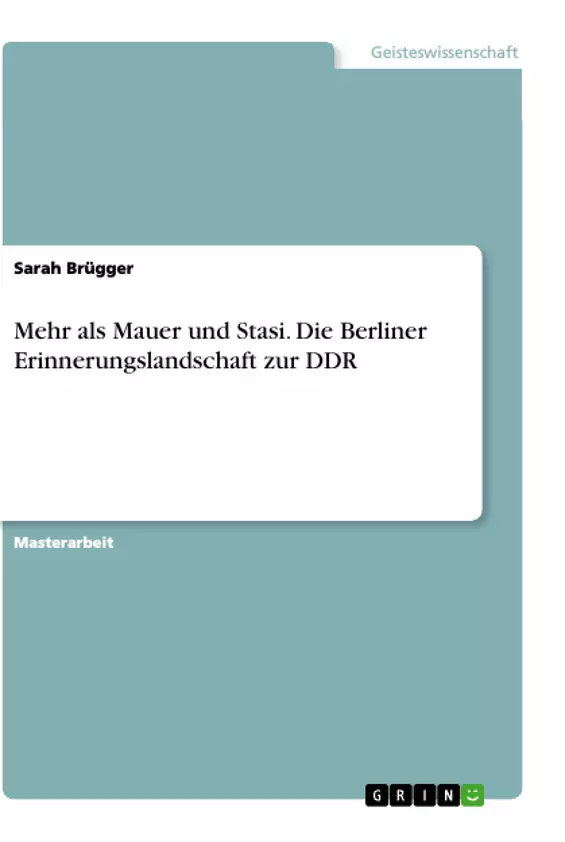Gegenstand dieser Masterarbeit ist die soziale Konstruktion der kollektiven Erinnerung an die DDR. Wie wird im heutigen Berlin die DDR dargestellt? Welche Diskurse über die DDR werden den Besuchern vermittelt und wessen Geschichte ist es, die erzählt wird? Wer sind die verschiedenen Akteure, die an der Darstellung der DDR-Vergangenheit im Stadtbild Berlins beteiligt sind und welche Interessen verfolgen sie? Auf welche Diskurse beziehen sie sich und welche Strategien wenden sie an, um ihre Deutung der Vergangenheit zu legitimieren? Lassen sich typische Argumentationsmuster erkennen, die die Produktion von Erinnerungsorten begleiten? Um diese Fragen zu beantworten, besuchte die Autorin Berliner Erinnerungsstätten zur DDR, ging Verlautbarungen und Werbematerial verschiedener Institutionen durch und führte Interviews mit Vertreter/innen von Gedenkstätten und anderen Institutionen sowie mit Bewohner/innen und Besucher/innen Berlins. Sie orientierte sich dabei an der jüngeren Forschung zum kollektiven Gedächtnis, wonach das Vergangene von der Gegenwart ausgehend rekonstruiert wird.
Die Analyse der Berliner Erinnerungslandschaft zeigte, dass darin vier Themen einen prominenten Platz einnehmen. Auf der einen Seite sind dies die Berliner Mauer, die Staatsicherheit sowie die Opposition in der DDR, die sich gegen die diktatorischen Verhältnisse zur Wehr setzte. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Erinnerungsorte, die sich dem realsozialistischen Alltag widmen und somit ein eher (n)ostalgisches Bild der DDR vermitteln.
In einem zweiten Schritt wurden die Diskurse der verschiedenen Akteure, die sich an der Debatte um eine angemessene Erinnerungskultur beteiligen, herausgearbeitet und die Auseinandersetzungen um das Sagbare und das Unsagbare geschildert. Dabei werden vier Diskursgemeinschaften (die "Ankläger", die "Pragmatiker", die "(N)Ostalgiker" sowie der offizielle Diskurs) identifiziert. Die verschiedenen Diskursgemeinschaften konkurrieren um die ihrer Meinung nach richtige Vergangenheitsdeutung, sind gleichzeitig aber auch als aufeinander bezogen zu verstehen. Eine wichtige Rolle spielt bei dieser Analyse die Unterscheidung zwischen dem kommunikativen Gedächtnis der Zeitzeugen und dem kulturellen Gedächtnis, das die Generationen überdauern soll. Der letzte Teil widmet sich den Argumentationsmustern, die trotz der unterschiedlichen historischen Narrationen oft erstaunlich ähnlich sind.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- Thema und Fragestellung
- Theoretische Bezugspunkte
- Zur Wahl des Forschungsfeldes
- Literaturlage
- Aufbau der Arbeit
- Teil 1: Theoretischer und konzeptioneller Rahmen
- 1.1 Gedächtnis und Geschichte in der Sozialanthropologie
- 1.2 Das kollektive Gedächtnis nach Halbwachs
- 1.3 Das kommunikative und kulturelle Gedächtnis der Assmanns
- 1.4 Lieux de mémoire
- 1.5 Das Gedächtnis im Raum
- 1.6 Orte der Erinnerung als touristische Attraktionen
- 1.7 Erinnerungen und Diskurse
- Teil 2: Forschungsprozess
- 2.1 Datenerhebung
- 2.2 Vom Feld zum Text
- Teil 3: Forschungskontext
- 3.1 Das Neue Berlin
- 3.2 Die DDR im wiedervereinten Deutschland
- 3.3 Erinnerung und Propaganda vor 1989
- Teil 4: Resultate
- 4.1 Die Vermarktung Berlins
- 4.2 Ein Überblick über die Berliner Erinnerungslandschaft
- 4.2.1 Kalter Krieg und geteilte Stadt
- 4.2.2 Der Stasi-Staat
- 4.2.3 Widerstand und Opposition
- 4.2.4 Der realsozialistische Alltag
- 4.2.5 Was fehlt?
- 4.3 Die Diskursgemeinschaften
- 4.3.1 Die Ankläger
- 4.3.2 Die Politiker
- 4.3.3 Die Pragmatiker
- 4.3.4 Die (N)Ostalgiker
- 4.5 Argumentationsmuster
- 4.5.1 Die Autorität der Produzenten
- 4.5.2 Die zwei deutschen Diktaturen
- 4.5.3 Die Wahl des Ortes
- 4.5.4 Auf der Suche nach Authentizität
- Schlussdiskussion
- Die verschiedenen Akteure und ihre Interessen an der Darstellung der DDR-Vergangenheit
- Die Diskurse, die die Produktion von Erinnerungsorten begleiten
- Die Strategien, die die Akteure anwenden, um ihre Deutung der Vergangenheit zu legitimieren
- Typische Argumentationsmuster in der Produktion von Erinnerungsorten
- Der Einfluss des Tourismus auf die Berliner Erinnerungslandschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung der DDR in der heutigen Berliner Erinnerungslandschaft. Sie untersucht, wie die DDR-Vergangenheit in Museen, Gedenkstätten und anderen öffentlichen Räumen präsentiert wird, welche Diskurse dabei vermittelt werden und welche Interessen die Akteure verfolgen, die an der Produktion dieser Orte beteiligt sind.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema und die Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas Erinnerungskultur in Deutschland und insbesondere die Debatte um den Umgang mit der DDR-Vergangenheit. Der erste Teil der Arbeit behandelt theoretische Bezugspunkte, darunter die Konzepte des kollektiven Gedächtnisses nach Halbwachs, des kommunikativen und kulturellen Gedächtnisses der Assmanns sowie der „Lieux de mémoire“. Der zweite Teil widmet sich dem Forschungsprozess und den Datenerhebungsmethoden. Der dritte Teil stellt den Forschungskontext vor, insbesondere die Geschichte Berlins nach dem Fall der Mauer sowie die Entwicklung der Erinnerungskultur in Ost- und Westdeutschland.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Erinnerungskultur, DDR-Vergangenheit, Berliner Erinnerungslandschaft, Diskurse, Akteure, Interessen, Strategien, Argumentationsmuster, Tourismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die DDR im heutigen Berlin dargestellt?
Die Darstellung ist vielfältig und reicht von Gedenkstätten zur Berliner Mauer und Stasi (Repression) bis hin zu Museen, die den realsozialistischen Alltag und (N)Ostalgie thematisieren.
Was ist der Unterschied zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis?
Das kommunikative Gedächtnis basiert auf den persönlichen Erfahrungen von Zeitzeugen, während das kulturelle Gedächtnis durch Institutionen und Monumente über Generationen hinweg geformt wird.
Wer sind die Akteure der Berliner Erinnerungskultur?
Dazu gehören staatliche Institutionen (Politiker), ehemalige Oppositionelle (Ankläger), Tourismus-Vermarkter (Pragmatiker) und Privatpersonen mit (n)ostalgischen Interessen.
Welche Rolle spielt der Tourismus für die Erinnerung?
Orte der Erinnerung werden oft als touristische Attraktionen vermarktet, was die Darstellung beeinflusst und manchmal zu einer Vereinfachung historischer Fakten führt.
Was wird in der Berliner Erinnerungslandschaft oft ausgelassen?
Die Arbeit untersucht kritisch, "was fehlt", also welche Aspekte der DDR-Geschichte im aktuellen Diskurs und im Stadtbild weniger präsent sind oder bewusst ausgeklammert werden.
- Quote paper
- Sarah Brügger (Author), 2009, Mehr als Mauer und Stasi. Die Berliner Erinnerungslandschaft zur DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512613