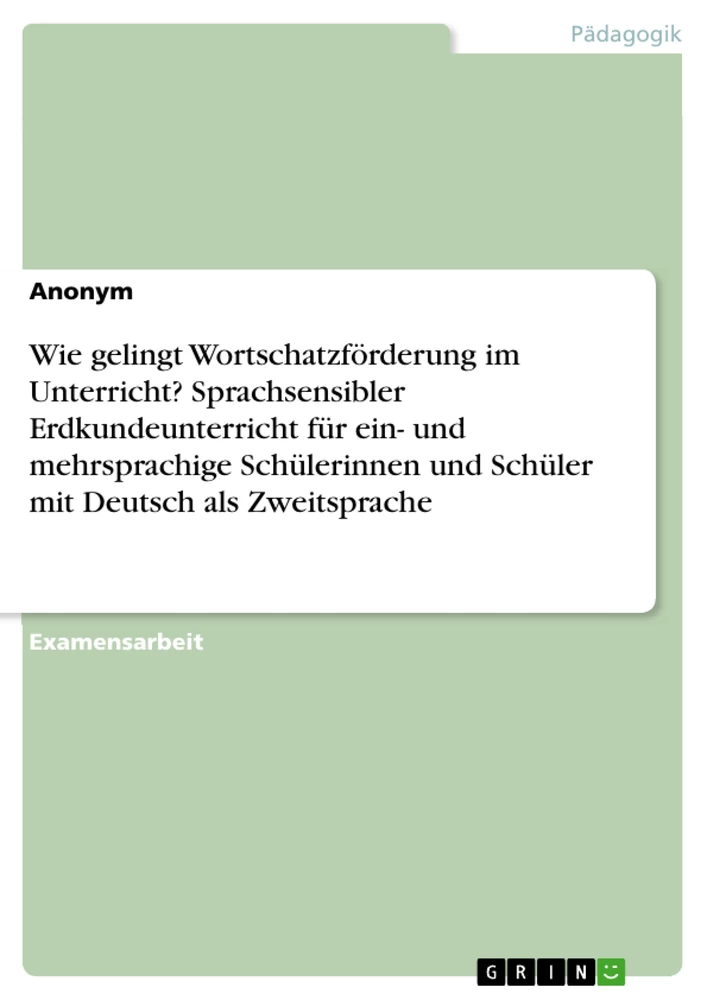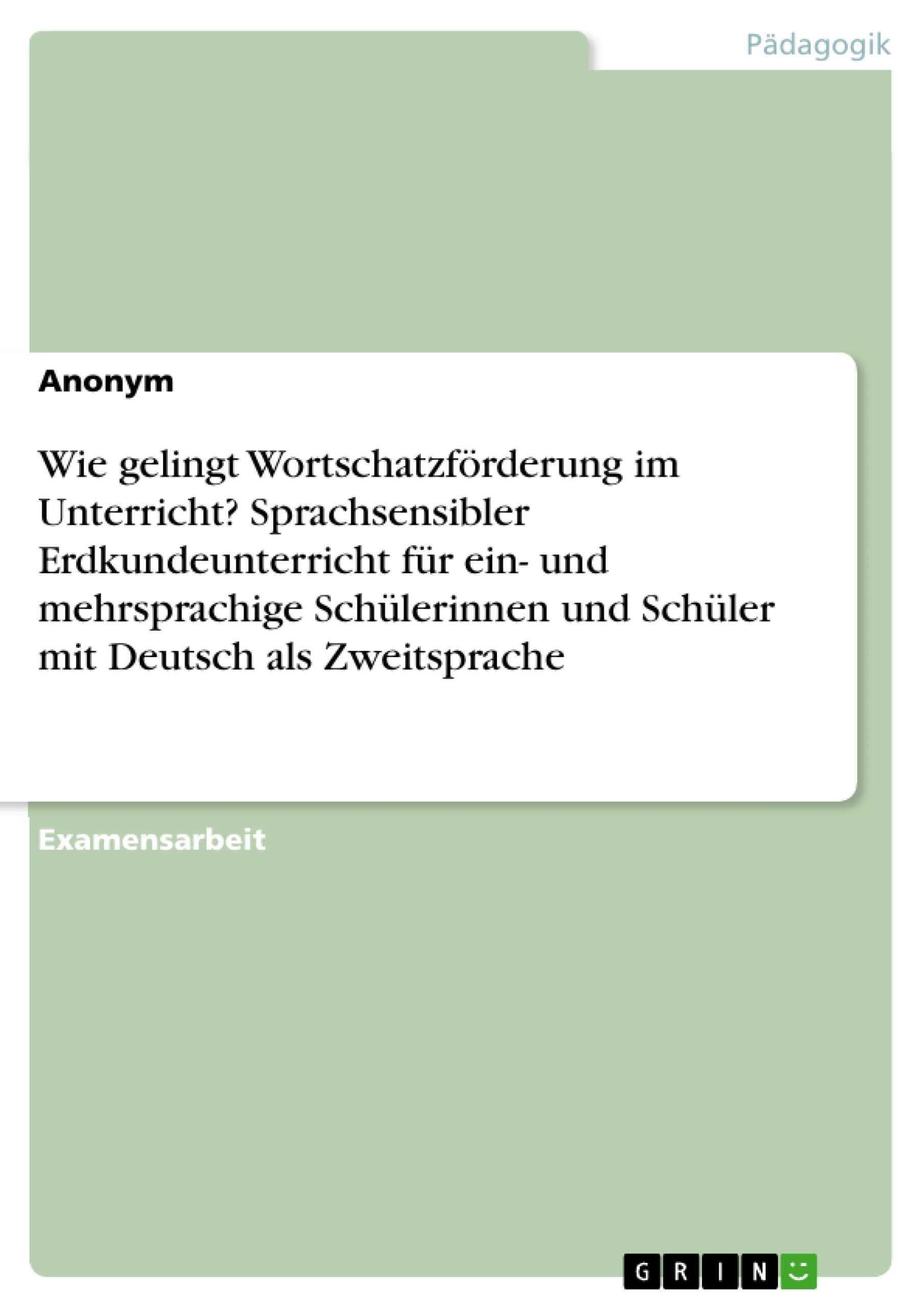Diese Abschlussarbeit befasst sich mit der Frage, wie eine gezielte Förderung des Wortschatzes im Fach Erdkunde dazu beitragen kann, ein- und mehrsprachige Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich gezielt zu unterstützten.
Zu Beginn und Ende des Schuljahres 2003/2004 wurde die Studie „DESI“ an mehreren deutschen Schulen durchgeführt. Untersucht wurden die sprachlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrganges in den Fächern Deutsch und Englisch. Teil der Studie war ein Wortschatz-Test, welcher ergab, dass die Wortschatzkompetenz 38% aller Schülerinnen und Schüler unter dem Niveau A liegt. Das bedeutet, dass diese den Grundwortschatz von 2000 Wörtern nur teilweise beherrschen. Betroffen sind davon verstärkt Schülerinnen und Schüler, deren Hauptsprache nicht Deutsch ist, aber auch deutschsprachige Jugendliche weisen hier einen Förderbedarf auf. Auffällig ist, dass sich vorrangig in den Hauptschulen und den Integrierten Gesamtschulen über 50% der Schülerinnen und Schüler unter dem Niveau A befinden. Willenberg befürchtet, dass unter anderem die fehlende Fachliteratur zur Wortschatzarbeit im Sekundarbereich schuld daran ist, dass die Lehrerschaft sich zwar thematisch mit Wortschatzproblemen auseinandersetze, diese jedoch nicht systematisch behandeln könne. Zudem seien sich die Lehrkräfte der Wichtigkeit eines differenzierten Wortschatzes nicht bewusst.
Um dem Ziel dieser Arbeit nachzukommen, wird deshalb zunächst eine Überblick über die wichtigsten Aspekte der Sprach- und Wortschatzförderung gegeben, bevor in Kapitel zwei der Spracherwerb im Deutschen und verschiedene Spracherwerbstypen theoretisch vorgestellt werden. Anschließend wird auf das sogenannte mentale Lexikon eingegangen, bevor im Kapitel 4 der Wortschatzerwerb selbst in Erst- und Zweitsprache vorgestellt wird. Hiernach werden dann die verschiedenen fachsprachlichen Register, speziell das Fach Erdkunde, näher beleuchtet. Kapitel sechs endet zusammenfassend mit den wichtigsten Kompetenzen, die Fachlehrkräfte zur gezielten Förderung des Wortschatzes mitbringen müssen. Aufbauend auf den Kapiteln zwei bis sechs werden dann die Erkenntnisse in eine empirische Studie, basierend auf Leitfadeninterviews, umgesetzt. Im letzten Kapitel wird eine Beispielstunde, die auf den zuvor gesammelten Erkenntnissen beruht, dargestellt, bevor die Arbeit mit einer reflektierenden Zusammenfassung und einem Ausblick endet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spracherwerb im Deutschen
- Spracherwerbstypen
- DaM, DaF und DaZ
- Wortschatz und mentales Lexikon
- Aufbau des mentalen Lexikons
- Wortschatzerwerb
- Im Erstspracherwerb
- Im Zweitspracherwerb
- Sprachen in der Schule
- Schulische Sprachregister
- Merkmale und Herausforderungen der Fachsprache Erdkunde
- Sprachsensibler Fachunterricht
- Wortschatzarbeit
- Prinzipien der Wortschatzarbeit
- Beispiele für die Umsetzung im Erdkundeunterricht
- Notwendige Kompetenzen seitens der Lehrkräfte
- Sprachliche Ausbildung von Fachlehrkräften
- Empirische Studie: Wortschatzförderung im Erdkundeunterricht
- Fragestellungen
- Methoden: Erhebung und Auswertung
- Probanden
- Das Leitfadeninterview
- Entwicklung des Leitfadens
- Durchführung
- Transkription
- Inhaltsanalyse
- Ergebnisse der empirischen Studie
- Besonderheiten des Erdkundeunterrichts
- Umsetzung des Wissens über Wortschatzarbeit
- Rolle der Fachlehrkräfte bei der Sprachförderung
- Umgang mit Sprachförderung an den Schulen
- Diskussion der Ergebnisse der empirischen Studie
- Beispielstunde: Wortschatzarbeit im Erdkundeunterricht
- Sprachdidaktische Begründung der Beispielstunde
- Stundenverlaufsplan
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die gezielte Wortschatzförderung im Erdkundeunterricht, insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache. Sie analysiert die Herausforderungen des Spracherwerbs im Fach Erdkunde und beleuchtet die Bedeutung eines sprachsensiblen Unterrichtskonzepts. Die Arbeit befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Wortschatzarbeit, einschließlich der Prinzipien, der Umsetzung in der Praxis und der notwendigen Kompetenzen von Lehrkräften. Darüber hinaus wird eine empirische Studie vorgestellt, die die Erfahrungen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf die Wortschatzförderung im Erdkundeunterricht untersucht.
- Spracherwerb im Fach Erdkunde
- Wortschatzarbeit und Sprachsensibilität
- Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache
- Die Rolle der Lehrkräfte bei der Wortschatzförderung
- Empirische Untersuchung der Praxis im Erdkundeunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der gezielten Wortschatzförderung im Erdkundeunterricht ein und stellt den Forschungsstand dar. Kapitel 2 befasst sich mit dem Spracherwerb im Deutschen, wobei die verschiedenen Spracherwerbstypen und die Bedeutung von Deutsch als Muttersprache (DaM), Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erläutert werden. Kapitel 3 analysiert die Bedeutung des Wortschatzes und des mentalen Lexikons für den Spracherwerb. Kapitel 4 beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Wortschatzerwerbs, sowohl im Erstspracherwerb als auch im Zweitspracherwerb. Kapitel 5 widmet sich dem Einfluss von Sprachen in der Schule und den Besonderheiten des Fachwortschatzes im Erdkundeunterricht. In Kapitel 6 werden Prinzipien der Wortschatzarbeit und Beispiele für die Umsetzung im Erdkundeunterricht vorgestellt. Kapitel 7 präsentiert eine empirische Studie, die die Wortschatzförderung im Erdkundeunterricht aus der Perspektive von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern untersucht. Die Ergebnisse der Studie werden in Kapitel 8 diskutiert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Wortschatzförderung, sprachsensibler Unterricht, Erdkundeunterricht, Deutsch als Zweitsprache, empirische Forschung, Lehrkräftekompetenzen, Sprachregister, Wortschatzerwerb, mentales Lexikon, Sprachförderung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wortschatzförderung im Erdkundeunterricht notwendig?
Studien wie DESI zeigen, dass viele Schüler den notwendigen Grundwortschatz nicht beherrschen, was besonders Schüler mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) betrifft.
Was versteht man unter einem "sprachsensiblen Fachunterricht"?
Es ist ein Unterricht, der fachliche Inhalte vermittelt und gleichzeitig die sprachlichen Hürden der Fachsprache erkennt und gezielt abbaut.
Was ist das "mentale Lexikon"?
Das mentale Lexikon beschreibt die Art und Weise, wie Wörter im menschlichen Gehirn gespeichert, vernetzt und abgerufen werden.
Welche Kompetenzen benötigen Fachlehrkräfte für die Sprachförderung?
Lehrkräfte müssen in der Lage sein, die sprachlichen Anforderungen ihrer Fachtexte zu analysieren und Methoden zur Wortschatzerweiterung systematisch anzuwenden.
Wie unterscheiden sich Erst- und Zweitspracherwerb beim Wortschatz?
Die Arbeit beleuchtet unterschiedliche Erwerbstypen und zeigt auf, dass der Zweitspracherwerb oft gezieltere didaktische Unterstützung im Fachregister benötigt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Wie gelingt Wortschatzförderung im Unterricht? Sprachsensibler Erdkundeunterricht für ein- und mehrsprachige Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512867