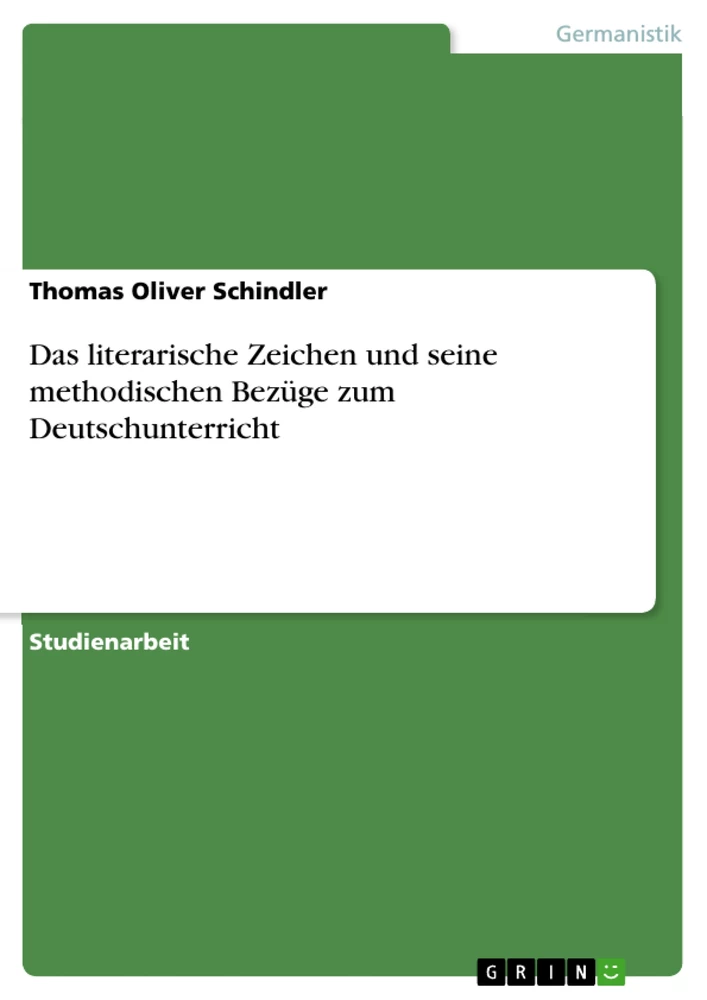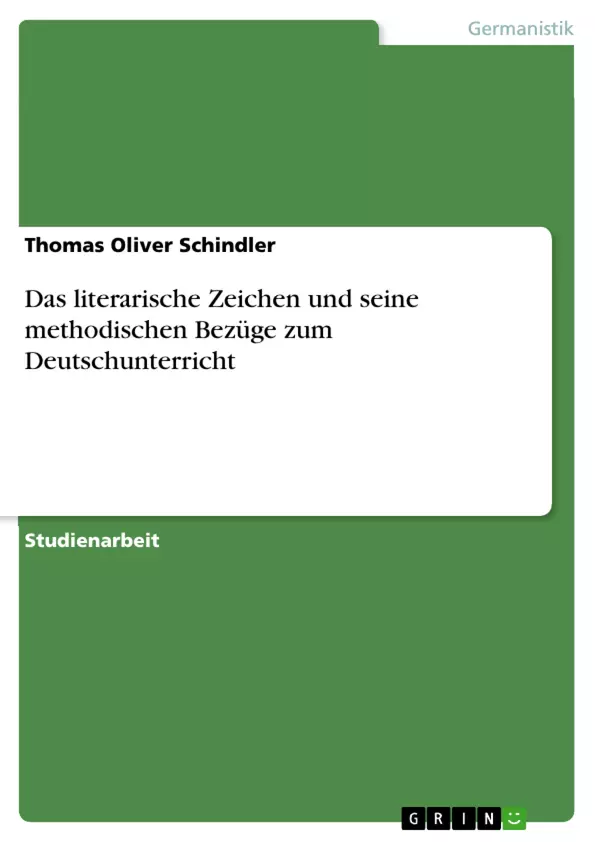Zeichen und ihre Beziehung zu ihren Inhalten werden kulturell durch Enkulturation, Sozialisation, Erziehung und Bildung vermittelt. Gemeinsame Sprache bedeutet intersubjektive Verständlichkeit der Zeichenbeziehungen, d.h. ihrer Bedeutungen. Wie steht es jedoch um das Verhältnis von natürlicher Sprache zu Literatur? Was ist der Unterschied zwischen alltäglicher Sprache und Literatur? Ab wann fällt ein Zeichen nicht mehr nur in den Fachbereich der Semiotik, sondern in den der Literatursemiotik? Kurz: Was ist Literatur? Neben dieses grundsätzliche Problem tritt ein zweites grundsätzliches: Literatur besteht ohne Zweifel aus Sprache und Sprache besteht aus Zeichen. Ab wann ist nun ein Zeichen ein literarisches Zeichen bzw. was fungiert in und an literarischen Werken als Zeichen? „Da alles, was ‚bedeutet’, Zeichen sein kann, und da alle Einheiten der Sprache und die Regeln und Konventionen ihrer Verbindung Bedeutung haben, scheint der Umfang des Zeicheninventars, mit dem die Literatur operiert, unbeschreibbar zu sein". Diesem augenscheinlichen Dilemma des unermesslichen Bedeutungsreichtums literarischer Werke zum Trotz, befindet sich die Literaturwissenschaft und im speziellen die Literatursemiotik aber offensichtlich nicht in einer Aporie. Ziel der vorliegenden Arbeit soll es darum einerseits sein mögliche Antworten für die erläuterte Problematik zu geben, d.h. Literatur im Bereich der Semiotik zu definieren und das literarische Zeichen von der übrigen Zeichenfülle zu scheiden. Dies möchte der theoretische Teil der Arbeit neben einem knappen allgemeinen Überblick zur Semiotik leisten. Andererseits referiert diese Arbeit über eine von der Forschung bereitgestellte Möglichkeit Semiotik und Literatursemiotik als Methode vermitteln, mit welcher Sprache und damit vorrangig literarische Werke als Zusammensetzung von Zeichen intersubjektiv erkannt und verstanden werden können. Vor allem im Bezug auf den Deutsch- bzw. im speziellen den Literaturunterricht soll anhand eines konkreten Beispiels eine mögliche Methodik zum Zugang zum bzw. Verständnis für das literarische Zeichen in der Unterrichtspraxis vorgestellt werden, welche bereits im universitären Seminar an Studenten erprobt wurde. Diese beiden Punkte möchte der praktische Teil dieser Abhandlung bearbeitet wissen. Die wesentlichen Ziele sind also noch einmal kurz zusammengefasst: Begriffsdifferenzierung, praxisorientierte Methodik und Exempel.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Vorwort
- 1.2. Die Problematik der Literatursemiotik
- 1.3. Ziel und Vorgehensweise der Arbeit
- 2. Theoretischer Teil: Semiotik und Literatursemiotik
- 2.1. Definition von Zeichen
- 2.2. Literatursemiotik und das literarische Zeichen
- 3. Praktischer Teil: Literatursemiotik im Deutschunterricht
- 3.1. Eine wissenschaftliche Methodik des Zeichenerkennens nach Dieter Janik
- 3.2. Kritik zu Janiks Methodik und eigene Vorschläge zum Literaturunterricht
- 3.3. Ein literatursemiotischer Unterrichtsversuch
- 3.3.1. Didaktische und methodische Vorüberlegungen
- 3.3.2. Der Unterrichtsinhalt: literarische Zeichen in Theodor Fontanes „Effi Briest“
- 3.3.3. Konkrete Ausführung
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik der Definition des literarischen Zeichens und dessen methodischen Bezug zum Deutschunterricht. Sie will einerseits das literarische Zeichen im Kontext der Semiotik definieren und von anderen Zeichen abgrenzen, andererseits eine methodische Herangehensweise an die Analyse literarischer Texte im Unterricht vorstellen.
- Definition des literarischen Zeichens im Rahmen der Semiotik
- Unterscheidung zwischen alltäglicher Sprache und Literatur
- Methodische Ansätze zur Analyse literarischer Zeichen im Deutschunterricht
- Konkrete Anwendung einer Methode am Beispiel von Theodor Fontanes „Effi Briest“
- Didaktische und methodische Überlegungen zum Literaturunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Henri Poincaré über den relativen Charakter von Wissen und Erkenntnis. Sie führt in die Problematik der Literatursemiotik ein, indem sie die Frage nach der Definition von Literatur und dem literarischen Zeichen stellt. Der Unterschied zwischen alltäglicher Sprache und literarischer Sprache wird thematisiert, ebenso die Schwierigkeit, den Umfang des „Zeicheninventars“ literarischer Werke zu bestimmen. Das Ziel der Arbeit wird als die Klärung dieser Problematik und die Präsentation einer methodischen Herangehensweise an die Analyse literarischer Zeichen im Deutschunterricht formuliert. Die Arbeit soll eine begriffliche Abgrenzung liefern und eine praxisorientierte Methodik mit Beispiel vorstellen.
2. Theoretischer Teil: Semiotik und Literatursemiotik: Dieser Teil bietet einen Überblick über die Semiotik und ihre Anwendung auf die Literatur. Er beginnt mit der Darstellung der Entwicklung der Semiotik durch Saussure und Peirce, wobei der Unterschied in deren Fokus auf Sprache bzw. den Leser hervorgehoben wird. Es folgt eine Definition des Zeichens nach Peirce und die Erläuterung der Peirceschen Trichotomie von Ikon, Index und Symbol, um die verschiedenen Arten von Zeichenbeziehungen zu verdeutlichen. Dieser Teil legt das theoretische Fundament für die methodische Auseinandersetzung im praktischen Teil.
3. Praktischer Teil: Literatursemiotik im Deutschunterricht: Der praktische Teil präsentiert eine wissenschaftliche Methodik des Zeichenerkennens nach Dieter Janik und diskutiert deren Anwendung im Literaturunterricht. Er beinhaltet eine Kritik an Janiks Methodik und eigene Vorschläge für den Unterricht. Der Schwerpunkt liegt auf einem konkreten Unterrichtsversuch, der didaktische und methodische Vorüberlegungen, den Unterrichtsinhalt (am Beispiel von Fontanes „Effi Briest“) und die konkrete Umsetzung beschreibt. Dieser Teil verbindet Theorie und Praxis, indem er eine konkrete methodische Herangehensweise im Unterricht demonstriert.
Schlüsselwörter
Literatursemiotik, literarisches Zeichen, Semiotik, Deutschunterricht, Methodik, Zeichenbegriff, Theodor Fontane, Effi Briest, Interpretation, Intertextualität, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Literatursemiotik im Deutschunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik der Definition des literarischen Zeichens und dessen methodischen Bezugs zum Deutschunterricht. Sie untersucht einerseits die Definition des literarischen Zeichens im Kontext der Semiotik und dessen Abgrenzung von anderen Zeichen, andererseits präsentiert sie eine methodische Herangehensweise an die Analyse literarischer Texte im Unterricht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition des literarischen Zeichens im Rahmen der Semiotik, Unterscheidung zwischen alltäglicher Sprache und Literatur, methodische Ansätze zur Analyse literarischer Zeichen im Deutschunterricht, konkrete Anwendung einer Methode am Beispiel von Theodor Fontanes „Effi Briest“, sowie didaktische und methodische Überlegungen zum Literaturunterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil (Semiotik und Literatursemiotik), einen praktischen Teil (Literatursemiotik im Deutschunterricht) und eine Zusammenfassung. Der theoretische Teil behandelt die Definition von Zeichen und die Literatursemiotik, während der praktische Teil eine wissenschaftliche Methodik des Zeichenerkennens nach Dieter Janik vorstellt, kritisiert und eigene Vorschläge für den Unterricht unterbreitet. Ein konkreter Unterrichtsversuch mit Fontanes „Effi Briest“ wird detailliert beschrieben.
Welche Methodik wird im praktischen Teil vorgestellt?
Der praktische Teil präsentiert und diskutiert eine wissenschaftliche Methodik des Zeichenerkennens nach Dieter Janik für den Literaturunterricht. Die Arbeit enthält neben einer Kritik an Janiks Methodik auch eigene Vorschläge zur Verbesserung und Anwendung im Unterricht. Ein konkreter Unterrichtsversuch mit Theodor Fontanes „Effi Briest“ illustriert die praktische Anwendung.
Welches Beispielwerk wird im praktischen Teil analysiert?
Im praktischen Teil wird Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“ als Beispiel für die Anwendung der vorgestellten Methodik der Literatursemiotik im Unterricht verwendet. Der Fokus liegt auf der Analyse literarischer Zeichen in diesem Werk.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit beschreiben, sind: Literatursemiotik, literarisches Zeichen, Semiotik, Deutschunterricht, Methodik, Zeichenbegriff, Theodor Fontane, Effi Briest, Interpretation, Intertextualität, Kommunikation.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf semiotische Theorien, insbesondere auf die Arbeiten von Saussure und Peirce. Der Unterschied in deren Fokus auf Sprache bzw. den Leser wird hervorgehoben. Die Peircesche Trichotomie von Ikon, Index und Symbol wird zur Verdeutlichung verschiedener Arten von Zeichenbeziehungen verwendet.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich mit Literatursemiotik, Deutschunterricht und der didaktischen Anwendung semiotischer Theorien beschäftigen. Sie ist insbesondere für Lehramtsstudierende und Deutschlehrer relevant.
- Citation du texte
- Thomas Oliver Schindler (Auteur), 2005, Das literarische Zeichen und seine methodischen Bezüge zum Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51292