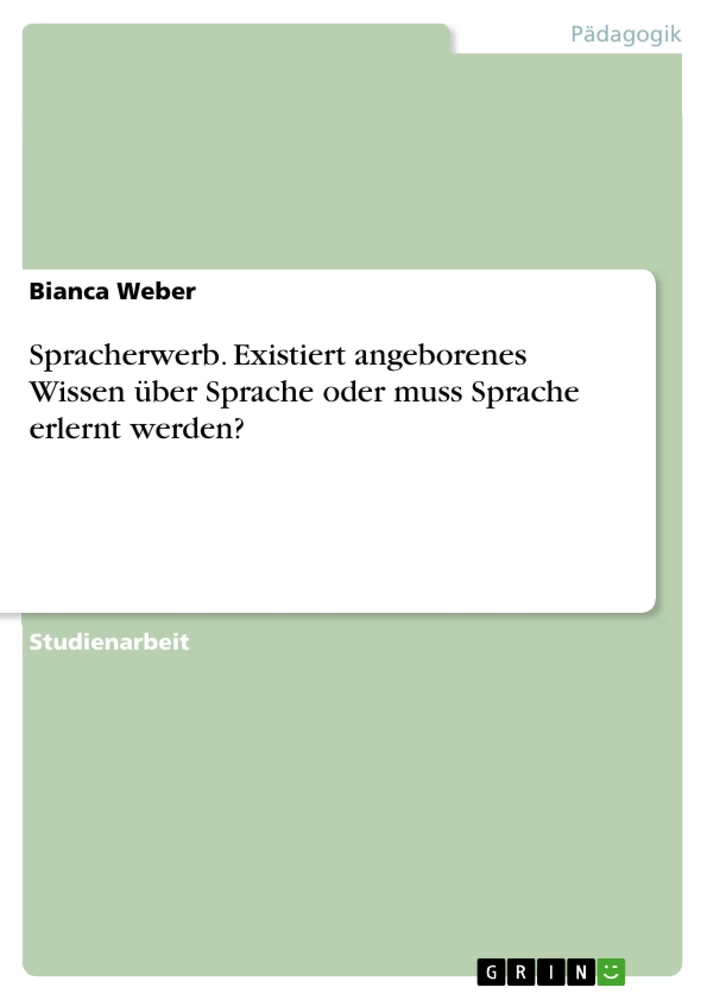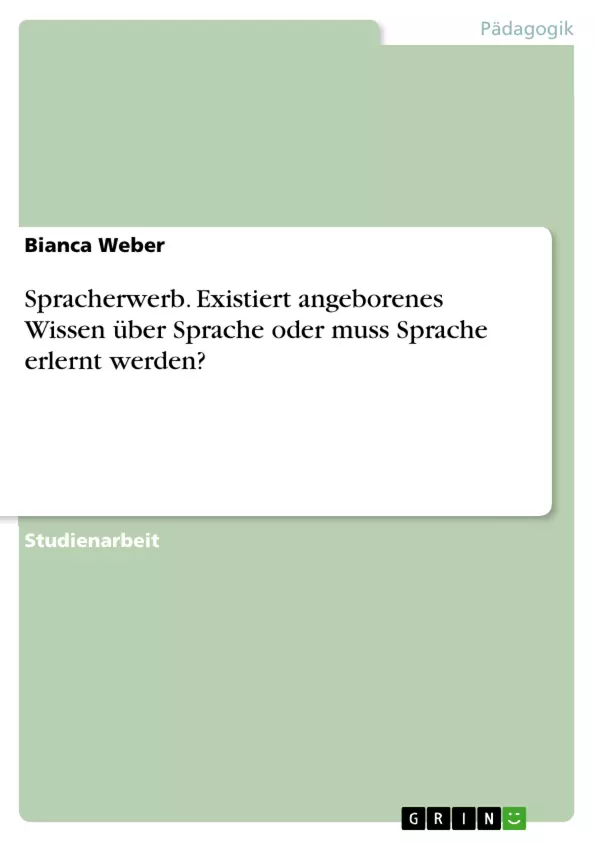Aufgrund von Äußerungen, die ich bei meinem Neffen, meiner Nichte und anderen Kindern wahrnehme, frage ich mich, ob und wenn, inwieweit Eltern und Mitmenschen den Spracherwerb von Kindern unterstützen und positiv beeinflussen können. Diesen Fragen möchte ich mithilfe der in dem Seminar „Spracherwerb“ im Sommersemester 2012 behandelten Theorien des Spracherwerbs nachgehen. Dabei werde ich zuerst den Begriff Spracherwerb näher erläutern, um im Folgenden die Theorie des Nativismus und des Behaviorismus zu erklären. Anschließend gehe ich analytisch darauf ein, welche existierenden Methoden des Spracherwerbs für die jeweilige Theorie sprechen. Basierend auf diesem Wissen analysiere ich Yannicks Äußerungen und zeige auf, welche Methode des Spracherwerbs stattgefunden haben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Momentaner Forschungsstand
- Eigenschaften des Erstspracherwerbs
- Theorien des Erstspracherwerbs
- Ansicht der Nativisten
- Ansicht der Behavioristen
- Mögliche Methoden für den Erstspracherwerb
- Imitation
- Expansion
- Reinforcement
- Trial-and-Error-Methode
- Korrigierendes Feedback
- Erörterung der Aussagen von Yannick
- Fazit
- Anhang
- Bildung des Partizips II im Deutschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Spracherwerb anhand der sprachlichen Äußerungen eines fünfjährigen Kindes (Yannick). Die zentrale Frage ist, ob angeborenes Wissen über Sprache existiert oder ob Sprache vollständig erlernt werden muss. Die Arbeit analysiert Yannicks grammatikalisch inkorrekte Formen und untersucht, welche Theorien des Spracherwerbs – Nativismus und Behaviorismus – diese Phänomene erklären können.
- Analyse grammatikalisch inkorrekter Sprachformen bei Kindern
- Vergleich der nativistischen und behavioristischen Theorien des Spracherwerbs
- Untersuchung der Rolle von Umweltfaktoren im Spracherwerbsprozess
- Bewertung verschiedener Methoden des Spracherwerbs (Imitation, Expansion, Reinforcement etc.)
- Anwendung der Theorien auf ein konkretes Beispiel (Yannicks Sprachentwicklung)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Ausgangspunkt der Arbeit: die grammatikalisch inkorrekten Äußerungen des Autors Neffen Yannick (z.B. "guter" statt "besser"). Diese Beobachtung wirft Fragen nach den Mechanismen des Spracherwerbs auf und leitet die Forschungsfrage nach angeborenem Sprachwissen oder reinem Lernen ein. Die Autorin skizziert ihren Forschungsansatz, der die Theorien des Nativismus und des Behaviorismus einbezieht und die Analyse von Yannicks Äußerungen umfasst. Die Einleitung dient als klare und prägnante Einführung in die Thematik und die Forschungsfrage der Arbeit.
Momentaner Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Spracherwerb in der Linguistik. Es werden die wichtigsten Theorien und Vertreter genannt, insbesondere der Behaviorismus (Watson, Skinner) und der Nativismus (Chomsky). Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung verschiedener Ansätze und deren Bedeutung für die weitere Untersuchung. Das Kapitel schafft ein fundiertes Verständnis des wissenschaftlichen Kontextes der Arbeit.
Eigenschaften des Erstspracherwerbs: Dieses Kapitel beschreibt die charakteristischen Merkmale des Erstspracherwerbs. Es betont die Leichtigkeit, Schnelligkeit und die Einheitlichkeit des Prozesses, unabhängig von kulturellen oder sozialen Faktoren. Die Fähigkeit gesunder Kinder, komplexe Sprachsysteme mit minimalen Fehlern zu erwerben, wird hervorgehoben. Der Punkt, dass kein explizites Sprachtraining notwendig ist, unterstreicht die natürliche Fähigkeit des Menschen, Sprache zu erlernen. Der natürliche Spracherwerbsprozess wird hier umfassend und prägnant zusammengefasst.
Theorien des Erstspracherwerbs: Dieses Kapitel stellt die beiden zentralen Theorien des Spracherwerbs gegenüber: den Nativismus und den Behaviorismus. Der Nativismus, vertreten durch Chomsky, postuliert ein angeborenes, universelles Sprachwissen (Universalgrammatik) und einen angeborenen Spracherwerbsmechanismus (LAD). Der Behaviorismus hingegen sieht Sprache als gelerntes Verhalten an, das durch Imitation und Verstärkung erworben wird. Die unterschiedlichen Annahmen beider Theorien werden detailliert erläutert und bilden die Grundlage für die spätere Analyse von Yannicks Äußerungen.
Mögliche Methoden für den Erstspracherwerb: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Methoden, durch die Kinder Sprache erwerben können, wie Imitation, Expansion, Reinforcement, Trial-and-Error und korrigierendes Feedback. Es analysiert die Anwendung dieser Methoden im Kontext der nativistischen und behavioristischen Theorien und legt die Basis für die anschließende Fallstudie von Yannicks Spracherwerb. Die Beschreibung der Methoden ist ausführlich und verständlich, jede Methode wird im Detail erklärt.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Erstspracherwerb, Nativismus, Behaviorismus, Universalgrammatik, Language Acquisition Device (LAD), Imitation, Expansion, Reinforcement, morphologische Entwicklung, kindliche Sprachproduktion, fehlerhafte Sprachformen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Analyse des Erstspracherwerbs anhand der Sprachentwicklung von Yannick
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Erstspracherwerb anhand der Sprachäußerungen eines fünfjährigen Kindes namens Yannick. Im Fokus steht die Frage, ob angeborenes Wissen über Sprache existiert oder ob Sprache vollständig erlernt wird. Die Analyse konzentriert sich auf grammatikalisch inkorrekte Sprachformen Yannicks und untersucht, inwiefern die Theorien des Nativismus und des Behaviorismus diese erklären können.
Welche Theorien des Spracherwerbs werden untersucht?
Die Arbeit vergleicht die nativistische Theorie (Chomsky) mit der behavioristischen Theorie (Watson, Skinner). Der Nativismus postuliert ein angeborenes Sprachwissen (Universalgrammatik) und einen angeborenen Spracherwerbsmechanismus (LAD). Der Behaviorismus hingegen betrachtet Sprache als gelerntes Verhalten durch Imitation und Verstärkung.
Welche Methoden des Spracherwerbs werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Methoden des Spracherwerbs, darunter Imitation, Expansion, Reinforcement, die Trial-and-Error-Methode und korrigierendes Feedback. Diese Methoden werden im Kontext der nativistischen und behavioristischen Theorien analysiert und auf Yannicks Sprachentwicklung angewendet.
Wie wird Yannicks Sprachentwicklung analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf grammatikalisch inkorrekte Sprachformen bei Yannick (z.B. "guter" statt "besser"). Diese fehlerhaften Äußerungen dienen als Grundlage, um die Anwendbarkeit der nativistischen und behavioristischen Theorien zu überprüfen und die Rolle von Umweltfaktoren im Spracherwerbsprozess zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Momentaner Forschungsstand, Eigenschaften des Erstspracherwerbs, Theorien des Erstspracherwerbs (Nativismus und Behaviorismus), Mögliche Methoden für den Erstspracherwerb, Erörterung der Aussagen von Yannick, Fazit und Anhang (Bildung des Partizips II im Deutschen).
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob angeborenes Wissen über Sprache existiert oder ob Sprache vollständig erlernt werden muss. Diese Frage wird anhand der Analyse von Yannicks Sprachentwicklung und der Anwendung verschiedener Spracherwerbstheorien beantwortet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Spracherwerb, Erstspracherwerb, Nativismus, Behaviorismus, Universalgrammatik, Language Acquisition Device (LAD), Imitation, Expansion, Reinforcement, morphologische Entwicklung, kindliche Sprachproduktion, fehlerhafte Sprachformen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit dem Thema Erstspracherwerb und den dazugehörigen Theorien auseinandersetzt. Sie ist besonders relevant für Studierende der Linguistik, Psychologie und Sprachwissenschaften.
- Quote paper
- Bianca Weber (Author), 2012, Spracherwerb. Existiert angeborenes Wissen über Sprache oder muss Sprache erlernt werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512940