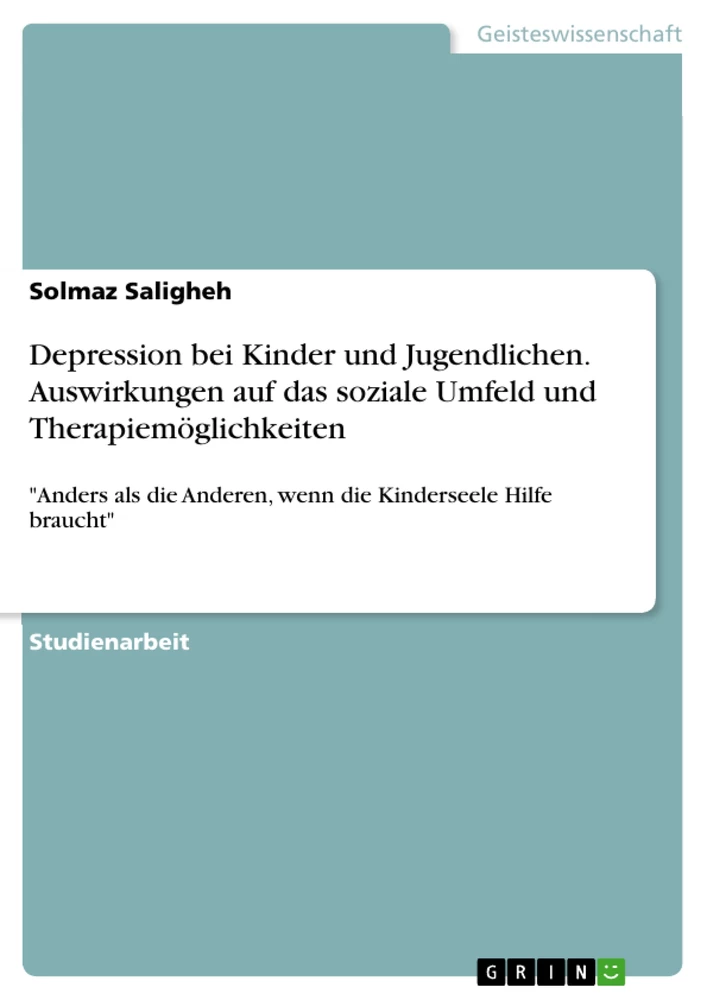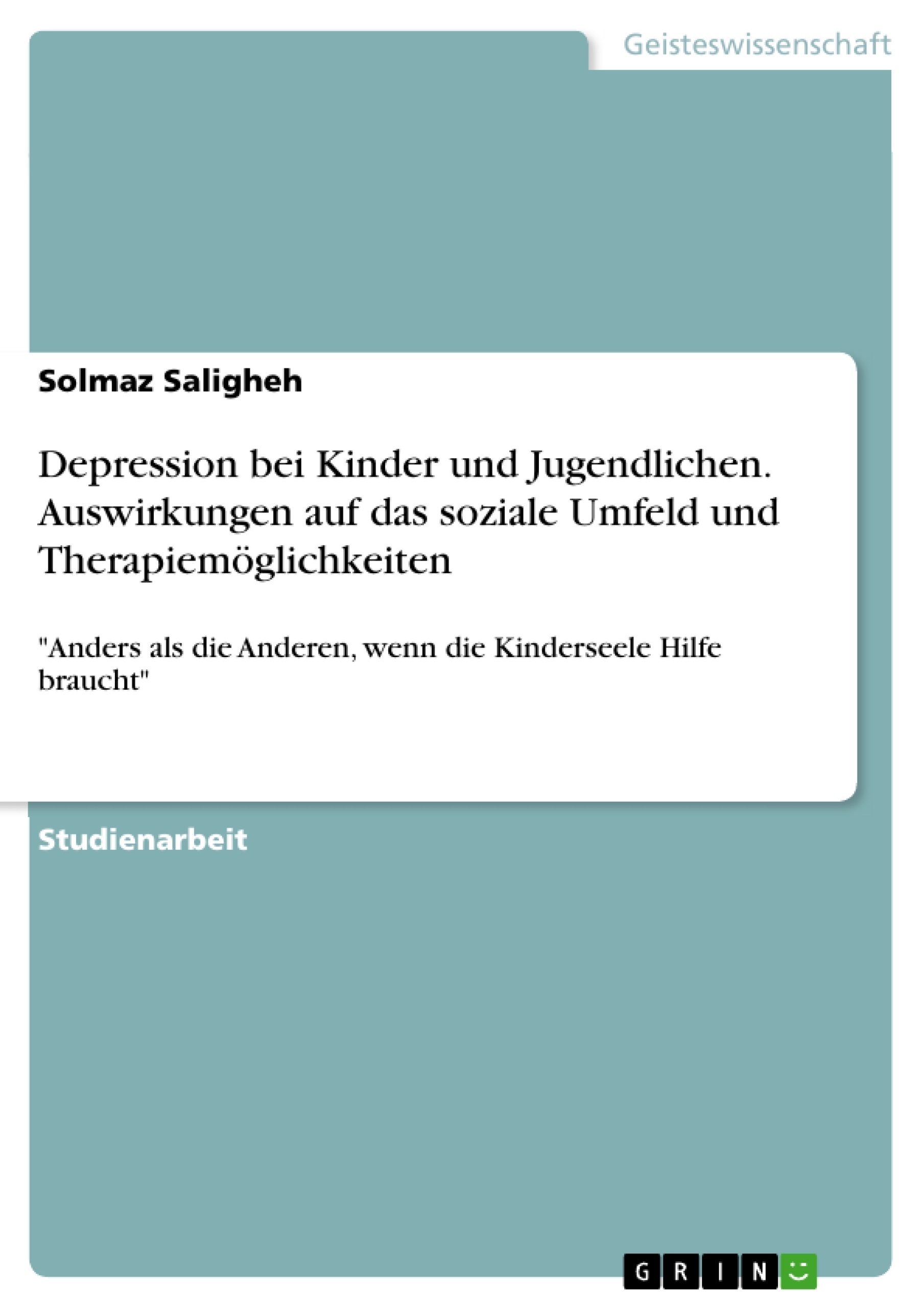Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema "Depressionen bei Kindern und Jugendlichen - Anders als die Anderen, wenn die Kinderseele Hilfe braucht". Sie beginnt mit der Definition der Depression. Was ist eine Depression und woran erkennt man diese? Hier werden auch die Symptome einer Depression aufgezeigt. Anschließend wird dargestellt, wie sich Depressionen auf das Familienleben und das soziale Umfeld auswirken. Wie geht es Eltern depressiver Kinder? Danach widmet sich die Autorin den personalen und sozialen Ressourcen der Angehörigen. Der wichtigste Punkt in Bezug auf die Soziale Arbeit sind die sozialpädagogischen Hilfen und Methoden. Die Autorin beschäftigt sich mit der kognitiven Verhaltenstherapie, welche die am meisten angewandte Therapie bei depressiven Kindern und Jugendlichen ist, und mit Selbsthilfegruppen. Abschließend folgt ein Fazit.
Depression kann jeden Menschen treffen - ob jung oder alt, Frau oder Mann, selbst Kinder und Jugendliche können depressiv werden. Leichte Verstimmungen bis hin zu schweren depressiven Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Aktuell erkranken etwa 3-10 Prozent aller Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren an einer Depression. In der Altersgruppe von 15-20 Jahren ist sie nach Störungen im Substanzkonsum die zweithäufigste Ursache für einen stationären Aufenthalt. Bei Kindern und Jugendlichen ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass die Depression mit weiteren psychischen Erkrankungen, wie Angststörungen und ADHS einhergeht. Während sich in der Kindheit keine Geschlechterunterschiede aufzeigen lassen, sind im Jugendalter Mädchen deutlich häufiger betroffen als Jungen.
Depressionsforschung bei Kindern und Jugendlichen ist erst circa 35 Jahre alt. Wie viele andere Verhaltensstörung wird dieses Gebiet erst seit den späten 70ern und den frühen 80ern untersucht und diagnostiziert. In der Literatur, die vor dieser Zeit erschien, waren Depressionen bei Kindern und Jugendlichen nicht existent oder durch Symptome beschrieben, die nicht in das klassische Bild einer Depression bei Erwachsenen passten beziehungsweise dazugehörten. Es gab nur sehr wenige Versuche, depressive Ausdrucksformen bei Kindern und Jugendlichen zu beschreiben. Heute wird davon ausgegangen, dass bereits Kinder im Alter von 5 Jahren elementare Merkmale von Depressionen aufweisen können; jene, die auch bei Erwachsenen auftreten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist eine Depression?
- Woran erkennt man eine Depression bei Kindern und Jugendlichen?
- Symptome einer Depression bei Kindern und Jugendlichen
- Die klinischen Störungsbilder
- Auswirkung auf die Gesellschaft
- Auswirkungen auf das Familienleben
- Auswirkungen auf das soziale Umfeld
- Hilfelosigkeit und Ressourcen der Angehörigen
- Selbstverantwortungen der Angehörigen
- personale und soziale Ressourcen
- Sozialpädagogische Hilfen und Methoden
- Spieltherapien
- Verhaltenstherapien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Sie soll ein tieferes Verständnis für die Ursachen, Symptome und Auswirkungen dieser psychischen Störung vermitteln, und beleuchtet gleichzeitig die Hilfsmöglichkeiten für betroffene Kinder und deren Familien.
- Definition und Merkmale von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
- Die Auswirkungen von Depressionen auf das Familienleben und das soziale Umfeld
- Die Hilfelosigkeit und Ressourcen der Angehörigen
- Sozialpädagogische Hilfen und Methoden zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Depressionen
- Die Bedeutung frühzeitiger Erkennung und Intervention bei depressiven Symptomen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz der Thematik Depression bei Kindern und Jugendlichen. Anschließend wird der Begriff „Depression“ definiert und es wird erläutert, wie man eine Depression bei Kindern und Jugendlichen erkennt. Die Symptome einer Depression werden dabei näher beschrieben, ebenso wie die klinischen Störungsbilder, die im Zusammenhang mit Depressionen auftreten können.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Auswirkungen von Depressionen auf das Familienleben und das soziale Umfeld betrachtet. Es wird untersucht, wie Eltern mit der Situation depressiver Kinder umgehen und welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen.
Der Fokus der Arbeit liegt anschließend auf den sozialpädagogischen Hilfen und Methoden, die für Kinder und Jugendliche mit Depressionen eingesetzt werden können. Die kognitiven Verhaltenstherapien, die als am meisten angewandte Therapieform bei depressiven Kindern und Jugendlichen gelten, werden vorgestellt und ihre Wirksamkeit erläutert.
Schlüsselwörter
Depression, Kinder, Jugendliche, Symptome, Familienleben, Soziales Umfeld, Hilfelosigkeit, Ressourcen, Sozialpädagogische Hilfen, Verhaltenstherapie, Spieltherapie.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Prävalenz von Depressionen bei Jugendlichen?
Aktuell erkranken etwa 3 bis 10 Prozent aller Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren an einer Depression.
Gibt es Geschlechterunterschiede bei depressiven Erkrankungen im Kindesalter?
Während im Kindesalter kaum Unterschiede bestehen, sind im Jugendalter Mädchen deutlich häufiger betroffen als Jungen.
Welche Therapieform wird in der Arbeit besonders hervorgehoben?
Die kognitive Verhaltenstherapie wird als die am häufigsten angewandte und wirksamste Therapieform bei Kindern und Jugendlichen beschrieben.
Wie wirkt sich eine Depression auf das soziale Umfeld aus?
Die Erkrankung belastet das Familienleben stark und führt oft zu Hilflosigkeit bei den Angehörigen, weshalb auch deren Ressourcen und Selbsthilfegruppen thematisiert werden.
Können bereits kleine Kinder Depressionen bekommen?
Ja, die Forschung geht davon aus, dass bereits Kinder ab einem Alter von 5 Jahren elementare Merkmale einer Depression aufweisen können.
- Quote paper
- Solmaz Saligheh (Author), 2017, Depression bei Kinder und Jugendlichen. Auswirkungen auf das soziale Umfeld und Therapiemöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513004