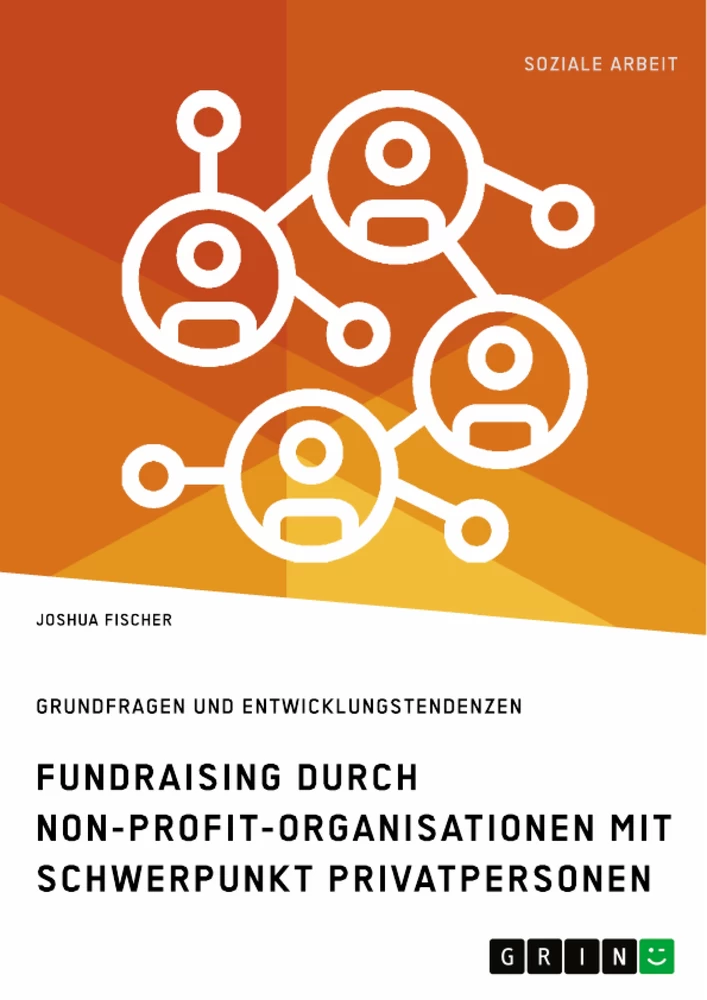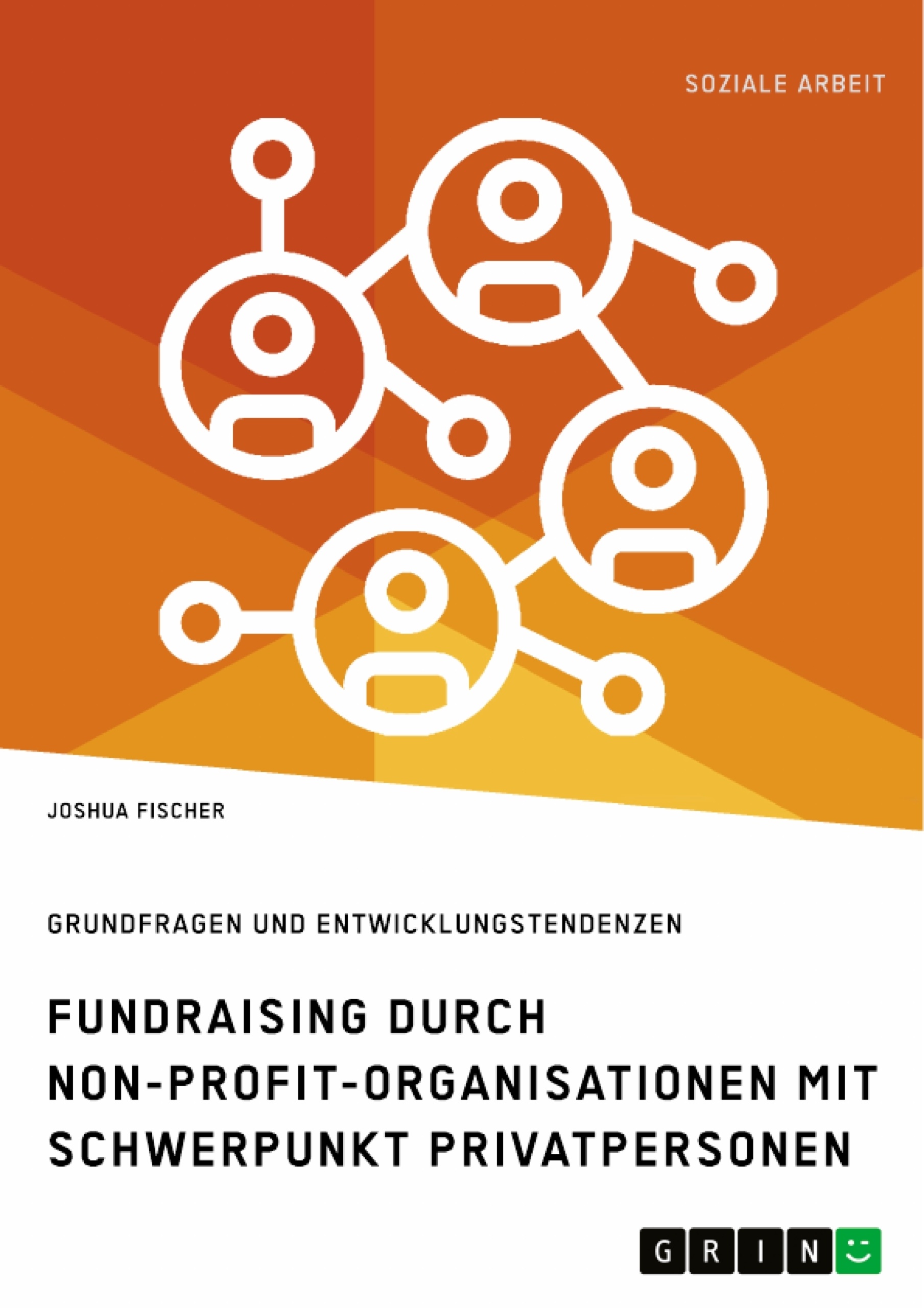Schon lange vor unserer Zeit wurden bedürftige Menschen in ihrem Leben und ihrer Existenz unterstützt. Die Art und Formen dieser Hilfen haben sich im Lauf der Jahrhunderte ausdifferenziert und verändert. In Deutschland gewann die soziale Marktwirtschaft gerade im Non-Profit-Bereich zur Zeit des 19. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung und Zulauf. Die institutionelle Festigung und Ausweitung der Unterstützung von steuerbegünstigten Organisationen, sogenannten Non-Profit-Organisationen, ist im Sozialstaat Deutschland schon lange nichts Neues mehr.
Seit der Jahrtausendwende jedoch befindet sich der Non-Profit-Sektor in einer Art Umbruchssituation: Leere öffentliche Kassen, überlastete Sozialversicherungen sowie ein steigender Wettbewerb innerhalb des Sektors und gesellschaftliche Einflussfaktoren führen vermehrt zu Problematiken; vor allem in der Ressourcenbeschaffung. Dass sich wirtschaftliche und soziale Interessen hierbei vermehrt überschneiden, ist ebenso evident wie die Tatsache, dass jene Umbruchssituation einen Einfluss auf unser alltägliches Leben und die zukünftige Soziale Arbeit haben wird.
Was ist überhaupt eine Non-Profit-Organisation und welche Funktion erfüllt diese im deutschen Sozialsystem? Was steckt hinter dem Wort Fundraising und welche Bedeutung hat dieses für Non-Profit-Organisation? Was sind hierbei Privatpersonen und woran lassen sich diese charakterisieren? Was oder Wer sind Spender und welche Motive stecken hinter der Spende von Privatpersonen? Welche Motivation beziehungsweise welcher Anspruch steckt in der Handlung von Non-Profit-Organisationen, Fundraising zu betreiben? Gibt es im Fundraisingprozess rechtliche, ethische oder moralische Vorgaben bzw. Grundfragen, die zu beachten oder zu stellen sind? Inwieweit sind Entwicklungstendenzen für die kommenden Jahre abzusehen und wie wird sich Soziale Arbeit an diesen Wandel anpassen müssen? Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, sich genau mit den genannten Fragen zu beschäftigen und sie im optimalen Fall umfassend zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Non-Profit-Organisationen
- 2.1 Historie und Entwicklung
- 2.2 Non-Profit-Organisation – Ein Teil der sozialen Marktwirtschaft
- 2.3 Klassische Finanzierungsformen
- 3. Fundraising
- 3.1 Historie und Entwicklung
- 3.2 Sozialmanagement – Ein Aufgabenfeld der Sozialen Arbeit
- 3.3 Fundraising – Ein Aufgabenfeld des Sozialmanagements
- 3.4 Instrumente des Fundraising
- 4. Fundraising bei Privatpersonen
- 4.1 Privatpersonen: Wer oder was sind Sie?
- 4.2 Die Spenderpyramide – Ein fundiertes Marketing
- 5. Zwischenergebnis
- 6. Grundfragen des Fundraising
- 6.1 Motive der Spender
- 6.2 Motive der Non-Profit-Organisationen
- 6.3 Moralische, ethische und rechtliche Grundsätze
- 6.3.1 Darstellung und Informationsgabe
- 6.3.2 Bereitschaft der Spender und aktiver Aufruf
- 6.3.3 Spendengabe und Transaktion
- 6.3.4 Bindung an die Organisation
- 6.3.5 Selbstbestimmung und Transparenz
- 6.4 Professionalisierung – ein zentraler Erfolgsfaktor im Fundraising
- 6.5 Einschätzung und Schlussfolgerung
- 7. Entwicklungstendenzen des Fundraising in der Zukunft
- 7.1 Gesellschaftliche Veränderungen
- 7.2 Der Spendenzweck und -anstoß
- 7.3 Das Spendeverhalten und -volumen
- 7.4 Online-Fundraising und Crowdfunding
- 7.5 Einschätzung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Fundraising von Non-Profit-Organisationen mit Schwerpunkt auf Privatpersonen in Deutschland. Die Arbeit beleuchtet die historischen Entwicklungen, aktuelle Herausforderungen und zukünftige Trends im Fundraising. Die Zielsetzung besteht darin, die Grundfragen der professionellen Mittelbeschaffung zu analysieren und zu beantworten.
- Historische Entwicklung des Fundraising und der Non-Profit-Organisationen
- Finanzierungsmodelle von Non-Profit-Organisationen und deren Herausforderungen
- Motive von Spendern und Non-Profit-Organisationen im Fundraising
- Ethische, moralische und rechtliche Aspekte des Fundraising
- Zukünftige Entwicklungstendenzen im Fundraising, insbesondere im digitalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Fundraising bei Non-Profit-Organisationen ein und skizziert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Unterstützung Bedürftiger und die zunehmende Bedeutung des Fundraising im Kontext leerer öffentlicher Kassen und steigenden Wettbewerbs im Non-Profit-Sektor. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Darstellung von Fundraising, Non-Profit-Organisationen und Privatpersonen; genaue Betrachtung der Grundfragen des Fundraising inklusive ethischer, moralischer und rechtlicher Aspekte; und schließlich die Betrachtung zukünftiger Entwicklungstendenzen.
2. Non-Profit-Organisationen: Dieses Kapitel definiert und kategorisiert Non-Profit-Organisationen, beleuchtet ihre historische Entwicklung vom Mittelalter bis zur Gegenwart und ordnet sie in die soziale Marktwirtschaft ein. Es werden die klassischen Finanzierungsformen – öffentliche Mittel, private Spenden, Sponsoring und Mitgliedsbeiträge – diskutiert und deren Bedeutung im Kontext zunehmender Konkurrenz analysiert. Die Arbeit hebt hervor, dass Non-Profit-Organisationen einen wachsenden Teil der sozialen Marktwirtschaft bilden und immer mehr um Ressourcen konkurrieren.
3. Fundraising: Das Kapitel beschreibt Fundraising als systematische und professionelle Mittelbeschaffung. Es wird die historische Entwicklung, die Einordnung in das Sozialmanagement und die verschiedenen Instrumente des Fundraising (Post, Telefon, Online, Medien, persönlich) detailliert erläutert. Die Bedeutung der Beziehungspflege zwischen Organisation und Spender und der ethischen Verantwortung der Fundraiser wird hervorgehoben. Es zeigt die verschiedenen Ansätze und Möglichkeiten der Mittelbeschaffung auf.
4. Fundraising bei Privatpersonen: Hier wird der Fokus auf die Gewinnung von Spenden durch Privatpersonen gelegt. Es erfolgt eine Abgrenzung zu anderen Ressourcengebern (öffentliche Hand, Unternehmen). Die Spenderpyramide wird als Modell zur Kategorisierung von Spendern nach ihrem Engagement und Spendenvolumen vorgestellt. Der Kapitel beschreibt die Bedeutung der Beziehungspflege ("Relationship Fundraising") für den langfristigen Erfolg.
5. Zwischenergebnis: Dieses Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse der ersten vier Kapitel zusammen. Es betont die zunehmende Bedeutung des Fundraising für Non-Profit-Organisationen aufgrund schwindender öffentlicher Mittel und steigenden Wettbewerbs. Die Vielfältigkeit der Fundraising-Instrumente und die Notwendigkeit einer professionellen und ethisch verantwortungsvollen Vorgehensweise werden nochmals hervorgehoben. Es leitet über zu den folgenden Kapiteln, in denen die Grundfragen des Fundraising tiefergehend untersucht werden.
6. Grundfragen des Fundraising: Dieser Abschnitt untersucht die Motive von Spendern und Non-Profit-Organisationen im Detail. Er beleuchtet die ethischen, moralischen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Fundraisingprozesses, von der Informationsgabe über den Spendenaufruf bis hin zur Beziehungspflege. Die Bedeutung der Transparenz und Selbstbestimmung für Spender wird hervorgehoben. Das Kapitel diskutiert die Bedeutung der Professionalisierung des Fundraisings als zentralen Erfolgsfaktor.
7. Entwicklungstendenzen des Fundraising in der Zukunft: Das Kapitel analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen (demografischer Wandel, Rückgang öffentlicher Mittel, steigender Wettbewerb), die Entwicklung der Spendenmotive und -zwecke sowie die zunehmende Bedeutung von Online-Fundraising und Crowdfunding. Es prognostiziert eine weitere Zunahme der Bedeutung des Fundraisings für Non-Profit-Organisationen in Zukunft.
Schlüsselwörter
Fundraising, Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Spendenmotivation, Soziale Marktwirtschaft, Sozialmanagement, Ethische Grundsätze, Online-Fundraising, Crowdfunding, Spendenverhalten, Entwicklungstendenzen, Relationship-Fundraising, Ressourcenbeschaffung, Gemeinwohl, Transparenz.
FAQ: Fundraising von Non-Profit-Organisationen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Fundraising von Non-Profit-Organisationen in Deutschland, mit besonderem Fokus auf die Gewinnung von Spenden durch Privatpersonen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung, aktuelle Herausforderungen und zukünftige Trends im Fundraising.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die historische Entwicklung des Fundraising und der Non-Profit-Organisationen; Finanzierungsmodelle von Non-Profit-Organisationen und deren Herausforderungen; Motive von Spendern und Non-Profit-Organisationen; ethische, moralische und rechtliche Aspekte des Fundraising; und zukünftige Entwicklungstendenzen im Fundraising, insbesondere im digitalen Kontext (Online-Fundraising und Crowdfunding).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Non-Profit-Organisationen, Fundraising, Fundraising bei Privatpersonen, Zwischenergebnis, Grundfragen des Fundraising und Entwicklungstendenzen des Fundraising in der Zukunft. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Was sind die zentralen Forschungsfragen der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Grundfragen der professionellen Mittelbeschaffung für Non-Profit-Organisationen. Sie untersucht die Motive von Spendern und Organisationen, die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und die zukünftigen Herausforderungen im Fundraising.
Welche Finanzierungsmodelle von Non-Profit-Organisationen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet klassische Finanzierungsformen wie öffentliche Mittel, private Spenden, Sponsoring und Mitgliedsbeiträge und analysiert deren Bedeutung im Kontext zunehmender Konkurrenz.
Welche Rolle spielt die Beziehungspflege im Fundraising?
Die Beziehungspflege zwischen Organisation und Spender ("Relationship Fundraising") wird als entscheidend für den langfristigen Erfolg des Fundraising hervorgehoben.
Welche ethischen, moralischen und rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die ethischen, moralischen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Fundraising, von der Informationsgabe und dem Spendenaufruf bis hin zur Transparenz und Selbstbestimmung der Spender.
Welche zukünftigen Entwicklungstendenzen im Fundraising werden prognostiziert?
Die Arbeit analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen (demografischer Wandel, Rückgang öffentlicher Mittel, steigender Wettbewerb), die Entwicklung der Spendenmotive und -zwecke und die zunehmende Bedeutung von Online-Fundraising und Crowdfunding. Eine weitere Zunahme der Bedeutung des Fundraisings für Non-Profit-Organisationen wird prognostiziert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Fundraising, Non-Profit-Organisationen, Privatpersonen, Spendenmotivation, Soziale Marktwirtschaft, Sozialmanagement, Ethische Grundsätze, Online-Fundraising, Crowdfunding, Spendenverhalten, Entwicklungstendenzen, Relationship-Fundraising, Ressourcenbeschaffung, Gemeinwohl, Transparenz.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine ausführliche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels beschreibt.
- Citar trabajo
- Joshua Fischer (Autor), 2019, Fundraising durch Non-Profit-Organisationen mit Schwerpunkt Privatpersonen in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513044