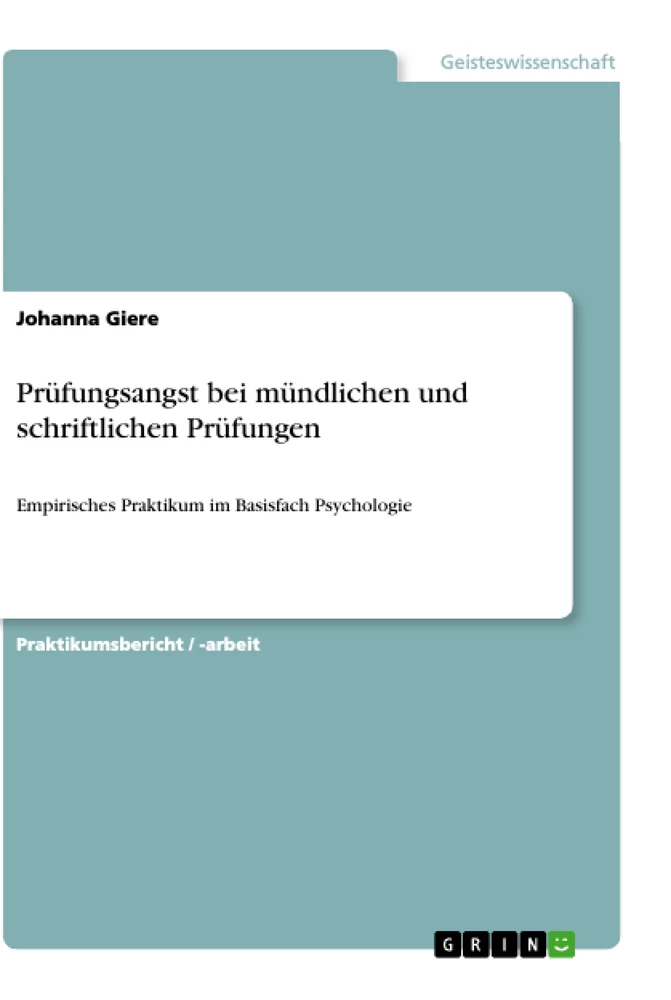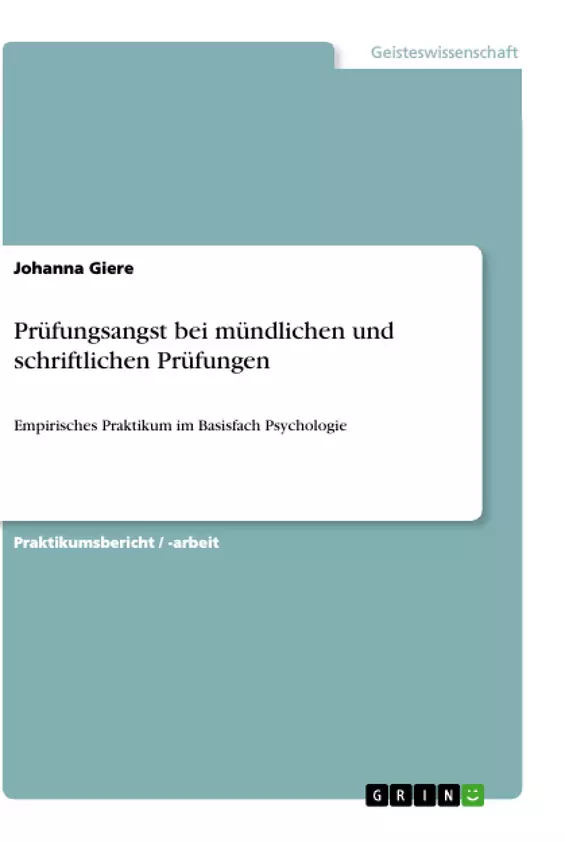Die vorliegende Studie befasst sich mit Prüfungsangst bei mündlichen und schriftlichen Prüfungen und wurde im Rahmen eines empirischen Praktikums durchgeführt. Zur Überprüfung der ersten Hypothese, dass die State-Angst (Zustandsangst) bei mündlichen Prüfungen höher ist, wurde zur Datenerhebung der Stai-I einen Abend vor der Prüfung, bei einer Stichprobe von 15 Probanden, verwendet. Für die zweite Hypothese sollte der Unterschied von Post-event processing (Grübeln nach einem sozialem Ereignis) bei beiden Prüfungsarten anhand von 14 Probanden untersucht werden. Daten zum PEP wurde anhand des PEPQ von Rachman et al. (2000) am Abend nach der Klausur und sieben Tage später erhoben. Mit der dritten Hypothese sollte geprüft werden, ob das PEP bei fünf Probanden umso ausgeprägter ist, desto mehr die Diskrepanz zwischen erreichter und erwarteter Note bei mündlichen Prüfungen ins negative geht. Hypothese 1 und 2 zeigten keine signifikanten Ergebnisse und Hypothese 3 konnte nicht überprüft werden. Die Ergebnisse der Studie sind auf mangelnde Probandenzahl zurückzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Prüfungsangst
- Trait- und State-Angst
- Post-event processing
- Hypothesen
- Methode
- Stichprobe
- Materialien
- Stai-I
- PEP-Q
- Verfahren
- Ergebnisse
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie untersucht die "Prüfungsangst" bei mündlichen und schriftlichen Prüfungen und analysiert, wie die State-Angst sowie das Post-event Processing (PEP) in beiden Prüfungsformen variieren.
- Zusammenhang zwischen State-Angst und Prüfungsart
- Unterschiede im Post-event Processing nach mündlichen und schriftlichen Prüfungen
- Einfluss der Diskrepanz zwischen erreichter und erwarteter Note auf das PEP bei mündlichen Prüfungen
- Analyse von prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren, die Prüfungsangst beeinflussen
- Bedeutung von Trait- und State-Angst im Kontext der Prüfungsangst
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema "Prüfungsangst" vor und erläutert die Relevanz der Studie im Kontext bestehender Forschung. Sie geht auf die verschiedenen Faktoren ein, die Prüfungsangst beeinflussen können, sowie auf den theoretischen Hintergrund des Phänomens.
- Hypothesen: In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen der Studie in Form von Hypothesen formuliert. Die Hypothesen beziehen sich auf die Unterschiede in der State-Angst zwischen mündlichen und schriftlichen Prüfungen, den Einfluss der Prüfungsart auf das PEP sowie den Zusammenhang zwischen Diskrepanz von Noten und PEP.
- Methode: Die Methodik der Studie wird detailliert dargestellt. Es werden die Stichprobe, die verwendeten Materialien, das Studiendesign sowie das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung beschrieben.
- Ergebnisse: Die Ergebnisse der Studie werden präsentiert und statistisch analysiert. Die Analyse der Daten fokussiert auf die Überprüfung der formulierten Hypothesen.
- Diskussion: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie diskutiert und interpretiert. Die Schlussfolgerungen werden im Kontext der bestehenden Forschung betrachtet und die Grenzen der Studie werden aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Studie befasst sich mit den zentralen Themen "Prüfungsangst", "State-Angst", "Post-event Processing", "Trait-Angst", "mündliche Prüfungen", "schriftliche Prüfungen", "soziales Ereignis", "negatives Denken" und "Leistungsängstlichkeit".
- Quote paper
- Johanna Giere (Author), 2019, Prüfungsangst bei mündlichen und schriftlichen Prüfungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513163