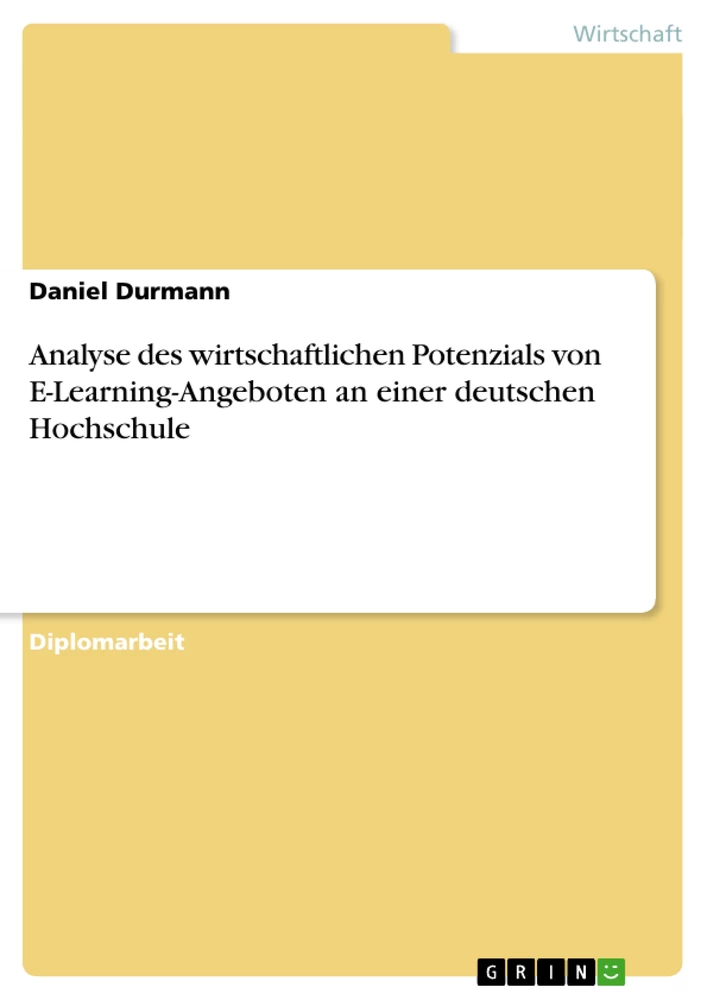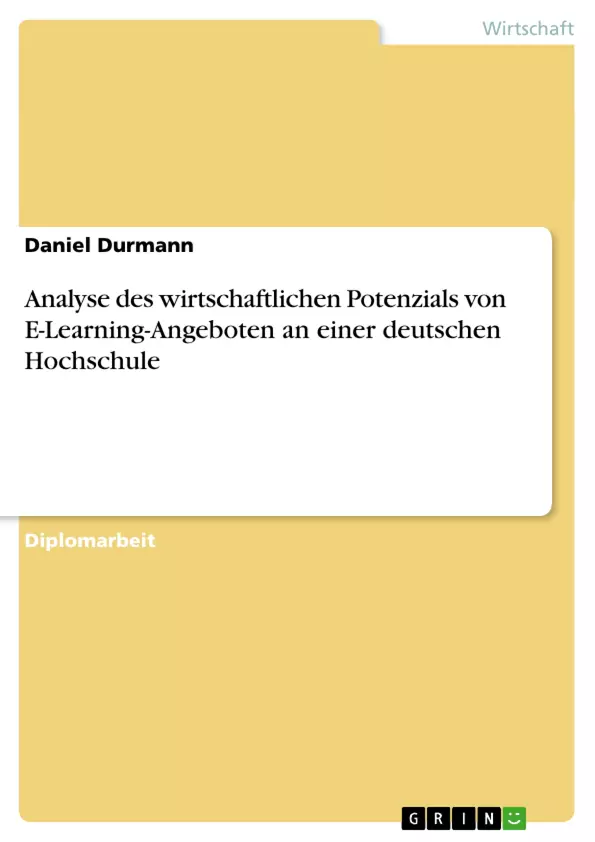roblemstellung
In den letzten Jahren wurde E-Learning an den Hochschulen als Experimentierung von einigen Forschern durchgeführt, die als Vorreiter neue webbasierte Formen des Lehrens und Studierens entwickelt und ausprobiert haben. Dazu wurden verschiedene E-Learning- Projekte durch Drittmittel gefördert, deren Nachhaltigkeit aber dadurch nicht gesichert werden konnte. Durch diese Projekte ist weder eine kritische Masse von multimedial aufbereiteten Lehrinhalten entstanden, noch ist es gelungen, diese neuen Lehr- und Lernformen flächendeckend einzuführen und dafür notwendige bzw. nachhaltige Infrastrukturen aufzubauen.1 Der Bund und die Länder, aber auch viele Hochschulleitungen streben deshalb an, E-Learning an den Hochschulen breiter und nachhaltiger als bisher zu verankern, indem strategische Vorgaben gemacht, Anreize geschaffen und notwendige Infrastrukturen aufgebaut werden.2 Nach dem Ablauf der Förderprogramme versuchen die Hochschulen den nachhaltigen Einsatz von E-Learning-Angeboten zu gewährleisten. Unter diesem Aspekt hat die dauerhafte Finanzierung der E-Learning-Angebote an deutschen Hochschulen an Bedeutung gewonnen. Obwohl in der Industrie mittlerweile Überlegungen über die Finanzierung für einen nachhaltigen Einsatz von E-Learning durch die Vermarktung der E-Learning-Angeboten seit langem zur Wirklichkeit umgesetzt wurde, wird in Hochschulen E-Learning häufig noch durch Landesmittel oder das BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) finanziert. Auf Grund der finanziellen Probleme verlaufen sich die meisten Projekte nach Ablauf der Förderdauer im Sande oder Projektergebnisse werden nach Ablauf des Projektes nicht weiter verwertet.3
------
1 Vgl. Schirmbacher [2005].
2 Vgl. Kleimann/Wannemacher [2004, S.3].
3 Vgl. Löhrmann [2004, S.12 f].
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Grundlagen des E-Learning
- Begriffserklärung und Abgrenzung
- Formen des E-Learning
- Eingesetzte Technologien im E-Learning
- Einsatz von E-Learning an Hochschulen
- Analyse der Lage an deutschen Hochschulen
- Das wirtschaftliche Potenzial von E-Learning-Angeboten
- E-Learning-Strategien der Hochschulen
- Die Akteure des E-Learning im Hochschulbereich
- Möglichkeiten der Hochschulen
- Finanzierung der E-Learning-Angebote
- Ausgewählte E-Learning-Initiative an der JWG-Universität
- Komponenten und Aufbau der megadigitale
- Bereits geförderte Projekte
- Empirische Analyse des wirtschaftlichen Potenzials
- Aufbau und Durchführung der Umfrage
- Konventionell
- Online Version
- Verwendete Software
- Auswertung der Ergebnisse
- Deskriptive Auswertung
- Analytische Auswertung
- Nominalskalierte Merkmale
- Metrischskalierte Merkmale
- Schlussfolgerungen
- Gestaltungsempfehlungen für Geschäftsmodelle im E-Learning
- Eine mögliche Definition von Geschäftsmodell
- Geschäftsmodell und die Nachhaltigkeit von E-Learning
- Gestaltungsempfehlungen
- Weitere mögliche wirtschaftliche Potenziale des E-Learning
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Analyse des wirtschaftlichen Potenzials von E-Learning-Angeboten an einer deutschen Hochschule. Sie untersucht die aktuelle Situation des E-Learning an Hochschulen, insbesondere die E-Learning-Strategien, die Akteure und die Finanzierungsmöglichkeiten. Die Arbeit analysiert auch die Bereitschaft von Studenten, für E-Learning-Angebote zu bezahlen, und entwickelt Gestaltungsempfehlungen für Geschäftsmodelle im E-Learning.
- Analyse des wirtschaftlichen Potenzials von E-Learning-Angeboten an deutschen Hochschulen
- Untersuchung der E-Learning-Strategien und -Akteure im Hochschulbereich
- Bewertung der Finanzierungsmöglichkeiten von E-Learning-Angeboten
- Empirische Analyse der Bereitschaft von Studenten, für E-Learning-Angebote zu bezahlen
- Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen für Geschäftsmodelle im E-Learning
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung und den Gang der Untersuchung dar.
- Grundlagen des E-Learning: Dieses Kapitel liefert eine Begriffserklärung und Abgrenzung von E-Learning, beschreibt verschiedene Formen des E-Learning und erläutert eingesetzte Technologien.
- Einsatz von E-Learning an Hochschulen: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Situation des E-Learning an deutschen Hochschulen, insbesondere die E-Learning-Strategien, die Akteure und die Finanzierungsmöglichkeiten. Es werden auch ausgewählte E-Learning-Initiativen an der JWG-Universität vorgestellt.
- Empirische Analyse des wirtschaftlichen Potenzials: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Durchführung einer Umfrage, die die Bereitschaft von Studenten für E-Learning-Angebote untersucht. Es werden die Ergebnisse der Umfrage deskriptiv und analytisch ausgewertet.
- Gestaltungsempfehlungen für Geschäftsmodelle im E-Learning: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Geschäftsmodells und untersucht die Nachhaltigkeit von E-Learning. Es werden Gestaltungsempfehlungen für Geschäftsmodelle im E-Learning gegeben und weitere mögliche wirtschaftliche Potenziale des E-Learning aufgezeigt.
Schlüsselwörter
E-Learning, Hochschule, Wirtschaftliches Potenzial, E-Learning-Strategien, Akteure, Finanzierung, Geschäftsmodelle, Nachhaltigkeit, Empirische Analyse, Studenten, Zahlungsbereitschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheitern viele E-Learning-Projekte an Hochschulen?
Oft fehlt es an nachhaltigen Finanzierungsmodellen nach dem Auslaufen von Drittmittel-Förderungen (z. B. durch das BMBF).
Sind Studenten bereit, für E-Learning-Angebote zu bezahlen?
Die Arbeit enthält eine empirische Analyse zur Zahlungsbereitschaft von Studenten, um das wirtschaftliche Potenzial solcher Angebote zu bewerten.
Was ist das Projekt "megadigitale" an der JWG-Universität?
Es ist eine ausgewählte E-Learning-Initiative der Universität Frankfurt, deren Aufbau und Komponenten in der Arbeit vorgestellt werden.
Wie können Geschäftsmodelle für E-Learning an Hochschulen aussehen?
Die Arbeit gibt Gestaltungsempfehlungen für nachhaltige Geschäftsmodelle, die über eine reine staatliche Finanzierung hinausgehen.
Welche Technologien werden im Hochschul-E-Learning eingesetzt?
Untersucht werden webbasierte Lernplattformen, multimediale Lehrinhalte und infrastrukturelle Voraussetzungen für flächendeckendes Lernen.
- Quote paper
- Dipl. Kfm. Daniel Durmann (Author), 2006, Analyse des wirtschaftlichen Potenzials von E-Learning-Angeboten an einer deutschen Hochschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51327