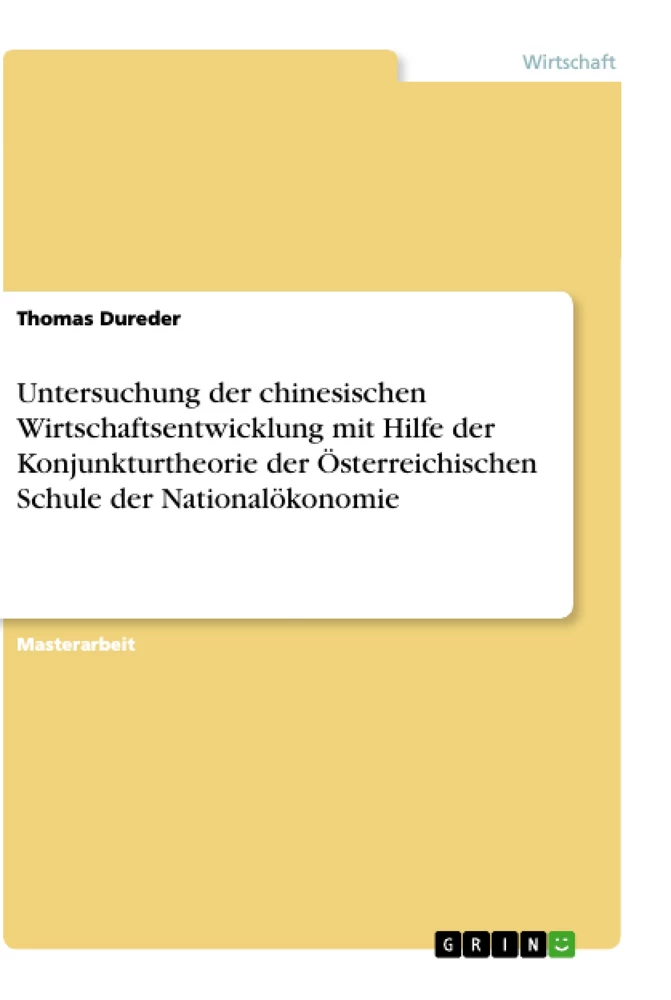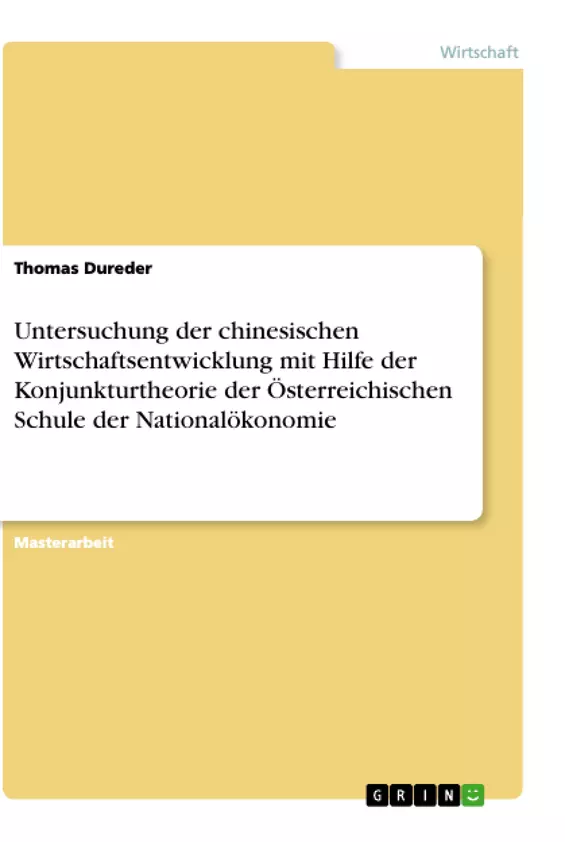Die Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule, welche die Ursache von Konjunkturzyklen in der Kreditexpansion sieht, ist das zentrale Instrument dieser Arbeit. Aus der Sicht dieser Theorie soll die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft untersucht werden. Dabei soll qualitativ festgestellt werden, inwiefern das Geldmengenwachstum für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich ist. Die Wurzeln der Österreichische Schule, die 1871 offiziell von Carl Menger gegründet wurde, reichen bis ins antike Griechenland zurück. Dabei stützt sich die Schule auf die Theorie des menschlichen Handelns. Im Gegensatz zu anderen Schulen werden keine Annahmen getroffen, dass es sich beim Menschen um Roboter handelt, sondern um wirkliche Wesen aus Fleisch und Blut, die nach subjektivem Empfinden individuell handeln. So lautet das grundlegende Axiom, dass Individuen stets zweckgebunden handeln und unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln versuchen, ihre individuellen und subjektiven Ziele zu erreichen. Aus Sicht der Österreicher wird der Markt durch eine große Anzahl von Individuen koordiniert. Aufgrund der hohen Komplexität sind einzelne Individuen nicht in der Lage, ein derartiges Maß an Effizienz zu erreichen.
In dieser Arbeit wird zunächst die Geschichte der Österreichischen Schule vorgestellt. Im nächsten Abschnitt des zweiten Kapitels wird auf den theoretischen Hintergrund der Österreichischen Schule eingegangen. Dabei wird die grundlegende Methodik aufgezeigt und im Anschluss die Grundsätze der Schule mit denen der Neoklassischen Theorie verglichen. Im dritten Teil des zweiten Kapitels werden die Österreichische Konjunkturtheorie und deren Grundlagen, die für ein besseres Verständnis hilfreich sind, erklärt. Im folgenden Abschnitt werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die sich aus Sicht der Österreichischen Schule in einem wirtschaftlichen Abschwung anbieten. Im letzten Abschnitt des zweiten Kapitels wird eine Kritik an der Schule beziehungsweise an deren Konjunkturtheorie aufgezeigt. In Kapitel drei werden dann Indikatoren beziehungsweise Größen vorgestellt, mit welchen im vierten Kapitel die chinesische Wirtschaft untersucht werden soll. Kapitel 5 liefert eine Zusammenfassung der in Kapitel vier vorgestellten Ergebnisse und beinhaltet eine Beurteilung der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie der österreichischen Schule
- Geschichte
- Methodik und Grundsätze
- Österreichische Konjunkturtheorie (ÖKT)
- Grundlagen
- Cantillon-Effekt
- Preisniveaustabilität und Geldwert
- Kapital und Kapitalgüter
- Zeitpräferenz bzw. Urzins
- Erzwungenes Sparen
- Theorie der Currency School
- Natürlicher Zins vs. Geldzins
- Erklärung der Änderung der Produktionsstruktur am Beispiel Sparen
- Entstehung der Konjunkturzyklen aus Österreichischer Sicht
- Handlungsempfehlungen der Österreichischen Schule
- Kritik an der Österreichischen Schule
- Kritische Würdigung ausgewählter Konjunkturindikatoren
- Untersuchung der chinesischen Wirtschaftsentwicklung anhand der ÖKT
- Internationale Einflussfaktoren
- Geldmenge
- Zinsspread
- Bruttoinlandsausstoß
- Güterproduktion
- Arbeitsmarktentwicklung
- Rohstoffverbrauch
- Relative Preisveränderung zwischen den unterschiedlichen Produktionsstufen
- Immobilienmarkt und Börse
- Staatlicher Einfluss
- Sparquote bzw. Investitionsquote
- Zusammenfassung und Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen Situation Chinas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der chinesischen Wirtschaftsentwicklung unter Anwendung der Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule. Ziel ist es, den Einfluss des Geldmengenwachstums auf den wirtschaftlichen Erfolg Chinas zu untersuchen.
- Geschichte und Grundprinzipien der Österreichischen Schule
- Österreichische Konjunkturtheorie und ihre zentralen Elemente
- Kritische Würdigung der Österreichischen Schule und ihrer Konjunkturtheorie
- Analyse der chinesischen Wirtschaftsentwicklung anhand ausgewählter Indikatoren
- Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen Situation Chinas aus Sicht der Österreichischen Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den Zusammenhang zwischen der Österreichischen Schule und der Analyse der chinesischen Wirtschaft. Das zweite Kapitel widmet sich der Geschichte, Methodik und den Grundsätzen der Österreichischen Schule und stellt die österreichische Konjunkturtheorie (ÖKT) vor. Dabei werden zentrale Konzepte der ÖKT, wie der Cantillon-Effekt, die Zeitpräferenz und die Rolle des Geldes, erläutert. Außerdem werden Handlungsempfehlungen der Österreichischen Schule für wirtschaftliche Abschwünge vorgestellt und die Kritik an der Schule beleuchtet.
Kapitel drei stellt wichtige Konjunkturindikatoren vor, die im vierten Kapitel zur Analyse der chinesischen Wirtschaftsentwicklung herangezogen werden. Kapitel fünf fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine Beurteilung der wirtschaftlichen Situation Chinas aus Sicht der Österreichischen Schule.
Schlüsselwörter
Österreichische Schule, Konjunkturtheorie, Geldmengenwachstum, Kreditexpansion, chinesische Wirtschaft, Wirtschaftsentwicklung, Indikatoren, Kapital, Zeitpräferenz, Inflation, Deflation, Sparen, Investitionen, Staatsintervention.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Österreichische Konjunkturtheorie (ÖKT)?
Die ÖKT sieht die Ursache von Konjunkturzyklen in einer künstlichen Kreditexpansion, die zu Fehlinvestitionen und einer Verzerrung der Produktionsstruktur führt.
Was besagt der Cantillon-Effekt?
Er beschreibt, dass eine Erhöhung der Geldmenge nicht alle Marktteilnehmer gleichzeitig erreicht, wodurch Erstempfänger des neuen Geldes auf Kosten der Letztempfänger profitieren.
Wie beurteilt die Österreichische Schule die chinesische Wirtschaft?
Die Forschung untersucht, inwiefern das enorme Geldmengenwachstum und staatliche Interventionen in China zu einer künstlichen Blase geführt haben könnten.
Was versteht man unter 'Erzwungenem Sparen'?
Es beschreibt eine Situation, in der Konsumenten aufgrund von Inflation und Preissteigerungen weniger konsumieren können, während Ressourcen in kapitalintensive Projekte fließen.
Welche Handlungsempfehlungen gibt die Schule bei einem Abschwung?
Im Gegensatz zu anderen Schulen empfiehlt sie oft, den Markt sich selbst bereinigen zu lassen und weitere Kreditexpansionen zur Krisenbekämpfung zu vermeiden.
- Citar trabajo
- Thomas Dureder (Autor), 2010, Untersuchung der chinesischen Wirtschaftsentwicklung mit Hilfe der Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513414