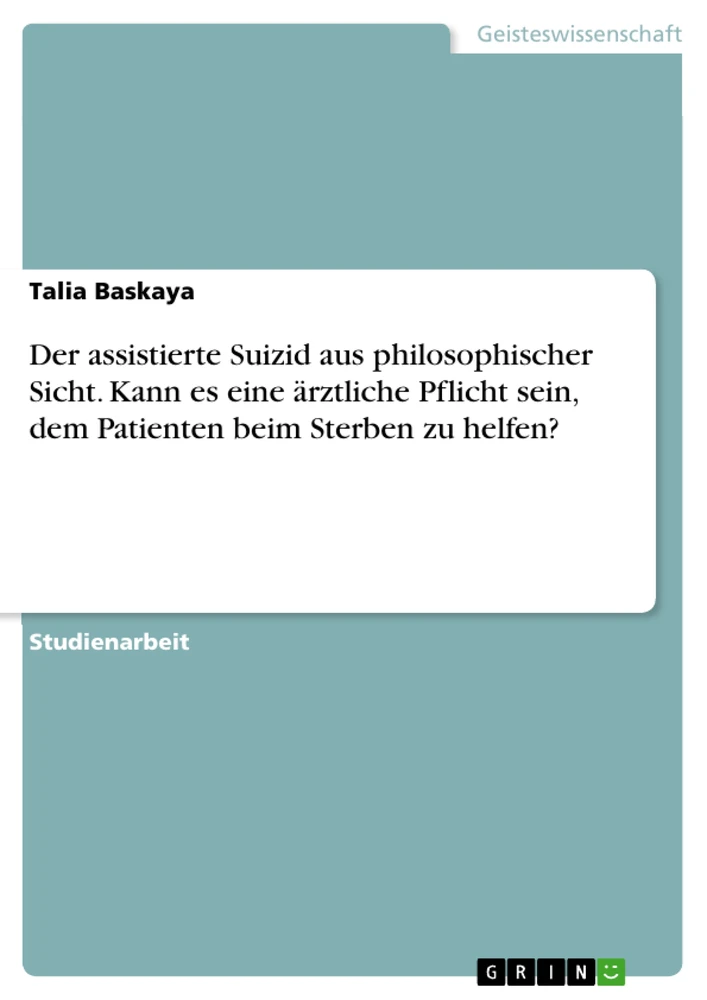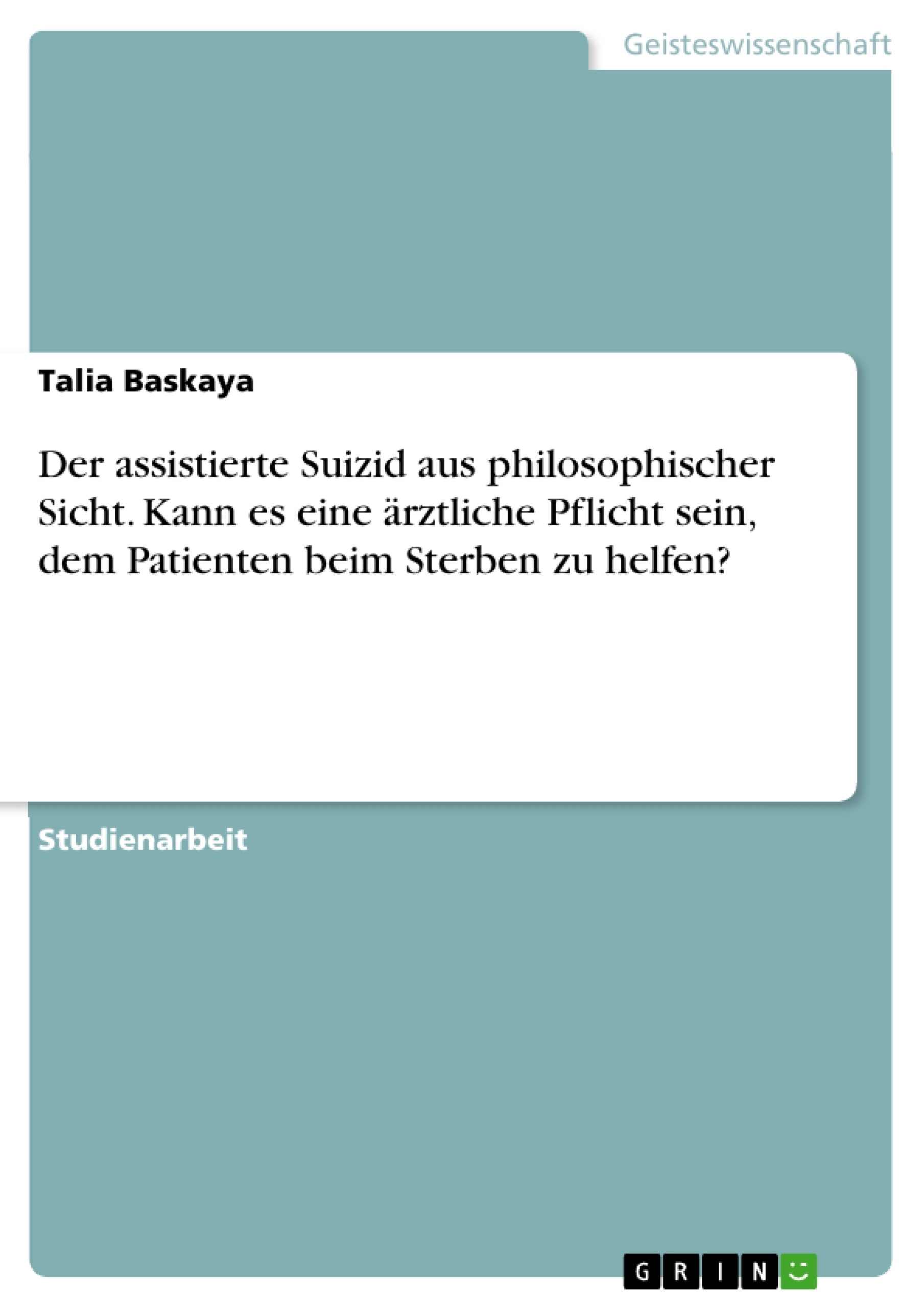Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem assistierten Suizid aus philosophischer Sicht. Der hippokratische Eid zugunsten des Selbstbestimmungsrechts der Patienten wird immer mehr infrage gestellt. Einer der Streitpunkte diesbezüglich, der in den letzten Jahren am meisten zur Debatte stand, ist die Frage, ob und wie Mediziner auf einen möglichen Suizidwunsch ihrer Patienten reagieren müssen, sollte dieser an Schmerzen oder einer unheilbaren Krankheit leiden. Diese Arbeit soll die Frage beantworten, ob ein Arzt nicht nur die Erlaubnis, sondern sogar die Pflicht haben kann, einem Patienten beim Sterben behilflich zu sein.
Zunächst werden hierfür die Pflichten des Arztes und die Arzt-Patientenbeziehung sowie das Selbstbestimmungsrecht des Patienten geschildert. Damit die Untersuchung des Dilemmas gründlich durchgeführt werden kann, wird zunächst der Begriff "Sterbehilfe" in seinen Facetten elaboriert und die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten voneinander unterschieden. Zudem wird der rechtliche Handlungsspielraum erörtert, wobei der Fokus auf der Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland liegt. Im Anschluss wird herausgearbeitet, inwiefern sich Ärzte in einem moralischen Dilemma befinden, das sowohl ihre berufliche, als auch ihre persönliche Lebenswelt beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ärztliche Pflichten und die Arzt-Patientenbeziehung
- Aktualisierung des Genfer Gelöbnisses
- Medizinische Prinzipien und Patientenrechte
- Arten der Sterbehilfe
- Aktive Sterbehilfe
- Passive Sterbehilfe
- Indirekte Sterbehilfe
- Der assistierte Suizid
- Moralisches Dilemma der Mediziner
- Die Stimmen gegen den assistierten Suizid
- Stimmen für den assistierten Suizid
- Möglichkeiten für den kontrollierten assistierten Suizid
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem moralischen Dilemma des ärztlich assistierten Suizids. Sie untersucht die Frage, ob ein Arzt nicht nur die Erlaubnis, sondern sogar die Pflicht haben kann, einem Patienten beim Sterben behilflich zu sein. Im Vordergrund stehen die Pflichten des Arztes, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten und die verschiedenen Formen der Sterbehilfe. Die Arbeit analysiert die Argumente für und gegen den assistierten Suizid und beleuchtet die aktuelle Rechtslage in Deutschland.
- Ärztliche Pflichten und die Arzt-Patientenbeziehung
- Patientenautonomie und Selbstbestimmungsrecht
- Verschiedene Formen der Sterbehilfe
- Rechtliche und ethische Aspekte des assistierten Suizids
- Moralisches Dilemma des Arztes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema des assistierten Suizids vor und erläutert die Relevanz der Fragestellung. Sie führt das moralische Dilemma, dem sich Ärzte gegenübersehen, ein und skizziert den Aufbau der Hausarbeit.
Ärztliche Pflichten und die Arzt-Patientenbeziehung
Dieses Kapitel beleuchtet die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen des ärztlichen Handelns. Es beleuchtet die Aktualisierung des Genfer Gelöbnisses und die Bedeutung von Patientenautonomie und Transparenz in der Arzt-Patientenbeziehung. Das Kapitel geht auf medizinische Prinzipien wie das Wohltun, das Nichtschadens und die Patientenautonomie ein.
Arten der Sterbehilfe
In diesem Kapitel werden verschiedene Formen der Sterbehilfe definiert und voneinander abgegrenzt. Es werden die Begriffe "Aktive Sterbehilfe", "Passive Sterbehilfe", "Indirekte Sterbehilfe" und "Assistierter Suizid" erläutert.
Moralisches Dilemma der Mediziner
Dieses Kapitel behandelt die moralischen Konflikte, denen sich Ärzte im Zusammenhang mit dem assistierten Suizid gegenüberstehen. Es analysiert die Argumente für und gegen die Zulässigkeit des assistierten Suizids und beleuchtet die unterschiedlichen Standpunkte in der Debatte.
Schlüsselwörter
Assistierter Suizid, Sterbehilfe, Patientenautonomie, Selbstbestimmungsrecht, Arzt-Patientenbeziehung, Genfer Gelöbnis, Medizinische Prinzipien, Moralisches Dilemma, Rechtliche Rahmenbedingungen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Kann ein Arzt eine Pflicht haben, beim Sterben zu helfen?
Die Hausarbeit untersucht das philosophische Dilemma zwischen dem hippokratischen Eid (Leben erhalten) und dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten auf ein würdevolles Ende.
Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe?
Aktive Sterbehilfe ist die gezielte Tötung auf Verlangen, während passive Sterbehilfe das Unterlassen oder Abbrechen lebenserhaltender Maßnahmen bezeichnet.
Wie wird „assistierter Suizid“ definiert?
Beim assistierten Suizid stellt der Arzt dem Patienten das tödliche Mittel zur Verfügung, der Patient nimmt es jedoch selbstständig ein.
Was besagt das Genfer Gelöbnis in der modernen Fassung?
Die Arbeit beleuchtet die Aktualisierung des Gelöbnisses, die verstärkt auf die Autonomie des Patienten und die Achtung seines Willens abzielt.
Welche Argumente sprechen gegen den assistierten Suizid?
Kritiker führen das Risiko von Missbrauch, den moralischen Druck auf Kranke und die Unvereinbarkeit mit dem ärztlichen Ethos an.
Wie ist die Rechtslage in Deutschland?
Die Arbeit erörtert den rechtlichen Handlungsspielraum für Mediziner in der Bundesrepublik unter Berücksichtigung aktueller Urteile zur Sterbehilfe.
- Quote paper
- Talia Baskaya (Author), 2018, Der assistierte Suizid aus philosophischer Sicht. Kann es eine ärztliche Pflicht sein, dem Patienten beim Sterben zu helfen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513415