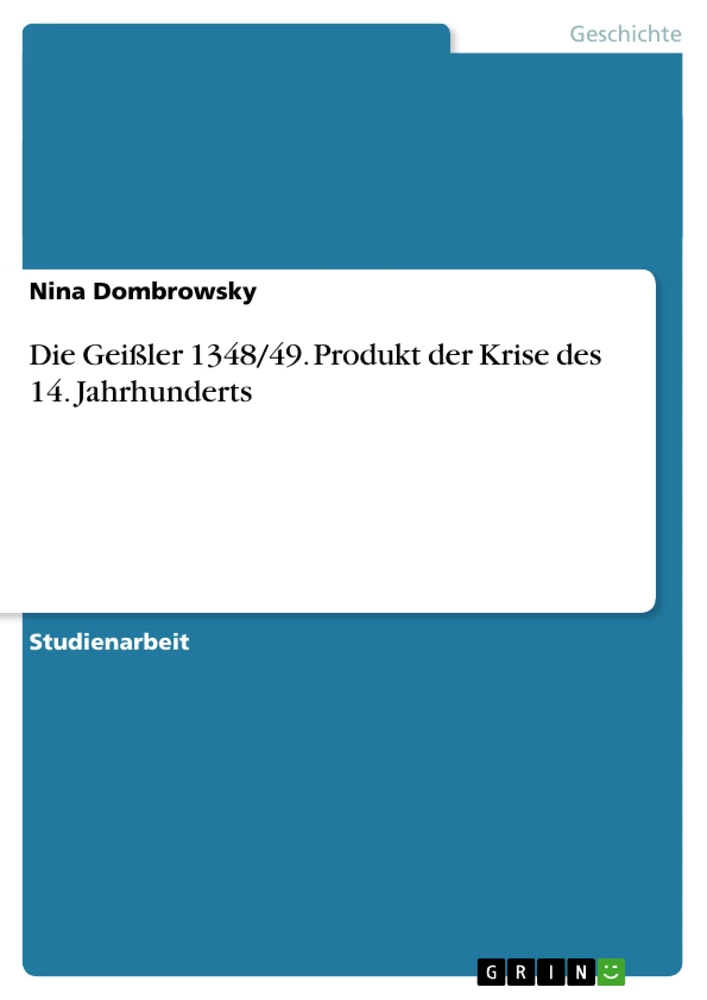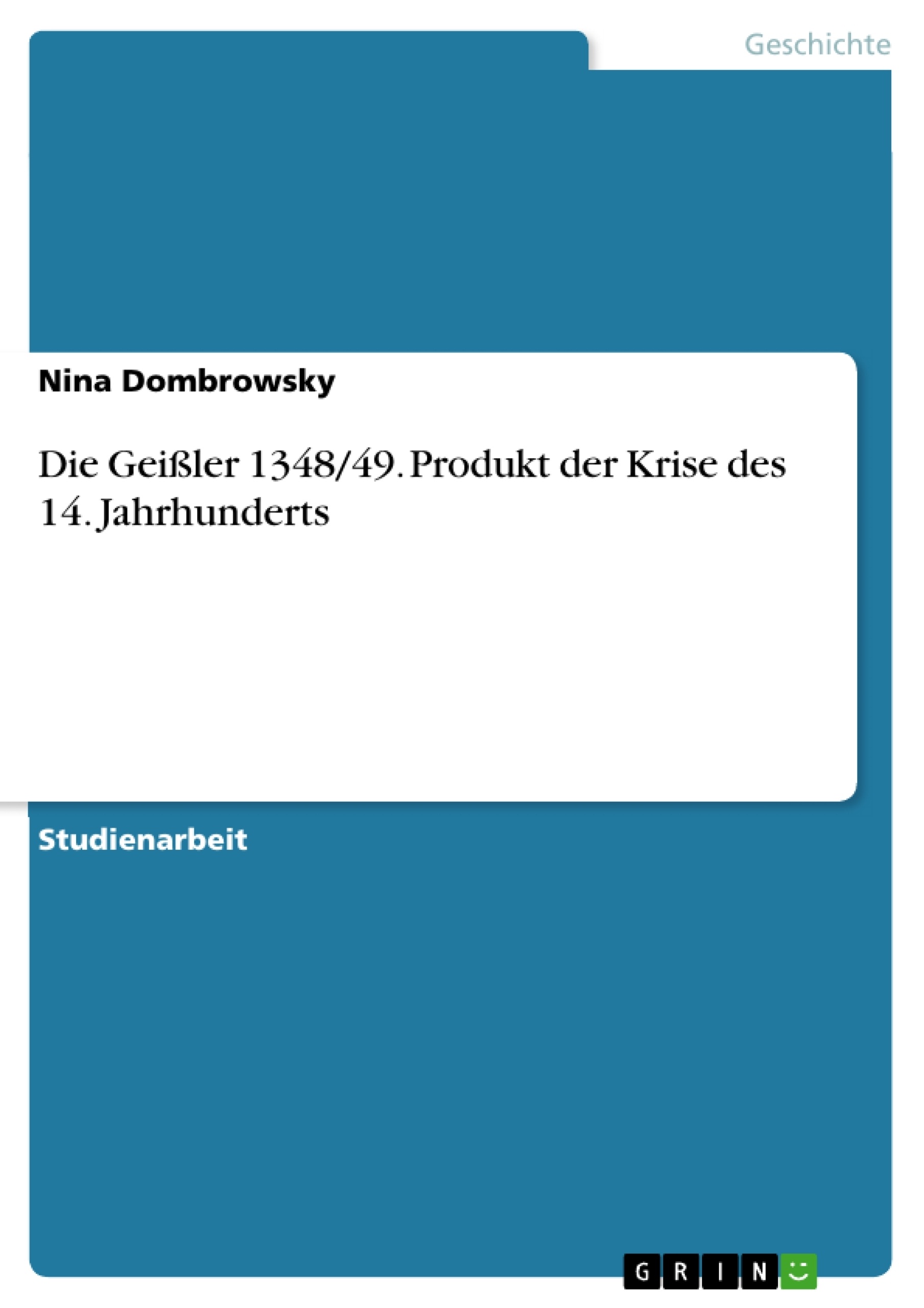A Einleitung
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, inwieweit die Ereignisse der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die allgemein unter dem Begriff "Krise" zusammengefasst werden, konstitutiv sind für das Entstehen einer religiösen Massenbewegung, wie hier im Phänomen der Geißler.
Keinesfalls soll es um eine lückenlose chronologische Darstellung der Ereignisse des 14. Jahrhunderts gehen. Es sollen einige repräsentative charakteristische Grundtendenzen aufgezeigt werden, die das 14. Jahrhundert prägen. Exemplarisch werden hier die Pest, die Situation der Kirche und die Judenverfolgungen dargestellt und hinsichtlich ihrer Funktion bezüglich der Geißlerbewegung und ihrer Auswirkung auf ein subjektives Krisenbewusstsein analysiert. Der Schwerpunkt liegt jedoch deutlich auf den Bereichen Pest und Kirche, da sich hier direkte Verbindungen zu dem Phänomen der Geißler ziehen lassen und sich die Situation der Kirche sowie die Pest und ihre Folgen m. E. am nachdrücklichsten und intensivsten auf die Stimmung der Zeitgenossen auswirkten.
Im ersten Abschnitt wird der Begriff der "Krise" behandelt. Es werden zwei kontroverse Forschermeinungen vorgestellt und eine Arbeitshypothese erarbeitet, auf der die Arbeit analytisch basiert.
Der zweite Abschnitt stellt kurz überblicksartig die Situation um 1260 in Italien vor. Dies dient dem Ziel, die Geißlerbewegung des 13. Jahrhunderts von der des 14. abzugrenzen, Unterschiede aufzuzeigen, sowie einen ersten Anhaltspunkt zu erhalten, welche äußeren Umstände eine derartige Bewegung begünstigen können.
Der Pest widmet sich der dritte Abschnitt. Dieses Phänomen wird vergleichsweise ausführlich behandelt, da es sich hier um ein einschneidendes Elementarereignis handelt, das sich über Jahre hinaus auf den Alltag der Zeitgenossen auswirkt und ebenso grundlegend für die Stimmung und das Zeitgefühl der Zeitgenossen ist. Desweiteren ist die Pest für das Phänomen der Geißlerbewegung der Jahre 1348/49 unter anderem Voraussetzung.
Ebenfalls nur überblicksartig beschäftigt sich der vierte Abschnitt mit den Judenverfolgungen in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Da den Judenpogromen zwar bezüglich der Stimmung der Zeitgenossen Bedeutung zukommt, sich aber keine direkte Verbindung zu den Geißlern herstellen lässt, darf eine kurze Beschäftigung mit den Judenverfolgungen zwar nicht fehlen, wird aber in Hinblick auf Thema und Umfang der Arbeit nicht als Schwerpunkt behandelt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die „Krise“ des 14. Jahrhunderts - eine Definition
- 2. Die Situation in Italien 1260
- 3. Die Pestwelle um 1350
- 4. Die Judenverfolgungen von 1348/49
- 5. Die Krise der Kirche
- 6. Die Geißler – Wirkung und Kontext
- 7. Das Beispiel Tournai
- a) Kritische Einordnung der Quelle
- b) Die Geißler in Tournai
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen den Ereignissen der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und dem Entstehen der religiösen Massenbewegung der Geißler. Sie konzentriert sich auf charakteristische Grundtendenzen des 14. Jahrhunderts, insbesondere die Pest, die Situation der Kirche und die Judenverfolgungen, und analysiert deren Einfluss auf das subjektive Krisenbewusstsein und die Geißlerbewegung. Der Schwerpunkt liegt auf Pest und Kirche aufgrund ihrer direkten Verbindung zum Phänomen der Geißler.
- Definition des Begriffs „Krise“ im 14. Jahrhundert
- Der Einfluss der Pest auf die Gesellschaft und die Geißlerbewegung
- Die Rolle der Kirche und des Klerus im Kontext der Geißlerbewegung
- Die Judenverfolgungen und ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Stimmung
- Die Wirkung der Geißlerbewegung anhand des Beispiels Tournai
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die „Krise“ des 14. Jahrhunderts – eine Definition: Dieses Kapitel untersucht den umstrittenen Begriff der „Krise“ im 14. Jahrhundert. Es werden die divergierenden Ansichten von Historikern wie Graus und Schuster vorgestellt, die unterschiedliche Definitionen und Interpretationen der damaligen Ereignisse bieten. Graus betont das Zusammenfallen verschiedener Erschütterungen und den Verlust von Sicherheit und Werten, während Schuster die These einer umfassenden Krise hinterfragt und den Einfluss der modernen Geschichtsschreibung auf die Interpretation betont. Die Arbeit wählt Graus' Definition als Arbeitshypothese, da diese ein subjektives Krisenbewusstsein miteinbezieht, welches die Arbeit zu belegen versucht.
2. Die Situation in Italien 1260: Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über die Situation in Italien um 1260. Ziel ist es, die Geißlerbewegung des 14. Jahrhunderts von der des 13. Jahrhunderts abzugrenzen und Unterschiede aufzuzeigen. Er dient als erster Anhaltspunkt, um zu verstehen, welche äußeren Umstände eine solche Bewegung begünstigen können. Der kurze Exkurs auf die Situation in Italien im Jahr 1260 dient als Vergleichsmaßstab für die Entwicklung der Geißlerbewegung im 14. Jahrhundert und zeigt potentielle Parallelen und Unterschiede in den gesellschaftlichen und politischen Bedingungen.
3. Die Pestwelle um 1350: Dieses Kapitel behandelt die Pest als ein einschneidendes Elementarereignis, das die Lebensrealität und das Zeitgefühl der Menschen nachhaltig prägte. Die langfristigen Auswirkungen auf den Alltag und die Stimmung der Bevölkerung werden ausführlich dargestellt. Die Pest wird als eine wichtige Voraussetzung für das Aufkommen der Geißlerbewegung der Jahre 1348/49 betrachtet. Die Analyse der Pest geht über die rein medizinische Perspektive hinaus und untersucht ihre sozialen, psychologischen und religiösen Konsequenzen.
4. Die Judenverfolgungen von 1348/49: Dieser Abschnitt befasst sich überblicksartig mit den Judenverfolgungen in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Obwohl den Pogromen Bedeutung für die gesellschaftliche Stimmung zukommt, wird der direkte Zusammenhang mit den Geißlern als gering eingeschätzt. Der Abschnitt untersucht den Einfluss der Judenverfolgungen auf das allgemeine Klima von Angst und Unsicherheit, das die Geißlerbewegung begünstigte, ohne jedoch einen direkten kausalen Zusammenhang zu postulieren.
5. Die Krise der Kirche: Dieses Kapitel analysiert die Situation der Kirche und das Verhältnis der Bevölkerung zur Institution und ihren Trägern. Die Bedeutung der Kirchen-Krise für die gesellschaftliche Stimmung und die Möglichkeit zur Massenagitation der Geißler wird ausführlich dargestellt. Ähnlich wie die Pest wird die Krise der Kirche als ein bedeutender Faktor für das Aufkommen der Geißlerbewegung angesehen. Die Analyse umfasst die verschiedenen Aspekte der kirchlichen Krise, ihre Ursachen und ihre Folgen für die Gesellschaft.
6. Die Geißler – Wirkung und Kontext: Dieser Abschnitt beleuchtet die Reaktion der Bevölkerung auf die Geißler und ihr Bußritual anhand von zeitgenössischen Quellen aus Straßburg und Limburg. Er untersucht den Zusammenhang zwischen Kritik am Klerus, der Pest und der Attraktivität der Geißlerbewegung. Die Analyse der Quellen ermöglicht es, ein detailliertes Bild der öffentlichen Wahrnehmung der Geißler und ihres Rituals zu zeichnen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Geißlerbewegung im 14. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen den Ereignissen der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Pest, Kirchen-Krise, Judenverfolgungen) und dem Entstehen der religiösen Massenbewegung der Geißler. Der Fokus liegt auf dem Einfluss dieser Ereignisse auf das subjektive Krisenbewusstsein und die Entstehung der Geißlerbewegung, wobei Pest und die Situation der Kirche aufgrund ihrer direkten Verbindung zu den Geißlern im Mittelpunkt stehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition des Begriffs „Krise“ im 14. Jahrhundert, der Einfluss der Pest auf die Gesellschaft und die Geißlerbewegung, die Rolle der Kirche und des Klerus, die Judenverfolgungen und ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Stimmung, und die Wirkung der Geißlerbewegung am Beispiel Tournai.
Wie wird der Begriff „Krise“ definiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Definitionen des Begriffs „Krise“ im 14. Jahrhundert, vergleicht die Ansichten von Historikern wie Graus und Schuster und wählt letztendlich Graus' Definition als Arbeitshypothese, da diese ein subjektives Krisenbewusstsein miteinbezieht.
Welche Rolle spielt die Pest?
Die Pest wird als ein einschneidendes Ereignis dargestellt, das die Lebensrealität und das Zeitgefühl der Menschen nachhaltig prägte und als wichtige Voraussetzung für das Aufkommen der Geißlerbewegung betrachtet wird. Die Analyse geht über die medizinische Perspektive hinaus und untersucht die sozialen, psychologischen und religiösen Konsequenzen.
Welche Bedeutung haben die Judenverfolgungen?
Die Judenverfolgungen von 1348/49 werden als ein Faktor für die allgemeine Stimmung von Angst und Unsicherheit betrachtet, der die Geißlerbewegung begünstigte. Ein direkter kausaler Zusammenhang wird jedoch als gering eingeschätzt.
Welche Rolle spielt die Kirche?
Die Arbeit analysiert die Situation der Kirche und ihr Verhältnis zur Bevölkerung. Die Kirchen-Krise wird als bedeutender Faktor für das Aufkommen der Geißlerbewegung angesehen und ihre verschiedenen Aspekte, Ursachen und Folgen für die Gesellschaft werden untersucht.
Wie wird die Geißlerbewegung dargestellt?
Die Geißlerbewegung wird anhand zeitgenössischer Quellen aus Straßburg und Limburg untersucht. Der Zusammenhang zwischen Kritik am Klerus, der Pest und der Attraktivität der Geißlerbewegung wird analysiert, um ein detailliertes Bild der öffentlichen Wahrnehmung der Geißler und ihres Rituals zu zeichnen. Das Beispiel Tournai dient als Fallstudie.
Was ist der Zweck des Kapitels über Italien 1260?
Das Kapitel über die Situation in Italien 1260 dient als Vergleichsmaßstab für die Geißlerbewegung im 14. Jahrhundert, um Unterschiede und Parallelen in den gesellschaftlichen und politischen Bedingungen aufzuzeigen und die Geißlerbewegung des 14. Jahrhunderts von der des 13. Jahrhunderts abzugrenzen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf zeitgenössische Quellen, u.a. aus Straßburg und Limburg, um die Reaktion der Bevölkerung auf die Geißler und ihr Bußritual zu beleuchten. Die Arbeit bezieht auch die unterschiedlichen Interpretationen von Historikern (Graus und Schuster) zum Thema "Krise" mit ein.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht die Schlussfolgerung, dass die Ereignisse der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, insbesondere die Pest und die Krise der Kirche, ein subjektives Krisenbewusstsein hervorriefen, welches das Aufkommen und die Akzeptanz der Geißlerbewegung begünstigte. Der direkte Einfluss der Judenverfolgungen wird als geringer eingeschätzt.
- Quote paper
- Nina Dombrowsky (Author), 2002, Die Geißler 1348/49. Produkt der Krise des 14. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5136